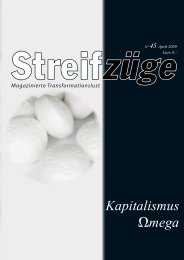streifzuege_47 Kopie - Streifzüge
streifzuege_47 Kopie - Streifzüge
streifzuege_47 Kopie - Streifzüge
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
ERICH RIBOLITS, BILDUNG HAT KEINEN WERT 39<br />
se brauchen oder wünschen wir? Was ist<br />
wissenswert?“ (Gorz 2004: 89) werden<br />
ignoriert. Die dem Wissen innewohnende<br />
Potenz, Menschen zu befähigen, sich<br />
über ihre bloße Kreatürlichkeit zu erheben<br />
und Autonomie zu gewinnen, hat dabei<br />
keine Bedeutung. Im Sinne der von<br />
Erich Fromm entwickelten Dichotomie<br />
von „Haben und Sein“ (Fromm 1979)<br />
zielt ein an formellem Wissen ausgerichtetes<br />
Lernen nicht auf eine Erweiterung<br />
des Bewusstseins und verändertes „Sein“,<br />
sondern darauf, Lernende zu „Besitzern“<br />
von Wissen zu machen – gelungene Lernprozesse<br />
beweisen sich darin, dass die ihnen<br />
Unterworfenen nachher mehr Wissen<br />
„haben“ als vorher. Lernende werden dabei<br />
als zwar hochkomplexe und entsprechend<br />
schwierig zu steuernde, nichtsdestotrotz<br />
aber programmierbare Maschinen<br />
behandelt. Mit unterschiedlichsten methodischen<br />
Arrangements wird versucht,<br />
ihr Aufnahme- und Behaltevermögen<br />
zu optimieren und sie möglichst gut mit<br />
Wissen zu „füllen“. Das Ziel besteht darin,<br />
sie für Arbeitsprozesse verwertbar zu<br />
machen und dem gesellschaftlichen Status<br />
quo anzupassen (vgl. insbesondere<br />
Freire 1973). Methodisch geschickt werden<br />
ihnen Informationen sowie Methoden<br />
zu deren instrumentellen Verarbeitung<br />
„übermittelt“, wodurch sie befähigt<br />
werden sollen, eine mehr oder weniger<br />
hohe Position im Rahmen des gegebenen<br />
ökonomisch-gesellschaftlichen Systems<br />
einzunehmen, nicht jedoch dazu, dieses<br />
hinsichtlich seiner Prämissen und Folgen<br />
zu hinterfragen. Das strukturell eingeschriebene<br />
Ziel derartigen Lernens heißt<br />
Brauchbarkeit und Nutzen – ganz sicher<br />
nicht Selbstbestimmung oder (Eigen-)<br />
Sinn. Es geht nicht darum, durch den Erwerb<br />
von Wissen den Tatsachen der Welt<br />
gegenüber mündiger zu werden. Völlig<br />
konträr zu dem ursprünglich von Francis<br />
Bacon formulierten Ausspruch lautet die<br />
sich in derart ausgerichteten Unterrichtsystemen<br />
tatsächlich verwirklichende Parole:<br />
„Ohnmacht durch Wissen“!<br />
Für das reibungslose Funktionieren der<br />
Industriegesellschaft war es erforderlich,<br />
zumindest dem Großteil der Bevölkerung<br />
eine derart entfremdete Haltung gegenüber<br />
Wissen „anzuerziehen“. Lernen<br />
als „Akt der Unterwerfung“ unter die als<br />
unhinterfragbar wahrgenommenen sogenannten<br />
„Erfordernisse“ von Gesellschaft<br />
und Arbeitswelt bildete eine ganz<br />
wesentliche sozialisatorische Grundlage<br />
der Massenloyalität gegenüber dem ökonomisch-politischen<br />
System. Indem das<br />
Bewusstsein der Menschen dahingehend<br />
geprägt wurde, sich bloß als Speichermedium<br />
und Maschine zur bewusstlosrationalen<br />
Verarbeitung von Wissen zu<br />
begreifen, diesem also nur in instrumenteller<br />
Form gegenüberzustehen, „lernten“<br />
sie auch, sich als „bewusstlose Funktionsträger“<br />
im ökonomisch-gesellschaftlichen<br />
System wahrzunehmen. Auf diese<br />
Art konnte zum einen der im modernen<br />
Industriekapitalismus rasch anwachsende<br />
Bedarf nach Arbeitskräften befriedigt<br />
werden, die in der Lage waren, Arbeitsprozesse<br />
im Sinne des aktuellen Wissensstandes<br />
fachlich qualifiziert durchzuführen.<br />
Zum anderen war es damit möglich,<br />
immer mehr Menschen zu immer höheren<br />
formalen Bildungsabschlüssen zu<br />
führen sowie die „Quellen des Wissens“<br />
weitgehend zu demokratisieren, ohne<br />
dass das nunmehr auf breiter Basis verfügbare<br />
Wissen eine subversive, systemsprengende<br />
Kraft entfaltete.<br />
Der digitale Kapitalismus erfordert<br />
eine neue Form der Zurichtung der<br />
Menschen<br />
Wie schon erwähnt, nimmt die Bedeutung<br />
des Menschen als Träger formellen<br />
Wissens ab. Die IKT machen es möglich,<br />
die für Produktion und Verwaltung<br />
erforderlichen, bisher an das „Trägermedium<br />
Mensch“ gebundenen Kenntnisse<br />
und Fertigkeiten manueller und kognitiver<br />
Art in anwachsendem Maß vom<br />
Menschen getrennt in Form von Software<br />
zu speichern und als Maschinen-Wissen<br />
abzurufen. Daraus leiten sich zwei Effekte<br />
ab: Zum einen nimmt der Bedarf an<br />
menschlichen Arbeitskräften insgesamt ab<br />
und zum anderen sehen sich die weiterhin<br />
gebrauchten Arbeitskräfte mit nachhaltig<br />
veränderten Qualifikationsanforderungen<br />
konfrontiert. Ursache dafür ist, dass<br />
die IKT den Menschen nämlich keineswegs<br />
generell ersetzen können. Tätigkeiten,<br />
die durch die „neuen“ Technologien<br />
nicht substituiert werden können und<br />
deshalb weiterhin von Menschen ausgeübt<br />
werden müssen, sind solche, die Kreativität<br />
erfordern und/oder einen starken Beziehungsaspekt<br />
beinhalten – alles in allem<br />
Tätigkeiten, bei denen sich Professionalität<br />
nicht durch das Umsetzen eingelernter<br />
Verhaltensweisen beweist, sondern darin,<br />
dass aus einer verinnerlichten Haltung<br />
heraus gehandelt wird. Für alle formalisierbaren<br />
– normbezogenen – Arbeitsaufgaben<br />
können in letzter Konsequenz<br />
IKT eingesetzt werden, d.h. für alle, die<br />
sich in Form eines mathematischen Ablaufschemas<br />
abbilden lassen. Somit müssen<br />
mit deren fortschreitender Implementierung<br />
von menschlichen Arbeitskräften<br />
zunehmend nur mehr fallbezogene Aufgaben<br />
durchgeführt werden. Darunter sind<br />
Aufgaben zu verstehen, die nicht formalisierbar<br />
sind, weil sie von Fall zu Fall ein<br />
spezifisches Vorgehen erfordern und nicht<br />
im Sinne antrainierter Routine, sondern<br />
nur auf Grundlage von besonderen sozialen<br />
und emotionalen Kompetenzen bzw.<br />
Kreativität, Intuition oder Empathie der<br />
sie Verrichtenden bewältigt werden können.<br />
Derartige Aufgaben können nicht<br />
ausgeführt werden, indem bloß getan<br />
wird, was im Rahmen einer Ausbildung<br />
erlernt wurde – hier gilt es aus einer verinnerlichten<br />
Einstellung heraus, gewissermaßen<br />
autonom zu handeln. (Anzumerken<br />
ist hier, dass auch bisher schon z.B. in<br />
Lehr-, Sozial-, Therapie- und Pflegeberufen<br />
in hohem Maße fallbezogene Arbeiten<br />
durchzuführen waren. Typischerweise<br />
werden diese Menschen auf ein<br />
besonders hohes Berufsethos verpflichtet<br />
– es wird von ihnen erwartet, dass sie die<br />
Motivation für ihren Beruf nicht primär<br />
aus der – meist sowieso eher niedrigen –<br />
Bezahlung schöpfen, sondern aus dem<br />
Wunsch, „etwas Gutes“ tun zu wollen.)<br />
Jene Tätigkeiten, die trotz der in den<br />
letzten Jahrzehnten geschaffenen technologischen<br />
Möglichkeiten auch weiterhin<br />
von Menschen durchgeführt werden<br />
müssen, enthalten einen wachsenden<br />
Anteil eines spezifischen Vermögens, das<br />
zwar sehr häufig als „Wissen“ apostrophiert<br />
wird, die im Alltagsbewusstsein<br />
bestehende Dimension dieses Begriffs tatsächlich<br />
aber weit überschreitet. „Es geht<br />
nicht mehr nur um ,know what‘, also um<br />
die Anwendung kodifizierten Faktenwissens<br />
durch die Arbeitskräfte, sondern um<br />
darüber hinausgehende Qualifikationselemente“,<br />
sogenannte „tacit skills“ (unterschwellige<br />
Fähigkeiten), verschiedentlich<br />
– eher unscharf – auch als Know how bezeichnet.<br />
Darunter lassen sich „alle Formen<br />
des impliziten und informellen bzw.<br />
des Erfahrungswissens der Arbeitskräfte<br />
wie auch ihre Fähigkeit zur Kommunikation<br />
und Kooperation im Produktionsprozess“<br />
(Atzmüller 2004: 598) subsumieren.<br />
„Gefragt sind Erfahrungswissen,<br />
Urteilsvermögen, Koordinierungs-, Selbstorganisierungs-<br />
und Verständigungsfähigkeit,<br />
also Formen lebendigen Wissens,<br />
die (…) zur Alltagskultur gehören. Die<br />
Art und Weise, wie Erwerbstätige dieses<br />
Wissen einbringen, kann weder vorbestimmt<br />
noch anbefohlen werden. Sie<br />
verlangt ein Sich-selbst-Einbringen, in<br />
der Managersprache ,Motivation‘ ge-<br />
<strong>Streifzüge</strong> N° <strong>47</strong> / Dezember 2009