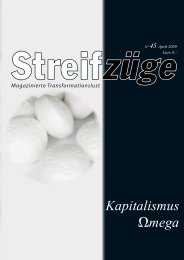streifzuege_47 Kopie - Streifzüge
streifzuege_47 Kopie - Streifzüge
streifzuege_47 Kopie - Streifzüge
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
ERICH RIBOLITS, BILDUNG HAT KEINEN WERT 37<br />
Bildung hat keinen Wert*<br />
ÜBER DEN VERLUST VON BILDUNG, SOBALD DIESER WERT ZUGESCHRIEBEN WIRD<br />
von Erich Ribolits<br />
* Auszug aus dem Buch von Erich Ribolits:<br />
Bildung ohne Wert – Wider die Humankapitalisierung<br />
des Menschen, Löcker-Verlag,<br />
Wien 2009, 200 Seiten, ca. 20 Euro.<br />
Spätestens nachdem am „Gipfel von<br />
Lissabon“ im Jahre 2000 durch die<br />
Europäischen Bildungsminister deklariert<br />
worden war, die Europäische Union zum<br />
„wettbewerbsfähigsten und dynamischsten<br />
wissensbasierten Wirtschaftsraum der<br />
Welt“ machen zu wollen, ist der Begriff<br />
„Wissensgesellschaft“ zum fixen Bestandteil<br />
von Festreden, Forschungsprogrammen<br />
und bildungspolitischen Absichtserklärungen<br />
geworden. Der Begriff, dessen<br />
Wurzeln bis in die 1960er Jahren zurückreichen,<br />
dient dabei als Kürzel, um einen<br />
seit mehreren Jahrzehnten konstatierten,<br />
grundsätzlichen Wandel der gesellschaftlichen<br />
und ökonomischen Bedeutung<br />
von Wissen zu argumentieren – einen<br />
Wandel, dem verschiedentlich eine gleichermaßen<br />
tiefgreifende Wirkung wie<br />
dem Übergang von der Agrar- zur Industriegesellschaft<br />
zugesprochen wird (vgl.<br />
Miegel 2001: 203). Das Kürzel „Wissensgesellschaft“<br />
wird dabei in zwei unterschiedlichen<br />
Bedeutungen verwendet:<br />
einerseits als Metapher, um aktuell stattfindende<br />
gesellschaftliche Veränderungsprozesse<br />
zu charakterisieren, andererseits<br />
aber auch, um diese zu legitimieren und<br />
zu beschleunigen. Zum einen wird mit<br />
dem Begriff die in den letzten Jahrzehnten<br />
vor sich gegangene Durchdringung<br />
sämtlicher Lebensbereiche mit Informations-<br />
und Kommunikationstechnologien<br />
(IKT) angesprochen, die tiefgreifende<br />
Veränderungen der kognitiven Tätigkeiten<br />
von Menschen sowie eine anwachsende<br />
Nachfrage nach wissens- und<br />
kommunikationsbasierten Dienstleistungen<br />
nach sich gezogen haben. Zum anderen<br />
dient der Begriff aber auch als Warnung<br />
und Appell: Er soll die Behauptung<br />
untermauern, dass die verwertbaren<br />
Kompetenzen der arbeitsfähigen Bevölkerung<br />
von Regionen und Staaten zunehmend<br />
die wichtigste Ressource der<br />
lokalen wirtschaftlichen Entwicklung<br />
darstellen und es somit erforderlich sei,<br />
ein konsequent an den Verwertungsvorgaben<br />
ausgerichtetes Lernen potenzieller<br />
Arbeitskräfte in allen Lebensbereichen<br />
und -altern zu forcieren.<br />
Beim angesprochenen Hochloben von<br />
Wissen zur entscheidenden Größe im allgemeinen<br />
Konkurrenzkampf wird nur<br />
selten reflektiert, dass die Bezugnahme<br />
auf die Größe „Wissen“ für die aktuelle<br />
Entwicklung tatsächlich wesentlich zu<br />
kurz greift und das Spezifische der derzeit<br />
stattfindenden Veränderung auch<br />
keineswegs schlüssig erklärt. Bei dem<br />
unter dem Titel Wissensgesellschaft firmierenden<br />
Paradigmenwechsel geht es<br />
nämlich durchaus nicht nur um einen<br />
bloßen Bedeutungsgewinn des Qualifikationsniveaus<br />
der Erwerbsbevölkerung<br />
in dem Sinn, dass möglichst viele Menschen<br />
im (Aus-)Bildungssystem möglichst<br />
hohe formale Abschlüsse erwerben,<br />
um das dabei erworbene Wissen in den<br />
wirtschaftlichen Verwertungsprozess einbringen<br />
zu können. Es stellt ja auch keine<br />
echte Neuigkeit dar, dass das Know<br />
how, auf das in einer Gesellschaft zugegriffen<br />
werden kann, einen engen Bezug<br />
zu Produktivität und Produktivitätssteigerung<br />
hat. Wissen war unzweifelhaft<br />
auch schon bisher wesentlicher Einflussfaktor<br />
der wirtschaftlichen Entwicklung.<br />
Dass dem so ist, lässt sich nicht zuletzt an<br />
der dramatischen Krise zeigen, von der<br />
das kapitalistische Gesellschaftssystem aktuell<br />
heimgesucht wird. Die Ursache der<br />
abnehmenden Fähigkeit des postindustriellen<br />
Kapitalismus, menschliche Arbeitskraft<br />
zu vernutzen, ist ja nirgendwo<br />
anders zu suchen, als in den in den<br />
letzten Jahrzehnten auf Grundlage wissenschaftlicher<br />
Fortschritte geschaffenen<br />
„neuen“ Technologien und deren Rationalisierungspotential.<br />
Dass Waren heute<br />
immer rationeller – in immer kürzerer<br />
Zeit, durch immer weniger Arbeitskräfte<br />
– hergestellt werden können, deshalb aber<br />
immer mehr Menschen „freigesetzt“ werden<br />
und sich im aktuellen gesellschaftlichen<br />
System den Konsum der massenhaft<br />
und immer rationeller herstellbaren<br />
Waren nicht mehr leisten können, hängt<br />
letztendlich mit wissenschaftlichen Erkenntnissen<br />
sowie deren massenhafter<br />
Verbreitung und Umsetzung zusammen.<br />
Nicht ein Mangel an Wissen, sondern die<br />
durch das Konkurrenzdiktat der marktgesteuerten<br />
Ökonomie gepushten Fortschritte<br />
im wissenschaftlich-technischen<br />
Wissen lassen das politisch-ökonomische<br />
System Kapitalismus zunehmend an seine<br />
Grenzen stoßen!<br />
Ohne spezifische Formen des Generierens<br />
und Weitergebens von Wissen ist<br />
wohl noch keine Gesellschaftsformation<br />
ausgekommen. Seit Menschen Gemeinschaften<br />
bilden, organisierten sie dabei<br />
auch Wissen, wobei sich dessen Qualität<br />
im Laufe der Geschichte selbstverständlich<br />
durchaus verändert hat. Seit der<br />
„Freisetzung der Konkurrenz“ im Rahmen<br />
der kapitalistischen Ökonomie stellt<br />
die Verfügung über Wissen und das systematische<br />
Weiterentwickeln verwertungsrelevanten<br />
Wissens zum Zweck der Profitmaximierung<br />
einen ganz wesentlichen<br />
Faktor der gesellschaftlichen Dynamik<br />
dar. Die diesbezügliche Verwertung von<br />
Wissen war somit von allem Anfang an<br />
ein bestimmendes Element der Industriegesellschaft<br />
gewesen; es mag deshalb erstaunen,<br />
dass erst jetzt, in einer weit fortgeschrittenen<br />
Phase des Kapitalismus, der<br />
Begriff Wissensgesellschaft geboren wurde<br />
und zu derartiger Bedeutung gelangte.<br />
Tatsächlich ist die Ursache dafür aber auch<br />
nicht bloß in einer aktuell vor sich gehenden<br />
Intensivierung der Kapitalisierung<br />
von Wissen zu suchen, sondern darin,<br />
dass diese – in ihrer traditionellen Form –<br />
gegenwärtig an Grenzen stößt und es im<br />
Zusammenhang damit erforderlich wird,<br />
völlig neue Dimensionen von Wissen der<br />
Verwertung zugänglich zu machen. Konkret<br />
geht es darum, dass der Fokus der<br />
Verwertung bisher primär auf formalisiertem<br />
Wissen gelegen ist, dieses aber<br />
heute zunehmend von seinen menschlichen<br />
Trägern losgelöst in Form von Software<br />
verfügbar ist. Die Folge ist, dass die<br />
systematische Aneignung von Wissen in<br />
organisierten Lernprozessen und seine instrumentelle<br />
Verwendung zunehmend an<br />
Bedeutung verliert, es im Gegenzug aber<br />
notwendig wird, dass Menschen lernen,<br />
mit Wissen in einer völlig veränderten<br />
Form umzugehen.<br />
Wissen wird ja auf zwei gänzlich unterschiedlichen<br />
Wegen erworben bzw.<br />
stehen Individuen dem von ihnen erwor-<br />
<strong>Streifzüge</strong> N° <strong>47</strong> / Dezember 2009