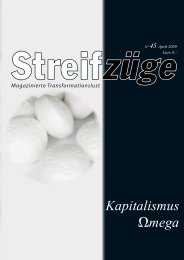streifzuege_47 Kopie - Streifzüge
streifzuege_47 Kopie - Streifzüge
streifzuege_47 Kopie - Streifzüge
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
NICOLETTA WOJTERA, HINTERWIRKLICHKEITEN 29<br />
zen unter lauter ruhigen, sesshaften Dingen<br />
(…). Zu sitzen (…) und ein Dichter<br />
zu sein. Und zu denken, dass ich auch so<br />
ein Dichter geworden wäre, wenn ich irgendwo<br />
hätte wohnen dürfen, irgendwo<br />
auf der Welt, in einem von den vielen<br />
verschlossenen Landhäusern, um die sich<br />
niemand bekümmert. Ich hätte ein einziges<br />
Zimmer gebraucht (…). Aber es ist<br />
anders gekommen (…). Meine alten Möbel<br />
faulen in der Scheune.“<br />
Rilke betont das Wohnen im Gegensatz<br />
zum „Leben“, und er nimmt damit<br />
eine Unterscheidung vorweg, die Judith<br />
Hermanns Erzählung „Hunter-Tompson-<br />
Musik“ als Lebenswirklichkeit am Ende<br />
des 20. Jahrhunderts beschreiben wird.<br />
Für Heidegger ist das „Verhältnis von<br />
Mensch und Raum (…) nichts anderes als<br />
das wesentlich gedachte Wohnen“, dessen<br />
Komplexität sich in der Literatur manifestiert.<br />
Mit Blick auf Hölderlin stellt<br />
Heidegger fest: „Das Dichten erbaut das<br />
Wesen des Wohnens. Dichten und Wohnen<br />
schließen sich nicht nur nicht aus.<br />
Dichten und Wohnen gehören vielmehr,<br />
wechselweise einander fordernd, zusammen.<br />
(…) Das Dichten ist das Grundvermögen<br />
des menschlichen Wohnens.“<br />
Gedanken zur modernen Literarizität<br />
von Wohnen<br />
Destruktion, Provokation, Hohn und<br />
Widerspruch – der Impetus der Moderne<br />
ist die Dekonstruktion überlieferter Formen,<br />
das Brechen mit herkömmlichen<br />
Darstellungsverfahren. Dennoch sind<br />
wir möglicherweise „nie modern gewesen“,<br />
denn die systemische und für die<br />
menschliche Existenz produktiv gemachte<br />
Korrelation von Natur, Technik und<br />
Mensch wird innerhalb der herrschenden<br />
lebensweltlichen Wirklichkeit(en) nicht<br />
erreicht. Aber vielleicht lässt sich gerade<br />
diese Diskordanz in der Interferenz<br />
von Literatur, Literarizität und Wohnen<br />
aufzeigen.<br />
Das Wohnen als Existenzparameter<br />
wird in der Literatur der Moderne zum<br />
Hybrid, zum „Quasi-Objekt“ zwischen<br />
dem essenziellen Erfordernis des „Sich-<br />
Behagens“ und einer dem Menschen äußerlichen<br />
existenziellen Mobilität, die<br />
zu seiner „Unbehaustheit“ (Holthusen,<br />
1951) führt und in der kumulativen Ruhelosigkeit<br />
der Existenz bei Botho Strauß<br />
und Judith Hermann qua Selbstaufhebung<br />
endet.<br />
Nicht lange nach Heideggers „Wohnen<br />
des Menschen“ diagnostiziert Lyotard die<br />
„Verschiebung im Raum“ als qualitative<br />
Modifikation der Existenz. Der Nietzscheanische<br />
Dualismus von Subjekt und<br />
Objekt potenziert sich in der „universellen<br />
Mobilmachung“ (Lyotard, 1989), und<br />
die Grimm’sche Definition des „sich an<br />
einer Stelle wohl befinden“ wird zu einem<br />
flüchtigen Anwesend-Sein.<br />
Wohnen berührt die Existenz, das Sein<br />
und ein „Sichzusichverhalten als Daseinsstruktur“<br />
(Biella, 1998). Ausdrucksform<br />
und Medium dieses Sichzusichverhaltens<br />
kann die Literatur sein, ihre (Un-)Tiefen<br />
und Grenzwerte als mögliche Poetologie<br />
der menschlichen soziokulturellen Existenz.<br />
Denn am Ende unserer Betrachtungen<br />
steht eine schlichte Antwort auf die<br />
Frage „Weshalb Sie hier leben? – Weil ich<br />
fortgehen kann. Jeden Tag, jeden Morgen<br />
meinen Koffer packen, die Tür hinter<br />
mir zuziehen, gehen.“ (Judith Hermann,<br />
Hunter-Tompson-Musik).<br />
Entlang dieser Skizzen und Gedanken<br />
liegt ein literarischer Spannungsbogen,<br />
den wir verfolgen können und der<br />
uns zeigen mag, ob die Literatur und die<br />
Metaphorik des Wohnens für das Projekt<br />
der (Post-)Moderne eine eigene ästhetische<br />
Projektionsfläche bildet.<br />
III. Rilke, Hofmannsthal, Kafka,<br />
Perec, Strauß, Hermann…<br />
Was passiert zwischen Rainer Maria Rilkes<br />
„Malte Laurids Brigge“ und Judith Hermanns<br />
„Hunter-Tompson-Musik“? Was<br />
liegt auf diesem knapp ein Jahrhundert<br />
umfassenden Spannungsbogen, dass sich<br />
die beiden literarischen Entwürfe am Ende<br />
im „Asyl“ treffen? Zwei gleichsam „Moderne“<br />
exemplifizieren die Frage des Daseins<br />
im „Raum“ entlang einer Wohnstatt:<br />
„Es war im Plan nicht zu finden, aber über<br />
der Tür stand noch ziemlich leserlich: Asyl<br />
de nuit.“ – „Es ist ein Asyl, ein Armenhaus<br />
für alte Leute, eine letzte verrottete Station<br />
vor dem Ende, ein Geisterhaus.“ – „Neben<br />
dem Eingang waren die Preise. Ich habe sie<br />
gelesen. Es war nicht teuer.“<br />
Hans Egon Holthusen lässt den Beginn<br />
der Moderne und die Existenz des „unbehausten<br />
Menschen“ mit Blick auf Rilke<br />
einsetzen: „1910 also. Es war das Jahr, in<br />
dem die ,Aufzeichnungen des Malte Laurids<br />
Brigge‘ erschienen, das Pariser Tagebuch<br />
eines jungen Menschen, der von sich<br />
sagte, dass ,dieses so ins Bodenlose gehängte<br />
Leben eigentlich unmöglich sei‘“.<br />
Das „Pariser Tagebuch“ ist das Tagebuch<br />
eines Unbehausten im Wortsinn;<br />
Rilkes Malte Laurids Brigge sucht<br />
nach der Wohnstatt, nach der räumlichen<br />
„Ver-Ortung“ (s)einer Existenz.<br />
Diese Suche ist eine Suche in der Interferenz<br />
der Subjekt-Objekt-Relation,<br />
für die Nietzsche das ästhetische<br />
Verhalten als die einzig denkbare Lebenswirklichkeit<br />
definiert hatte. Und in<br />
der brachialen Erkenntnis des Subjektes<br />
zwischen der Dichotomie der Dinge<br />
setzt Rilke ein mit der unrevidierbaren<br />
Form von Leben – mit dem Tod –, indem<br />
er feststellt: „So, also hierher kommen<br />
die Leute, um zu leben, ich würde<br />
eher meinen, es stürbe sich hier. (…)<br />
Ich habe einen Menschen gesehen, welcher<br />
schwankte und umsank. Die Leute<br />
versammelten sich um ihn, das ersparte<br />
mir den Rest.“ Dieser Unmittelbarkeit<br />
des Todes korrespondiert eine spezifische<br />
Ambivalenz, denn – „Die Hauptsache<br />
war, dass man lebte. Das war die<br />
Hauptsache.“<br />
Die Polarität der Sphären, ihre Überlagerung<br />
in der Feststellung eines gelebten<br />
Todes wird lanciert von einer äußeren<br />
Dynamik, die die innere Lebenswelt<br />
unmittelbar erfasst und in der Wohnsituation<br />
kumuliert, wenn Malte im Tagebuch<br />
festhält: „Elektrische Bahnen rasen<br />
läutend durch meine Stube. Automobile<br />
gehen über mich hin.“<br />
Das Pariser Tagebuch lässt die Amplituden<br />
der Moderne ausschlagen, und<br />
die Perspektive der eigenen Wohnsituation<br />
bestimmt ihre Frequenz in der Frage<br />
Maltes „Was für ein Leben ist das eigentlich:<br />
ohne Haus, ohne ererbte Dinge,<br />
ohne Hunde. Hätte man doch wenigstens<br />
seine Erinnerungen. Aber wer hat die?“<br />
Zuhause sein, bei sich sein, sich behagen<br />
– wir erinnern uns an die Definition<br />
des Grimm’schen Wörterbuches.<br />
Rilke differenziert die semantische Zuordnung:<br />
Die Kohärenz von Wohnen<br />
und Leben wird perspektivisch variiert<br />
und erweitert, indem der Wohn-Raum<br />
der Bücher, die Nationalbibliothek in Paris,<br />
als Lebens-Raum apostrophiert wird,<br />
bei dem man „eine besondere Karte haben<br />
(muss), um in diesen Saal eintreten<br />
zu können. (…) und dann bin ich zwischen<br />
diesen Büchern, bin euch weggenommen,<br />
als ob ich gestorben wäre, und<br />
sitze und lese einen Dichter.“<br />
Rilke kontrastiert den von Kondylis<br />
bezeichneten „Niedergang der bürgerlichen<br />
Denk- und Lebensform“ in der Kohäsion<br />
des Wohnens und der offengelegten<br />
Fassade der modernen Existenz. Er<br />
formuliert den einsetzenden Niedergang<br />
äußerer Harmoniestrukturen in Parallele<br />
zu einer unaufhaltsamen Dynamik der<br />
Existenz: „Denn das ist das Schreckliche<br />
(…): es ist zu Hause in mir.“<br />
Auf dieser Projektionsfläche schließlich<br />
geschieht im zweiten Teil der „Auf-<br />
LIVING ROOM<br />
<strong>Streifzüge</strong> N° <strong>47</strong> / Dezember 2009