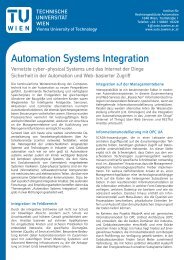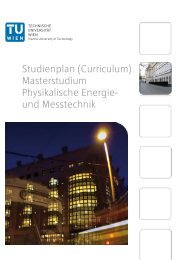frei.haus Druckversion - Technische Universität Wien
frei.haus Druckversion - Technische Universität Wien
frei.haus Druckversion - Technische Universität Wien
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
TU|<strong>frei</strong>.<strong>haus</strong> – <strong>Druckversion</strong> der Ausgabe Nr. 27 (Juni 2013)<br />
Wie auf rohen Eiern<br />
Nature Schwerpunkt: Women´s Work<br />
Brigitte Ratzer<br />
(Koordinationsstelle für Frauenförderung und Gender Studies)<br />
In der Ausgabe März 2013 widmet sich die interdisziplinäre Fachzeitschrift "Nature" (Nature<br />
495, 7 March 2013) der Frage: "Women´s Work. Why is science still institutionally sexist?"<br />
Ein guter Anlass, einige Erkenntnisse daraus zusammenzufassen, betreffen sie doch<br />
Fragen, die an der TU <strong>Wien</strong> immer wieder diskutiert werden. Sehr bemerkenswert ist der<br />
Beitrag der Neurobiologin Jennifer Raymond mit dem Titel "Most of us are biased". Sie<br />
beginnt mit dem "Geständnis", dass auch sie einen Gender-Bias hat, also eine - wenn auch<br />
unbewusste - Bevorzugung von Männern gegenüber Frauen in der Wissenschaft zeigt.<br />
Dabei bezieht sie sich auf einen von der <strong>Universität</strong> Harvard zur Verfügung gestellten Online-<br />
Test über implizite Vorurteile (Implicit Associations). Die österreichische Version des Tests<br />
und die Ergebnisse tausender österreichischer Testpersonen sind online abrufbar. Jennifer<br />
Raymond folgert, dass ein Bewusstsein darüber, dass Männer wie Frauen – also im<br />
Zweifelsfall wir alle - diese Vorurteile haben, der wichtigste Schritt zu einem veränderten<br />
Umgang damit ist. Davon ausgehend gibt sie eine Reihe von Empfehlungen, welche<br />
konkreten Maßnahmen gesetzt werden können – wie etwa gender-blind review Verfahren,<br />
anonymisierte Aufnahmeverfahren, bewusste und gezielte Unterstützung von<br />
Wissenschaftlerinnen.<br />
Für die TU <strong>Wien</strong> interessant: Die in der von<br />
Prof.in Sabine Köszegi durchgeführten<br />
Studie "Leaky-Pipeline" gefundenen Zahlen<br />
und Effekte (wie z.B. implizite Vorurteile)<br />
sind kein <strong>haus</strong>gemachtes Phänomen,<br />
sondern finden sich in derselben Form in<br />
den meisten industrialisierten Ländern. Eine<br />
Fülle von Daten und Fakten zeigen etwa im<br />
Beitrag "Mind the Gender Gap" (Helen Shen,<br />
Nature 495, Seite 22–24), wie der Anteil der<br />
Frauen über die Hierarchiestufen beständig<br />
abnimmt. Auch Bezahlung und Drittmittel sind an den <strong>Universität</strong>en ungleich verteilt. Neben<br />
vorwiegend US-amerikanischen Daten liefert Helen Shen auch eine Reihe von Beispielen<br />
aus verschiedenen europäischen Staaten, mit welchen Maßnahmen auf diese Problematik<br />
reagiert wird.<br />
Überraschend ist der Schwerpunkt, den Liisa Husu in ihrem Kurzbeitrag in der Serie<br />
"Scientists of the world speak up for equality" setzt. Nicht offene Diskriminierung oder<br />
herabsetzende Bemerkungen hindern Frauen in erster Linie an einer wissenschaftlichen<br />
Karriere, sondern vielmehr jene Dinge, die nicht geschehen – Husu nennt sie "non-events".<br />
Sie streicht heraus, was es bedeutet nicht gesehen, gehört, unterstützt, ermutigt, in Betracht<br />
gezogen, eingeladen, willkommen geheißen zu werden. Husu verweist darauf, wie schwierig<br />
es für einzelne Wissenschaftlerinnen ist, non-events überhaupt zu erkennen, geschweige<br />
denn, darauf zu reagieren. Es ist ja eben nichts passiert, also warum die Aufregung? (Nature<br />
495, Seite 35–38)<br />
35