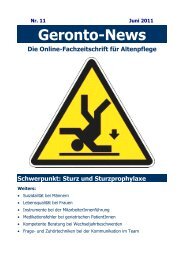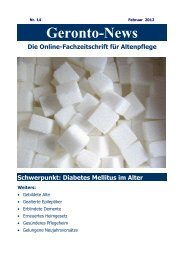Nr. 09 November 2010 Geronto-News Die Online-Fachzeitschrift für
Nr. 09 November 2010 Geronto-News Die Online-Fachzeitschrift für
Nr. 09 November 2010 Geronto-News Die Online-Fachzeitschrift für
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Charakteristikum einer tragbaren Beziehung<br />
zwischen Coach/in und Coachee ist Vertrauen.<br />
Einen entscheidenden Beitrag zum Aufbau von<br />
Vertrauen leistet vor allem eine breite Lebens-<br />
und Berufserfahrung. Ein/e selbsterfahrene/r<br />
Coach/in wird <strong>für</strong> sich auch schnell erkennen,<br />
<strong>für</strong> welchen Auftrag die eigene Erfahrung ausreicht<br />
und <strong>für</strong> welchen Auftrag nicht.<br />
Auch das Hinterfragen des eigenen Zuständigkeitsbereichs<br />
gehört dazu. Psychische und<br />
physische Erkrankungen sowie schwere Suchtprobleme<br />
gehören nicht in das Tätigkeitsfeld<br />
des Coachs oder der Coachin. In diesen Fällen<br />
werden seriöse Anbieter/innen das Erbringen<br />
der <strong>Die</strong>nstleistung ablehnen und das Aufsuchen<br />
von Spezialist/innen empfehlen. Weiters<br />
sollten Coachs über positive persönliche Ausstrahlung<br />
und einen angemessenen Interaktions-<br />
und Kommunikationsstil verfügen.<br />
Zu den fachlichen Anforderungen gehört eine<br />
passende Feldkompetenz, die dem Coach/der<br />
Coachin hilft die Besonderheiten der Berufswelt<br />
der Coachees zu verstehen. Kenntnisse in<br />
Bezug auf die Organisation, in die die KlientInnen<br />
eingebettet sind, sind im Coaching-<br />
Prozess an vielen Stellen hilfreich. Einem Coach<br />
und einer Coachin aus einem fachnahen<br />
Berufsfeld oder zumindest einem oder einer<br />
mit der Branche eng vertrauten, wird Feldkompetenz<br />
zugestanden. Der Aufbau von Vertrauen<br />
wird dadurch erleichtert.<br />
Interne/r oder Externe/r Coach/in?<br />
Organisationsinterne Coachs gehören in der<br />
Regel der Personalentwicklungsabteilung an.<br />
<strong>Die</strong>se werden jedoch meist nur von großen<br />
Unternehmen beschäftigt, die den Nutzen<br />
dieser Personalentwicklungsmaßnahme erkannt<br />
haben und die da<strong>für</strong> benötigten finanziellen<br />
Mittel zur Verfügung haben. Selbstverständlich<br />
muss auch ein/e organisationsinterne/r<br />
Coach/in die beschriebenen fachlichen<br />
und persönlichen Anforderungen erfüllen. Der<br />
größte Vorteil liegt hier sicherlich in dem vorhandenen<br />
Wissen über die Organisation.<br />
Wenn diese/r auch in keine weitere Führungsaufgabe<br />
eingebunden ist, kann er/sie als unabhängige/r<br />
und neutrale/r Coach/in über<br />
einen Vertrauensvorschuss verfügen. In der<br />
Eingebundenheit ins Unternehmen und der<br />
Kenntnisse über das Unternehmen liegt jedoch<br />
auch gleichzeitig der größte Nachteil.<br />
Der Begriff Betriebsblindheit umschreibt diesen<br />
Sachverhalt sehr treffend.<br />
25<br />
Auch sieht sich der/die organisationsinterne/r<br />
Coach/in häufig mit unterschiedlichen Erwartungen<br />
der Führungskräfte und Mitarbeiter/<br />
innen konfrontiert. Es ist fast unmöglich, die<br />
in einem MitarbeiterInnen-Coaching gesammelten<br />
Erkenntnisse zu neutralisieren um sich<br />
völlig offen in ein anschließendes Führungskräfte-Coaching<br />
zu begeben. <strong>Die</strong> Gefahr der<br />
Parteinahme <strong>für</strong> eine Führungskraft oder eine<br />
Mitarbeiter/in besteht in diesem Fall immer.<br />
Ein/e organisationsexterne/r Coach/in ist freiberuflich<br />
oder selbständig tätig. <strong>Die</strong>s hat den<br />
Vorteil, dass er oder sie kein fest angestelltes<br />
Organisationsmitglied ist und nur <strong>für</strong> einen<br />
begrenzten Zeitraum „Hilfe zur Selbsthilfe“<br />
leistet. Damit unterliegen sie nur wenigen<br />
Zwängen in der Organisation, werden eher als<br />
neutrale Partner/innen betrachtet und sind<br />
nicht „betriebsblind“. Bezüglich der Auswahl<br />
von externen Coachs/ Coachinnen ist die genaue<br />
Prüfung der Qualifikation unabdingbare<br />
Voraussetzung <strong>für</strong> den Erfolg der Intervention.<br />
<strong>Die</strong> Führungskraft als Coach/in<br />
Erfolgreiche Führungskräfte führen flexibel.<br />
Das heißt, dass sie situationsabhängig einzelne<br />
Führungsstile verwenden. Damit kann eine<br />
Führungskraft in ausgewählten Situationen<br />
durchaus zum/ zur Coachin werden. Ihr<br />
Hauptkennzeichen ist die große Flexibilität.<br />
In der Rolle des/der Coach/in muss er/sie sich<br />
zurücknehmen und dem Gegenüber die volle<br />
und ehrliche Aufmerksamkeit durch aktives<br />
Zuhören und geschickte Fragen, schenken<br />
können. Eine große Gefahr besteht darin, dass<br />
eine coachende Führungskraft es nicht<br />
schafft, sich mit der gebührenden Neutralität<br />
dem Coachee zu widmen. <strong>Die</strong> Einbindung in<br />
das Unternehmen, das Unterliegen auferlegter<br />
Zwänge sowie persönliche Interessen und<br />
selbstverständlich die eigene Betriebsblindheit<br />
können den Coaching-Prozess stören.<br />
Der Hauptvorteil einer coachenden Führungskraft<br />
besteht darin, dass in vielen Fällen<br />
der kostenintensive Einsatz eines Coachs oder<br />
einer Coachin erspart bleibt und mitunter ein<br />
Vertrauensverhältnis bereits existiert und nicht<br />
erst mühsam aufgebaut werden muss. In Anbetracht<br />
dessen, dass eine coachende Führungskraft<br />
bei weitem nicht alle potenziellen<br />
Coaching-Themen bearbeiten kann, ist es sicherlich<br />
kritisch zu betrachten, wenn Coachings<br />
aus Kostengründen nur noch durch die<br />
Führungskräfte durchgeführt werden sollen.