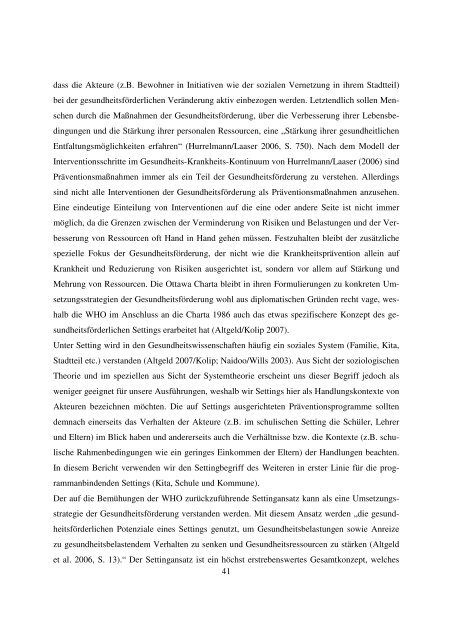- Seite 1 und 2: UNIVERSITÄT BIELEFELD FAKULTÄT F
- Seite 3 und 4: Inhaltsverzeichnis Einführung Die
- Seite 5 und 6: Inhaltsverzeichnis Teilprojekt B Ev
- Seite 7 und 8: 2.3.2 Programmreichweite auf Settin
- Seite 9 und 10: (Einführung) Die Bielefelder Evalu
- Seite 11 und 12: Abbildungs- und Tabellenverzeichnis
- Seite 13 und 14: heitsförderung verstanden werden k
- Seite 15 und 16: Settingbegriffs (Kapitel 3). In Kap
- Seite 17 und 18: kämpfung gesundheitlicher Ungleich
- Seite 19 und 20: lich sind die Eltern am stärksten
- Seite 21 und 22: Ansatzpunkt familiale Ressourcen Na
- Seite 23 und 24: Geschwistern vermitteln, all dies h
- Seite 25 und 26: dungsnotstand“, “Humankapital
- Seite 27 und 28: Elternrolle als persönlichkeitsbil
- Seite 29 und 30: 1.4 Implikationen für die zukünft
- Seite 31 und 32: an sie heran. Nachfolgend werden di
- Seite 33 und 34: lich sind gezielte Strategien der G
- Seite 35 und 36: ligter Gruppen ernähren sich schle
- Seite 37 und 38: wieder nachweisen, dass diese Regel
- Seite 39 und 40: Im Projekt BEEP werden beide Strate
- Seite 41 und 42: die GKV fest, dass Frauen besser du
- Seite 43 und 44: eine förderliche Entwicklung von J
- Seite 45 und 46: So können Eltern aus verschiedenen
- Seite 47 und 48: 5. Während die U1 bis U6 fast von
- Seite 49: warum Menschen trotz Risiken und al
- Seite 53 und 54: Jugendliche, Männer im Schichtdien
- Seite 55 und 56: 4. Forschungsfragen und Schwerpunkt
- Seite 57 und 58: Eltern, z.B. … Subjektiver Bedarf
- Seite 59 und 60: 4.3 Die BEEP Teilprojekte A, B und
- Seite 61 und 62: gesundheitliche Themen zum Ziel, du
- Seite 63 und 64: BMFSFJ [Bundesministerium für Fami
- Seite 65 und 66: Holodynski M, Stallmann F & Seeger
- Seite 67 und 68: Robert Koch-Institut (2008a): Migra
- Seite 69 und 70: (Teilprojekt A) Susanne Hartung, El
- Seite 71 und 72: Abbildungsverzeichnis Abb. A 1 Abb.
- Seite 73 und 74: Abb. A 31 Einzelitem „Belohnung v
- Seite 75 und 76: Abb. A 59 durchschnittliche Kontakt
- Seite 77 und 78: Einleitung: Elternarbeit und Lions
- Seite 79 und 80: einer Zusammenfassung der Ausführu
- Seite 81 und 82: stellt einen wichtigen Ansatzpunkt
- Seite 83 und 84: Der Erfolg schulischer Elternarbeit
- Seite 85 und 86: Bereich der Erwachsenenbildung (vgl
- Seite 87 und 88: 3. Inwieweit lässt sich Erziehungs
- Seite 89 und 90: Gymnasium 10 38% 521 49% Gesamt 26
- Seite 91 und 92: - Die äußere Gestaltung („Layou
- Seite 93 und 94: allein Entscheidungen zu treffen. -
- Seite 95 und 96: 2. Die wissenschaftliche Begleitfor
- Seite 97 und 98: Elternheft Elternbriefe keine Kennt
- Seite 99 und 100: Kenntnis und Lektüre nach sozialde
- Seite 101 und 102:
Ohne Schulabschluss Volks-/ Hauptsc
- Seite 103 und 104:
2.2 Akzeptanzanalyse Für eine weit
- Seite 105 und 106:
(29%) und die Kindersicht zu wenig
- Seite 107 und 108:
Elternbrief ist übersichtlich Elte
- Seite 109 und 110:
tergrund, ressourcenschwache oder s
- Seite 111 und 112:
ental Stress Indexes noch für die
- Seite 113 und 114:
Items der 1. Welle Faktorenladungen
- Seite 115 und 116:
ohne Schulabschluss punitiv-restrik
- Seite 117 und 118:
2.4 Wirksamkeitsanalyse Die anschli
- Seite 119 und 120:
allen Elterngruppen das mittlerweil
- Seite 121 und 122:
Ich zweifele daran, ob es mir tats
- Seite 123 und 124:
sind zumindest mittelfristig stabil
- Seite 125 und 126:
läufe über die drei Messzeitpunkt
- Seite 127 und 128:
Hier ist nun spannend, inwieweit si
- Seite 129 und 130:
oder zu den Elternbriefen dargestel
- Seite 131 und 132:
LQ-Unterricht und Elternheftkenntni
- Seite 133 und 134:
Schulform des Kindes: Eltern von Gy
- Seite 135 und 136:
ten Erziehungssituation. Zudem ist
- Seite 137 und 138:
die mit der dritten Welle begonnene
- Seite 139 und 140:
trauens, also das Vertrauen in ande
- Seite 141 und 142:
Gesundheitsförderung und Präventi
- Seite 143 und 144:
ieflich, telefonisch oder per Inter
- Seite 145 und 146:
Gründe für die Beteiligung bzw. d
- Seite 147 und 148:
wurden. Der daraufhin veränderte L
- Seite 149 und 150:
der Eltern in den Mittelpunkt stell
- Seite 151 und 152:
100% 80% 60% 40% 47,7% 38,9% 64,9%
- Seite 153 und 154:
100% 80% 60% 40% 45,4% 49,3% 20% 0%
- Seite 155 und 156:
100% 90% 80% 78,4% 70% 60% 50% 47,1
- Seite 157 und 158:
Zeugniss e HS GY 12,7% 38,0% 39,8%
- Seite 159 und 160:
Während Hauptschuleltern also eher
- Seite 161 und 162:
nicht noch einmal aufgeführt. Insg
- Seite 163 und 164:
ihres Kindes nur manchmal, selten o
- Seite 165 und 166:
manchmal/selten/nie Teilnahme am El
- Seite 167 und 168:
hervor. Neben der bereits angesproc
- Seite 169 und 170:
Kindes einmischen. Schulbezogene Si
- Seite 171 und 172:
Interesse bildungsferner Eltern an
- Seite 173 und 174:
score steht hier für die höchste
- Seite 175 und 176:
Wie der Kontakt untereinander und d
- Seite 177 und 178:
Die Richtung des Zusammenhangs wied
- Seite 179 und 180:
terhalten und diese Treffen Freizei
- Seite 181 und 182:
eine lange Freundschaft mit einer N
- Seite 183 und 184:
sel auf höhere Schulformen sehr vi
- Seite 185 und 186:
elterlichen Sozialkapital Kann die
- Seite 187 und 188:
höchster familiärer Schulabschlus
- Seite 189 und 190:
dieser Stelle zunächst das vorhand
- Seite 191 und 192:
Meine Mitmenschen kümmern sich in
- Seite 193 und 194:
Die Abbildungen A 64 und A 65 zeige
- Seite 195 und 196:
Komponenten sind genauso die über
- Seite 197 und 198:
ohne Schulabschluss, Volks- oder
- Seite 199 und 200:
Um das bisher gewonnene Bild weiter
- Seite 201 und 202:
3.5 Zusammenfassung Angesichts der
- Seite 203 und 204:
Zu bedenken ist dabei vor allem der
- Seite 205 und 206:
den qualitativen und quantitativen
- Seite 207 und 208:
scher Gesundheitsförderung kann nu
- Seite 209 und 210:
empfinden die Materialien auch als
- Seite 211 und 212:
dieser Informationen in die Elternm
- Seite 213 und 214:
pädagogischen Personal geht, auf d
- Seite 215 und 216:
kaum aus und die 10 Minuten Sprechz
- Seite 217 und 218:
Literaturverzeichnis Teilprojekt A
- Seite 219 und 220:
Kluwe S & Marzinzik K (2006): Evalu
- Seite 221 und 222:
(Teilprojekt B) Sabine Kluwe / Eva
- Seite 223 und 224:
Abbildungsverzeichnis Abb. B 1 Anal
- Seite 225 und 226:
Abb. B 51 „Mutter/Vater zu sein,
- Seite 227 und 228:
Tabellenverzeichnis Tab. B 1 In die
- Seite 229 und 230:
1.1 Gesundheitsförderliche Wirkung
- Seite 231 und 232:
schenken. Insbesondere gilt dies, w
- Seite 233 und 234:
Kühn 2005). Als Erziehungsziele we
- Seite 235 und 236:
Die STEP Kursleiterinnen und Kursle
- Seite 237 und 238:
ildungsfernen Bevölkerungsschichte
- Seite 239 und 240:
tings möglichst allgemeingültig z
- Seite 241 und 242:
2.2 Gliederung und Lesehilfe für d
- Seite 243 und 244:
welche Träger-Strukturen/Instituti
- Seite 245 und 246:
denen sich viele in Übergangsphase
- Seite 247 und 248:
internes Verankerungsmodell Oppenhe
- Seite 249 und 250:
Einbindung ins Setting durch… ⇒
- Seite 251 und 252:
sammen setzen kann. Der Anteil an T
- Seite 253 und 254:
zwar mehr Eltern und etwas breitere
- Seite 255 und 256:
Einbindung in die Settings Welches
- Seite 257 und 258:
spiele von den anderen settinggebun
- Seite 259 und 260:
Eltern sind sehr unterschiedlich ge
- Seite 261 und 262:
Elterngruppen vertreten sind. Auch
- Seite 263 und 264:
Zu berücksichtigen ist, dass die P
- Seite 265 und 266:
anderen Mitarbeitern, die die exter
- Seite 267 und 268:
3.4 Praxistransfer und Fragestellun
- Seite 269 und 270:
gungen zur Einführung und Umsetzun
- Seite 271 und 272:
tätig sind. Sechs der insgesamt 13
- Seite 273 und 274:
Fortbildung kombiniert wurde, und d
- Seite 275 und 276:
Schriftliche Befragung von Kursteil
- Seite 277 und 278:
Personen an, als zum ersten Treffen
- Seite 279 und 280:
problematisch beurteilt, obwohl die
- Seite 281 und 282:
ner STEP Teilnehmer aus Hauptschule
- Seite 283 und 284:
Etwa die Hälfte der teilnehmenden
- Seite 285 und 286:
Studie für 11-13 Jährige aus Unte
- Seite 287 und 288:
Erhöhter Unterstützungsbedarf Imm
- Seite 289 und 290:
wie auf die Bedingungen, die eine T
- Seite 291 und 292:
„Was halten Sie vom Elternkursang
- Seite 293 und 294:
en und ihrer Arbeitstätigkeit star
- Seite 295 und 296:
Abb. B 28: Freiwillig teilnehmende
- Seite 297 und 298:
Abb. B 31: STEP-Teilnehmer Berlin (
- Seite 299 und 300:
Unterstützung suchen. Viele Eltern
- Seite 301 und 302:
6. Geschlechtersensible Elternbildu
- Seite 303 und 304:
egegnen möchten. Es ist offensicht
- Seite 305 und 306:
ger involviert und tatsächlich una
- Seite 307 und 308:
dass diese Gruppen die Elternkurspr
- Seite 309 und 310:
ot und zur eigenen Teilnahme. Diese
- Seite 311 und 312:
vertrauensvoll andocken können und
- Seite 313 und 314:
die Elternarbeit favorisiert aber j
- Seite 315 und 316:
Ergebnisse der wissenschaftlichen B
- Seite 317 und 318:
Die bei BEEP definierten schwer err
- Seite 319 und 320:
sche Ergebnis auch bei allen andere
- Seite 321 und 322:
ßern sich auch abweisend zur Unter
- Seite 323 und 324:
samkeitserwartung (Spalte „Eltern
- Seite 325 und 326:
wird auch von einem bedeutsamen Ant
- Seite 327 und 328:
Meinungen und Emotionen durch. Nebe
- Seite 329 und 330:
Alles, was uns hilft, unsere Kinder
- Seite 331 und 332:
Geduld, Aufmerksamkeit, Respekt, Zu
- Seite 333 und 334:
Abb. B 58: Erfolgsrating der Eltern
- Seite 335 und 336:
Abb. B 60) 40 . Eine kleine Teilneh
- Seite 337 und 338:
Empfehlungen zur Nachhaltigkeitssic
- Seite 339 und 340:
Eltern (hier: zu 95 %) am Ende als
- Seite 341 und 342:
nämlich zielgruppenspezifischer un
- Seite 343 und 344:
als Leiterinnen interessiert, die E
- Seite 345 und 346:
setzung für eine nachhaltige Elter
- Seite 347 und 348:
(a) Eltern kommen über Stadtteil-P
- Seite 349 und 350:
Abb. B 62: Wer rät und informiert
- Seite 351 und 352:
M=40). 71% der Teilnehmer sind 39 o
- Seite 353 und 354:
Etwas bedeutsamer scheint für die
- Seite 355 und 356:
Neue Herausforderungen und notwendi
- Seite 357 und 358:
STEP Tandem im Landkreis Göttingen
- Seite 359 und 360:
Die wissenschaftliche Begleitung de
- Seite 361 und 362:
250 200 196 (39%) 150 100 50 99 (20
- Seite 363 und 364:
enötigt längerfristige Unterstüt
- Seite 365 und 366:
Erkrankung/Be-. hinderung 13 (8%) T
- Seite 367 und 368:
Bestimmte Erziehungsproblematiken z
- Seite 369 und 370:
Kurs Zeitraum Erstgespräch Kursbeg
- Seite 371 und 372:
dungsmuster entwickeln kann. Im Zus
- Seite 373 und 374:
(4) Multiplikatorenkonzept Das Ange
- Seite 375 und 376:
Familie übertragen. Sie können si
- Seite 377 und 378:
Zusammenfassung und Fazit: STEP im
- Seite 379 und 380:
Individuelle Ressourcen Soziale Res
- Seite 381 und 382:
Neue Elterngruppen - spezielle STEP
- Seite 383 und 384:
sigkeit in vielen Familien und der
- Seite 385 und 386:
Jugendlichen, die die kompetente Un
- Seite 387 und 388:
Elternkurse als Entwicklungschance
- Seite 389 und 390:
Literaturverzeichnis Teilprojekt B
- Seite 391 und 392:
(Teilprojekt C) Diana Sahrai / Iren
- Seite 393 und 394:
2.4 Zusammenfassung und Resümee ..
- Seite 395 und 396:
Abb. C 27 Elterliche Kenntnis der D
- Seite 397 und 398:
1. Hintergrund 1.1 Einleitende Beme
- Seite 399 und 400:
des Präventionsdilemmas im Bereich
- Seite 401 und 402:
grund für die Idee, aus Kitas Bild
- Seite 403 und 404:
Eine Durchsicht der gesundheitsbezo
- Seite 405 und 406:
elativ hohe Dichte an Kindergärten
- Seite 407 und 408:
Die empirische Untersuchung der vor
- Seite 409 und 410:
In diesem Projekt geht es darum nac
- Seite 411 und 412:
100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20
- Seite 413 und 414:
100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20
- Seite 415 und 416:
Abbildung C 6 zeigt den Familiensta
- Seite 417 und 418:
struktureller Position einerseits u
- Seite 419 und 420:
Daten der KIGGS-Studie 7 präsentie
- Seite 421 und 422:
Untersuchungen stehen dabei in erst
- Seite 423 und 424:
Tab. C 6: Vorsorgeuntersuchungen un
- Seite 425 und 426:
ei der U9, von 60,6% (1992) auf 81,
- Seite 427 und 428:
Soziale Schichtzugehörigkeit Autor
- Seite 429 und 430:
egionalen Gesundheitsberichten ist
- Seite 431 und 432:
Datenquelle Einzugsgebiet Unterteil
- Seite 433 und 434:
U7 92,4% U8 89,0% U9 86,4% Kamtsiur
- Seite 435 und 436:
de Arbeitsbedingungen (Mielck 2005;
- Seite 437 und 438:
te“ (RKI 2008b) - oder die Tatsac
- Seite 439 und 440:
Eltern wurden einige Fragen zu dem
- Seite 441 und 442:
Abb. C 11: Teilnahme an den U-Unter
- Seite 443 und 444:
13,8% und Kinder, die das vierte od
- Seite 445 und 446:
Untere soziale Schicht 77,4% 22,6%
- Seite 447 und 448:
derjenigen Eltern, die ihre Kinder
- Seite 449 und 450:
Untersuchung wichtig und sinnvoll f
- Seite 451 und 452:
Schlechte Erfahrungen gemacht 4,6%
- Seite 453 und 454:
Angst vor Entdeckung einer Krankhei
- Seite 455 und 456:
den. Dieser Aspekt wird noch mal st
- Seite 457 und 458:
nigsten profitiert haben. Dieses Er
- Seite 459 und 460:
Eltern viel stärker vor allem übe
- Seite 461 und 462:
Inwiefern die Untersuchungen dem Zw
- Seite 463 und 464:
Zusammenfassend lässt sich also sa
- Seite 465 und 466:
festzustellen sind. So ist beispiel
- Seite 467 und 468:
tung und die Akzeptanz des Programm
- Seite 469 und 470:
- Stärkung der Gesundheitsvorsorge
- Seite 471 und 472:
Düsseldorf 34,2% 65,8% Solingen 55
- Seite 473 und 474:
OS ohne MH 44,2% 38,5% 17,3% OS mit
- Seite 475 und 476:
eites Spektrum an Kindergärten und
- Seite 477 und 478:
Programm kennen und wahrgenommen ha
- Seite 479 und 480:
100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20
- Seite 481 und 482:
Die in diesem Abschnitt präsentier
- Seite 483 und 484:
Ein weiteres Element des U-Boot Mat
- Seite 485 und 486:
teilung der einzelnen Materialien h
- Seite 487 und 488:
2.3.4 Programmakzeptanz und Program
- Seite 489 und 490:
im Kitaalltag präsent zu halten un
- Seite 491 und 492:
dies zur Bedingung werden - das U-B
- Seite 493 und 494:
dem Programm gewidmet wird, wie vie
- Seite 495 und 496:
derum fokussieren sehr stark den Au
- Seite 497 und 498:
gen. Für die Kitaleitungen (aber a
- Seite 499 und 500:
durch informelle Veranstaltungen wi
- Seite 501 und 502:
Eltern am häufigsten von den Erzie
- Seite 503 und 504:
Auch Reher et al. (2004) haben sich
- Seite 505 und 506:
Sprachschwierigkeiten diagnostizier
- Seite 507 und 508:
tern der unteren sozialen Schicht u
- Seite 509 und 510:
den Erzieherinnen im Hinblick auf i
- Seite 511 und 512:
grund differenziert analysiert werd
- Seite 513 und 514:
gen, dass Kindertagesstätten in de
- Seite 515 und 516:
Mittelwert Kindergartenfeste 1,55 E
- Seite 517 und 518:
Kita Kindergartenfeste Beteiligung
- Seite 519 und 520:
Auf den ersten Blick kann in Abbild
- Seite 521 und 522:
ei den Elternabenden eher der Migra
- Seite 523 und 524:
Arbeiten müssen 63,2% 36,8% Keine
- Seite 525 und 526:
haben“ hängen eng zusammen. Der
- Seite 527 und 528:
durch die Beteiligung im Alltag der
- Seite 529 und 530:
Hinderungsgrund der Betreuung ander
- Seite 531 und 532:
von anderen, vor allem unteren sozi
- Seite 533 und 534:
Sprachliche Fähigkeiten 69,3% 30,7
- Seite 535 und 536:
sozialer Schichtzugehörigkeit und
- Seite 537 und 538:
gänzlich von der Sprachförderung
- Seite 539 und 540:
Schichten mit und ohne Migrationshi
- Seite 541 und 542:
ereich die eigenen Kompetenzen als
- Seite 543 und 544:
Von sozial benachteiligten Eltern u
- Seite 545 und 546:
Die Bedarfe der Eltern wurden in di
- Seite 547 und 548:
In der ersten Phase der Studie stan
- Seite 549 und 550:
dass es sich bei dieser Gruppe ganz
- Seite 551 und 552:
teilzunehmen auf Ursachen zurückge
- Seite 553 und 554:
Diese gestiegenen Anforderungen und
- Seite 555 und 556:
Eltern aus der autochthonen Untersc
- Seite 557 und 558:
Literaturverzeichnis Teilprojekt C
- Seite 559 und 560:
Bundesministerium für Arbeit und S
- Seite 561 und 562:
Herzwartz-Emden (2008): Interkultur
- Seite 563 und 564:
lingmayer U H & Richter M (Hrsg.):
- Seite 565 und 566:
Schubert I, Horch K, Kahl H, Köste
- Seite 567 und 568:
Gesamtzusammenfassung, Empfehlungen
- Seite 569 und 570:
Das Projekt BEEP: Gesamtzusammenfas
- Seite 571 und 572:
auch nach einem subjektivem Unterst
- Seite 573 und 574:
Analytische Schwerpunkte Kindergart
- Seite 575 und 576:
tern mehr unterstützt werden solle
- Seite 577 und 578:
oder aus der Erwartung heraus, Elte
- Seite 579 und 580:
formelle. Dabei zeigen auch unsere
- Seite 581 und 582:
tion in Kitas und Schulen oder der
- Seite 583 und 584:
ammen zur Verfremdung der Inhalte f
- Seite 585 und 586:
ihres Kindes. Die Differenz zwische
- Seite 587 und 588:
egeistert sind über ein sehr ausge
- Seite 589 und 590:
Engagement des pädagogischen Perso
- Seite 591 und 592:
etc. die strukturellen, ökonomisch