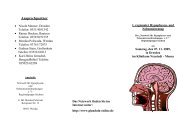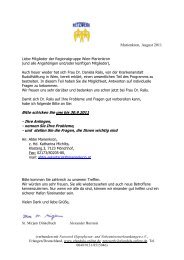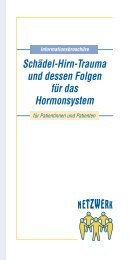Netzwerk Hypophysen- und Nebennierenerkrankungen eV
Netzwerk Hypophysen- und Nebennierenerkrankungen eV
Netzwerk Hypophysen- und Nebennierenerkrankungen eV
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Glücklicherweise können die Endokrinologen heute<br />
durch Labortests genau feststellen, welche Hormone<br />
nicht mehr in ausreichender Menge gebildet werden,<br />
<strong>und</strong> dann eine entsprechende Hormonersatztherapie<br />
durchführen, bei der der Patient genauso viel Hormon<br />
erhält, wie sein Körper braucht <strong>und</strong> bei normal funktionierenden<br />
Hormondrüsen auch produzieren würde.<br />
Um diese Dosis optimal einzustellen, müssen regelmäßig<br />
die entsprechenden Werte bestimmt werden. Dem<br />
Patienten wird Blut, manchmal auch Urin, abgenommen<br />
<strong>und</strong> im Labor werden dann durch spezielle Verfahren<br />
(Immunassays) die jeweils interessierenden Hormonwerte<br />
ermittelt.<br />
Da es heute eine Vielzahl von Testverfahren von verschiedenen<br />
Herstellern gibt, können die Normwerte der<br />
einzelnen Labors unterschiedlich sein. Daher muss der<br />
Arzt die entsprechenden Referenzbereiche des jeweiligen<br />
Labors kennen, um die Werte auch richtig interpretieren<br />
zu können. Bei diesen Referenzbereichen handelt es sich<br />
um einen statistischen Bereich, der mit einem bestimmten<br />
Analysesystem an einer Stichprobe von Ges<strong>und</strong>en<br />
gewonnen wurde.<br />
In der folgenden Übersicht haben wir für Sie die Referenzbereiche<br />
der wichtigsten Hormone, die zur Diagnose<br />
<strong>und</strong> Verlaufskontrolle bei <strong>Hypophysen</strong>- <strong>und</strong> Nebenniereninsuffizienz<br />
bestimmt werden, in alphabetischer<br />
Reihenfolge zusammengestellt. Ermittelt wurden diese<br />
Werte mit einem in vielen Labors verwendeten Analysegerät,<br />
dem Immulite 2000.<br />
ACTH (Adrenocorticotropes Hormon)<br />
ACTH wird im <strong>Hypophysen</strong>vorderlappen gebildet <strong>und</strong><br />
regt die Sekretion von Cortisol in der Nebennierenrinde<br />
an. Bei einem ACTH-Mangel wird zu wenig Cortisol<br />
ausgeschüttet, wodurch lebensnotwendige Körperfunkti-<br />
Diagnostik<br />
Aufgeführt sind jeweils:<br />
l das Hormon <strong>und</strong> seine wichtigsten Funktionen,<br />
l die Fragestellung, zu deren Klärung die Bestimmung<br />
durchgeführt wird,<br />
l das Probenmaterial, aus dem der Wert bestimmt<br />
wird (Plasma = Blutflüssigkeit ohne Blutkörperchen,<br />
Serum = Plasma nach Abschluss der Blutgerinnung,<br />
ca. 20 Minuten),<br />
l der Referenzbereich bei Erwachsenen,<br />
l Hinweise zur Interpretation des Wertes ( = stark<br />
erhöht, = erhöht, ± = unverändert bis erhöht,<br />
± = unverändert bis erniedrigt, = erniedrigt,<br />
= stark erniedrigt).<br />
Die hier dargestellten basalen Hormonwerte sind<br />
allein oft nicht aussagekräftig genug. Die Endokrinologen<br />
benutzen deshalb Suppressions- oder Stimulationstests,<br />
um genauere Informationen über die Funktion<br />
des endokrinen Organs zu erhalten.<br />
Einheiten*:<br />
mg Milligramm (0,001 g)<br />
µg Mikrogramm (0,000001 g)<br />
ng Nanogramm (0,000000001 g)<br />
pg Pikogramm (0,000000000001 g)<br />
dl Deziliter (0,1 l)<br />
ml Milliliter (0,001 l)<br />
µl Mikroliter (0,000001 l)<br />
IE Internationale Einheit<br />
* Zur Umrechnung in molare Einheiten (z.B. nmol/l) benötigt man das<br />
Molekulargewicht des jeweiligen Hormons in g/mol.<br />
onen gestört sind, bei ACTH-Überschuss (z.B. durch ein<br />
ACTH-produzierendes <strong>Hypophysen</strong>adenom) kommt es<br />
entsprechend zu einer exzessiven Cortisolbildung mit<br />
weitreichenden Folgen (siehe unter „Cortisol“).<br />
Fragestellung Material Referenzbereich Hinweise zur Interpretation<br />
Differentialdiagnose 2 ml EDTA- 10, – 8, pg/ml bei primärer* NNR-Insuffizienz (M. Addison)<br />
des Hypercortisolismus, Plasma, <strong>und</strong> ektoper ACTH-Produktion (= in einem<br />
NNR-Insuffizienz, eisgekühlt nicht in der Hypophyse gelegenen Tumor)<br />
<strong>Hypophysen</strong>insuffizienz ± bei M. Cushing, ACTH-produzierendem<br />
(Stimulierbarkeit mit CRH) <strong>Hypophysen</strong>tumor<br />
bei Cushing-Syndrom bei NNR-Adenom,<br />
NNR-Karzinom<br />
bei sek<strong>und</strong>ärer <strong>und</strong> tertiärer* NNR-<br />
Insuffizienz<br />
* Von einer primären Insuffizienz der Nebennierenrinde (oder einer anderen Hormondrüse) spricht man, wenn das Organ selbst geschädigt ist, z.B. durch einen<br />
Tumor oder eine Infektion, <strong>und</strong> das entsprechende Hormon (in diesem Fall Cortisol) nicht bzw. nicht ausreichend bilden kann.<br />
Bei einer sek<strong>und</strong>ären Insuffizienz ist die Nebennierenrinde selbst ges<strong>und</strong>, aber das übergeordnete hormonelle Regulationszentrum (die Hypophyse) ist gestört <strong>und</strong><br />
schüttet nicht genügend Hormone (in diesem Fall ACTH) aus, so dass es sek<strong>und</strong>är zu einem Cortisolmangel kommt.<br />
Von einer tertiären Insuffizienz spricht man bei einem Ausfall oder einer verminderten Funktion der Nebennierenrinde nach Absetzen einer Cortisontherapie.<br />
Durch eine hochdosierte Cortisongabe (z.B. bei entzündlichen, rheumatischen Erkrankungen) wird der Regulationsmechanismus in der Hypophyse gestört <strong>und</strong><br />
sie produziert kein die Nebennierenrinde anregendes ACTH mehr.<br />
GLANDULA 23/06<br />
1