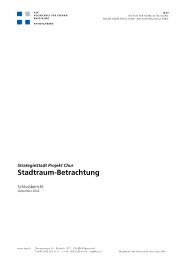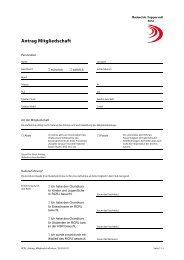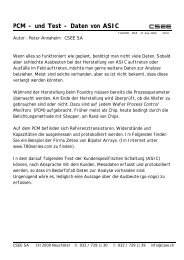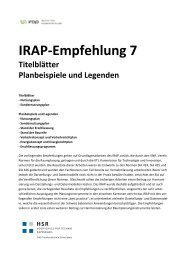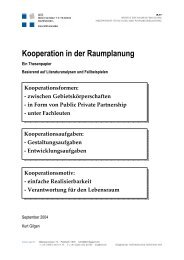21 Prinzipien zur Raumplanung - IRAP
21 Prinzipien zur Raumplanung - IRAP
21 Prinzipien zur Raumplanung - IRAP
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Auch private Instanzen, die raum- und umweltwirksam agieren, sind der Planungspflicht zu unterstellen.<br />
Die Planungspflicht umfasst die Abstimmungs- und Koordinationspflicht, ferner - auch im Sinne des<br />
Nachhaltigkeitsprinzips - die Beachtung von Auswirkungen, d.h. von Neben- und Fernwirkungen sowie<br />
die Beachtung eines Ermessens- und Handlungsspielraumes für die in Hierarchie und Zeit nachgeordneten<br />
Instanzen.<br />
16. Das Subsidiaritätsprinzip<br />
Unterstehen alle Akteure der Planungspflicht, so kann das Verantwortungsprinzip besser greifen. Selbst<br />
wenn private Akteure ihre Pflichten nicht wahrnehmen sollten, müssten zunächst kommunale Planungsinstanzen<br />
stellvertretend die Aufgaben auf Kosten der säumigen Verantwortlichen übernehmen. Dem<br />
Subsidiaritätsprinzip folgend, wären bei Überforderung kommunaler Planungsträger zunächst regionale<br />
bzw. kantonale und schliesslich Bundesstellen angesprochen.<br />
Dieses Prinzip stösst allerdings an politische Grenzen die darin bestehen, dass es äusserst unpopulär ist,<br />
ersatzweise (subsidiär) für eine in der Hierarchie untergeordnete Ebene Planungen und Entscheidungen<br />
vorzunehmen und dann erst noch die Kosten dafür in Rechnung zu stellen. Kommt dazu, dass die nicht<br />
zeitgerechte Erfüllung einer Planungspflicht oft nur sehr schwer eindeutig festgestellt werden kann. Es<br />
gibt allerdings Fälle, wo subsidiäres Handeln angefordert wird. Wenn beispielsweise mehrere gleichgestellte<br />
Träger auf eine Kooperation und Koordination angewiesen sind, die aber durch eine Minderheit<br />
blockiert werden, wird gelegentlich der Antrag an die übergeordnete Instanz gestellt, stellvertretend einen<br />
Planungsprozess einzuleiten oder ihn gar durchzuführen.<br />
Ersatzvornahmen von Planungen bzw. Entscheidungen durch übergeordnete Instanzen stellen eine relativ<br />
sanfte Sanktions-Massnahme dar, bestünde nicht das Finanzierungsdilemma. Durch übergeordnete<br />
Instanzen initiierte, geleitete oder moderierte Entscheidungs- und Planungsprozesse werden in der Regel<br />
recht gut akzeptiert, wenn die Betroffenen und die Vertreter der an sich zuständigen Planungsebene im<br />
Prozess mit eingebunden sind und mitentscheiden können. Das Dilemma entsteht meistens nur aus dem<br />
Umstand, dass diese dabei gleichwohl <strong>zur</strong> Kasse gebeten werden. Denn das Prinzip „Wer befiehlt, soll<br />
auch bezahlen!“ wird durchbrochen.<br />
Dem Dilemma könnte durch Fördermittel begegnet werden. Es liegt nahe, dass gleichzeitig mit der Erweiterung<br />
der Planungspflicht (Prinzip 15) und einer konsequenten Handhabung der Ersatzvornahme bei<br />
Versäumnissen auch Mittel bereitgestellt werden. Übergeordnete Instanzen sollen sich an Planungen finanziell<br />
beteiligen und zwar bei zeitgerechter Planungspflichterfüllung wie bei säumigen Planungsträgern<br />
durch Ersatzvornahmen. Die Planungsverantwortlichen haben, gewissermassen im Gegenzug, darüber<br />
Bericht zu erstatten, inwiefern sie mit ihrer Planung die Planungspflichten erfüllen. Diese Form der<br />
Selbstdeklaration, wie sie bei Nutzungsplänen in der Schweiz vorgeschrieben ist (Art. 47 RPV), soll für alle<br />
Planungen zu einem Mittel der Qualitätssicherung werden.<br />
Planungs- und Entscheidungskompetenzen haben so nahe wie möglich beim Akteur und Betroffenen zu<br />
liegen. Übergeordnete Kontrollinstanzen sollen nur subsidiär eingreifen. Ersatzvornahmen bei Versäumnissen<br />
sind konsequent vorzunehmen. Die verantwortungsbewusste Erfüllung der Planungspflicht kann<br />
aber vermutlich nur erreicht werden, wenn sie durch den Staat gemäss dessen Kontrollkompetenzen<br />
subventioniert wird.<br />
17. Das Prinzip des stufengerechten Planungsmittels: Instrumente und deren Verbindlichkeit<br />
Öffentlich-rechtliche Festlegungen haben die Form von Erlassen (Gesetze, Verordnungen) und Verfügungen<br />
(z.B. Bewilligungen). Privatrechtliche Vereinbarungen kennen wir in Form von Verträgen und,<br />
wenn sie verbindlich den Boden betreffen, als Eintragungen im Grundbuch (Bodenkataster).<br />
Mit den Plänen nach <strong>Raumplanung</strong>srecht steht ein Instrumentarium <strong>zur</strong> Verfügung, welches ein differenziertes<br />
Festlegen von strategischen, konzeptionellen als auch programmatischen Inhalten ermöglicht. Es<br />
handelt sich dabei um Pläne mit Informations- oder Inventarcharakter, welche unverbindlich bleiben kön-<br />
11