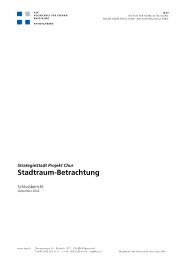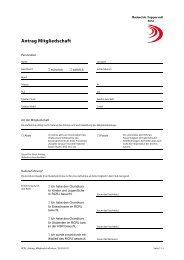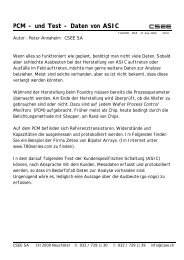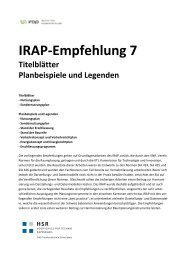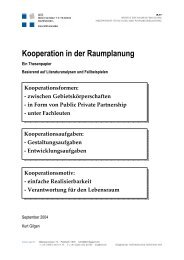21 Prinzipien zur Raumplanung - IRAP
21 Prinzipien zur Raumplanung - IRAP
21 Prinzipien zur Raumplanung - IRAP
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
3. Das Kausalitätsprinzip: Planung als Früherkennung, Prophylaxe und Problemlösungsprozess<br />
Die traditionelle Planungstheorie und Systemtechnik baut im wesentlichen auf dem Denkmuster auf, dass<br />
es bei Planungsaufgaben um die Lösung von Problemen geht. Dies ist an sich weiterhin ein richtiger Ansatz.<br />
Probleme haben ihre Ursachen; diese gilt es zu erfassen, künftig zu beeinflussen bzw. ihnen etwas<br />
entgegenzusetzen. Dabei soll das Einfluss- bzw. Handlungsfeld optimal ausgeschöpft werden. Die zu<br />
verfolgenden Ziele ergeben sich aus dem Bestreben, Probleme und Konflikte zu beheben oder zu mildern<br />
bzw. sie künftig zu vermeiden.<br />
Planung, als vorhausschauendes, prophylaktisches Handeln, fordert <strong>zur</strong>echt zweckmässige, d.h. aufgabengerechte<br />
Beobachtungsgrundlagen: Periodische statistische Erhebungen, Messreihen, Stichprobenermittlungen,<br />
Meinungsforschung, Raumbeobachtung usw. Diese dienen der Ursachen-Wirkungs-<br />
Analysen, der Zielfindung wie der Modellbildung und den Vorhersagen (Prognosen).<br />
Analysen sind unerlässlich für die Problemfrüherkennung, die Zielformulierung sowie die rechtzeitige<br />
Entwicklung von Konzepten, Strategien, Massnahmen und Programmen.<br />
4. Das Finalitätsprinzip: Planung, ausgehend von Visionen, erwünschten Entwicklungen<br />
und Zielen<br />
Antworten auf die Frage „Wohin soll die Reise gehen?“ lassen sich nicht in jedem Fall allein – nach dem<br />
Kausalitätsansatz - als Resultat des bisher Geschehenen verstehen. Zumindest in der Auseinandersetzung<br />
mit Fernzielen kommt, um mit Ernst Bloch zu sprechen, unseren Träumen, bzw. den Utopien eine<br />
grosse Bedeutung zu. Die Hoffnung stellt „die Energie <strong>zur</strong> Veränderung der Welt nach Massgabe unserer<br />
Wünsche bereit“ und vermittelt „diese Wünsche mit den objektiv realen Möglichkeiten der Welt und leitet<br />
zu planvollem Handeln an“. 2<br />
Wenn derzeit im Zusammenhang mit der erwünschten bzw. anzustrebenden Entwicklung häufig von „Visionen“<br />
gesprochen wird, so ist nicht hellseherisches Wissen, sondern es sind viel eher Zukunftsbilder im<br />
Sinne der Bloch’schen Utopien angesprochen.<br />
Zukunftsbilder und Ziele stehen in Wechselbeziehung zueinander: Aus Visionen lassen sich ganze Zielsysteme<br />
ableiten. Raumplanerische Visionen gehen dank ihrem räumlichen Bezug zum Beispiel von einer<br />
künftig erwünschten Entwicklung eines Ortes, einer Stadt, einer Region aus. Daraus lassen sich, im<br />
Vergleich mit der bisherigen Entwicklung, sowohl generelle Ziele als auch operable und operationale Ziele<br />
ableiten. Umgekehrt können bestimmte Ziele Zukunftsbilder erst auslösen: Ziele, wie die nachhaltige<br />
Entwicklung, der haushälterische Umgang mit dem Boden, die Erhaltung der Funktionstüchtigkeit einer<br />
Siedlung, hohe Gestaltqualität, vielfältiges kulturelles Leben, individuelle und gesellschaftliche Entfaltungsmöglichkeiten<br />
oder Erhöhung des Wohlbefindens der Menschen können, zu einem Ganzen zusammengefügt,<br />
Visionen und Leitbilder erzeugen.<br />
Raumplanerische Zukunftsbilder, wie Visionen und Leitbilder, müssen einen Ortsbezug haben, d.h. auf<br />
die Frage Antwort geben: Wo ist was anzustreben? .<br />
5. Das Gegenstromprinzip<br />
Modelle dienen der analytischen wie der konzeptionellen Betrachtung von Entwicklungen, sie bilden die<br />
Realität jedenfalls in der Weise vereinfachend ab, dass die Zusammenhänge verständlich werden. Mittels<br />
Modellen können nur einige, nie aber alle Zusammenhänge erklärt werden. Gelegentlich hat man<br />
sich deshalb mehrerer Modelle gleichzeitig nebeneinander zu bedienen. Werden mittels dieses "Prinzips<br />
des Nebeneinanders" Prozesse betrachtet, so kann man sich auch schwer erfassbaren, komplexen Systemen<br />
nähern.<br />
Bei räumlichen Modellen bzw. Systemen sollen sich netzartige und zellenartige Betrachtungsweisen nicht<br />
gegenüberstehen, sondern müssen nebeneinander Platz haben. Typisch bei diesen räumlichen Modellen<br />
ist deren bildhafte, metapherartige Beschreibung der entsprechenden Modelle. Beim Netz sind es Fäden<br />
oder Bänder, die mittels Knoten zu Maschen verbunden werden. Es entstehen Maschenfelder bzw. Zwi-<br />
3