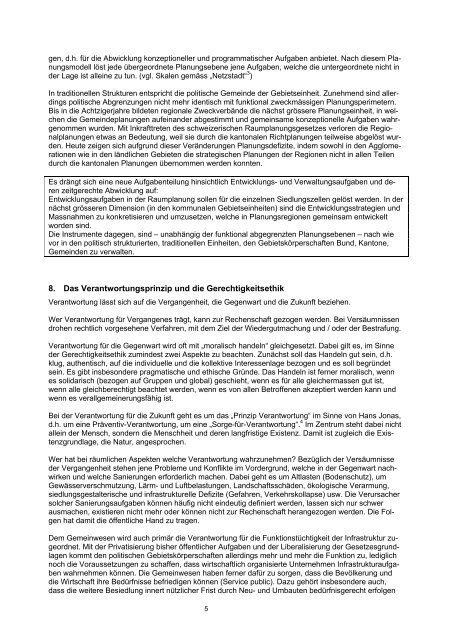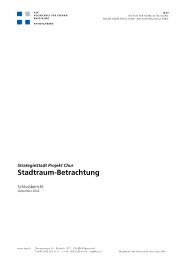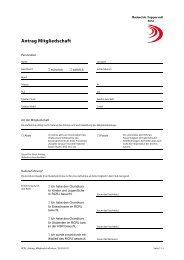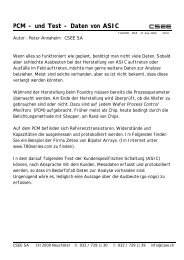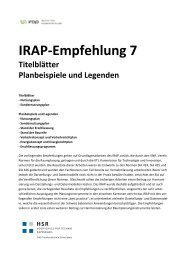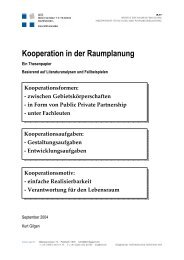21 Prinzipien zur Raumplanung - IRAP
21 Prinzipien zur Raumplanung - IRAP
21 Prinzipien zur Raumplanung - IRAP
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
gen, d.h. für die Abwicklung konzeptioneller und programmatischer Aufgaben anbietet. Nach diesem Planungsmodell<br />
löst jede übergeordnete Planungsebene jene Aufgaben, welche die untergeordnete nicht in<br />
der Lage ist alleine zu tun. (vgl. Skalen gemäss „Netzstadt“ 3 )<br />
In traditionellen Strukturen entspricht die politische Gemeinde der Gebietseinheit. Zunehmend sind allerdings<br />
politische Abgrenzungen nicht mehr identisch mit funktional zweckmässigen Planungsperimetern.<br />
Bis in die Achtzigerjahre bildeten regionale Zweckverbände die nächst grössere Planungseinheit, in welchen<br />
die Gemeindeplanungen aufeinander abgestimmt und gemeinsame konzeptionelle Aufgaben wahrgenommen<br />
wurden. Mit Inkrafttreten des schweizerischen <strong>Raumplanung</strong>sgesetzes verloren die Regionalplanungen<br />
etwas an Bedeutung, weil sie durch die kantonalen Richtplanungen teilweise abgelöst wurden.<br />
Heute zeigen sich aufgrund dieser Veränderungen Planungsdefizite, indem sowohl in den Agglomerationen<br />
wie in den ländlichen Gebieten die strategischen Planungen der Regionen nicht in allen Teilen<br />
durch die kantonalen Planungen übernommen werden konnten.<br />
Es drängt sich eine neue Aufgabenteilung hinsichtlich Entwicklungs- und Verwaltungsaufgaben und deren<br />
zeitgerechte Abwicklung auf:<br />
Entwicklungsaufgaben in der <strong>Raumplanung</strong> sollen für die einzelnen Siedlungszellen gelöst werden. In der<br />
nächst grösseren Dimension (in den kommunalen Gebietseinheiten) sind die Entwicklungsstrategien und<br />
Massnahmen zu konkretisieren und umzusetzen, welche in Planungsregionen gemeinsam entwickelt<br />
worden sind.<br />
Die Instrumente dagegen, sind – unabhängig der funktional abgegrenzten Planungsebenen – nach wie<br />
vor in den politisch strukturierten, traditionellen Einheiten, den Gebietskörperschaften Bund, Kantone,<br />
Gemeinden zu verwalten.<br />
8. Das Verantwortungsprinzip und die Gerechtigkeitsethik<br />
Verantwortung lässt sich auf die Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft beziehen.<br />
Wer Verantwortung für Vergangenes trägt, kann <strong>zur</strong> Rechenschaft gezogen werden. Bei Versäumnissen<br />
drohen rechtlich vorgesehene Verfahren, mit dem Ziel der Wiedergutmachung und / oder der Bestrafung.<br />
Verantwortung für die Gegenwart wird oft mit „moralisch handeln“ gleichgesetzt. Dabei gilt es, im Sinne<br />
der Gerechtigkeitsethik zumindest zwei Aspekte zu beachten. Zunächst soll das Handeln gut sein, d.h.<br />
klug, authentisch, auf die individuelle und die kollektive Interessenlage bezogen und es soll begründet<br />
sein. Es gibt insbesondere pragmatische und ethische Gründe. Das Handeln ist ferner moralisch, wenn<br />
es solidarisch (bezogen auf Gruppen und global) geschieht, wenn es für alle gleichermassen gut ist,<br />
wenn alle gleichberechtigt beachtet werden, wenn es von allen Betroffenen akzeptiert werden kann und<br />
wenn es verallgemeinerungsfähig ist.<br />
Bei der Verantwortung für die Zukunft geht es um das „Prinzip Verantwortung“ im Sinne von Hans Jonas,<br />
d.h. um eine Präventiv-Verantwortung, um eine „Sorge-für-Verantwortung“. 4 Im Zentrum steht dabei nicht<br />
allein der Mensch, sondern die Menschheit und deren langfristige Existenz. Damit ist zugleich die Existenzgrundlage,<br />
die Natur, angesprochen.<br />
Wer hat bei räumlichen Aspekten welche Verantwortung wahrzunehmen? Bezüglich der Versäumnisse<br />
der Vergangenheit stehen jene Probleme und Konflikte im Vordergrund, welche in der Gegenwart nachwirken<br />
und welche Sanierungen erforderlich machen. Dabei geht es um Altlasten (Bodenschutz), um<br />
Gewässerverschmutzung, Lärm- und Luftbelastungen, Landschaftsschäden, ökologische Verarmung,<br />
siedlungsgestalterische und infrastrukturelle Defizite (Gefahren, Verkehrskollapse) usw. Die Verursacher<br />
solcher Sanierungsaufgaben können häufig nicht eindeutig definiert werden, lassen sich nur schwer<br />
ausmachen, existieren nicht mehr oder können nicht <strong>zur</strong> Rechenschaft herangezogen werden. Die Folgen<br />
hat damit die öffentliche Hand zu tragen.<br />
Dem Gemeinwesen wird auch primär die Verantwortung für die Funktionstüchtigkeit der Infrastruktur zugeordnet.<br />
Mit der Privatisierung bisher öffentlicher Aufgaben und der Liberalisierung der Gesetzesgrundlagen<br />
kommt den politischen Gebietskörperschaften allerdings mehr und mehr die Funktion zu, lediglich<br />
noch die Voraussetzungen zu schaffen, dass wirtschaftlich organisierte Unternehmen Infrastrukturaufgaben<br />
wahrnehmen können. Die Gemeinwesen haben ferner dafür zu sorgen, dass die Bevölkerung und<br />
die Wirtschaft ihre Bedürfnisse befriedigen können (Service public). Dazu gehört insbesondere auch,<br />
dass die weitere Besiedlung innert nützlicher Frist durch Neu- und Umbauten bedürfnisgerecht erfolgen<br />
5