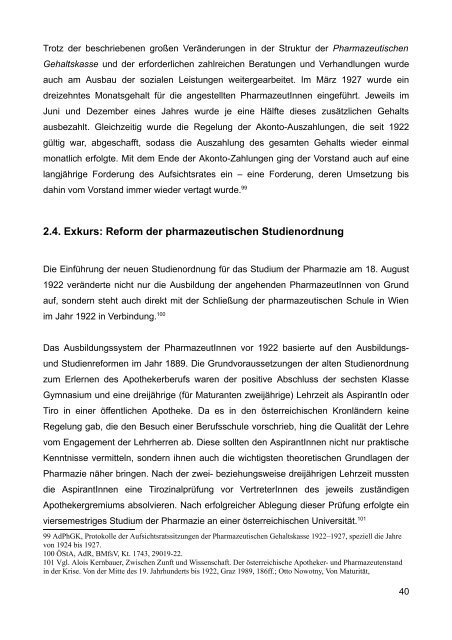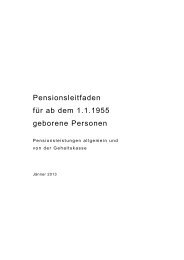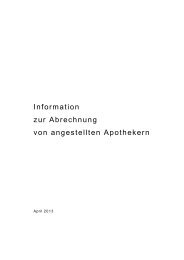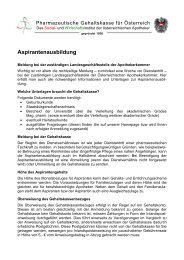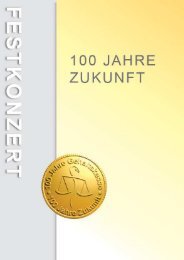- Seite 1 und 2: Die Pharmazeutische Gehaltskasse f
- Seite 3 und 4: 5. ‚Arisierung‘ und Rückstellu
- Seite 5 und 6: Vorwort und Danksagung Der vorliege
- Seite 7 und 8: 1. Gründung und Anfangsjahre der P
- Seite 9 und 10: den Jahren zwischen 1904 und 1906 s
- Seite 11 und 12: Innenministerium als zuständiger B
- Seite 13 und 14: den polnischen, galizischen und ita
- Seite 15 und 16: egründet. 23 Erst im Jahre 1912 ko
- Seite 17 und 18: jeweiligen ApothekenbesitzerInnen s
- Seite 19 und 20: und Vereinen einzuholen. 35 In eine
- Seite 21 und 22: 2. Die Pharmazeutische Gehaltskasse
- Seite 23 und 24: esitzerInnen wieder eingestellt wer
- Seite 25 und 26: 2.2. Der schwierige Start der geset
- Seite 27 und 28: Die Assistentenschaft ist sicher ga
- Seite 29 und 30: Matura sollte Vorbedingung für das
- Seite 31 und 32: Apotheker Österreichs gelegt und d
- Seite 33 und 34: diese durch Kredite zu günstigen B
- Seite 35 und 36: Haushalt gelebt hatten, bekamen ein
- Seite 37 und 38: Nach der Verabschiedung eines neuen
- Seite 39: den gleichen Vertretern zusammen. S
- Seite 43 und 44: Laborübungen in das Studium integr
- Seite 45 und 46: angeschlagenen ApothekerInnen wenig
- Seite 47 und 48: alternierend, mit Mag. Franz Dittri
- Seite 49 und 50: Auswirkungen und ließ die Spannung
- Seite 51 und 52: und oft heftige Diskussionen und be
- Seite 53 und 54: Um die Entscheidung des Bundesminis
- Seite 55 und 56: der Reichsverband nach diesem Angri
- Seite 57 und 58: leiben, stellte Präsident Mag. Hum
- Seite 59 und 60: Pharmazeutische Gehaltskasse für
- Seite 61 und 62: Mag. Gustav Hummer und Mag. Franz D
- Seite 63 und 64: arbeitenden PharmazeutInnen wurde i
- Seite 65 und 66: Verbindung zu dem immer kritischer
- Seite 67 und 68: durchzusetzen und die Interessen de
- Seite 69 und 70: überdauerte das Jahr 1938 ebenfall
- Seite 71 und 72: Mit dieser ersten Auseinandersetzun
- Seite 73 und 74: persönlichen Konzession, ihre Zahl
- Seite 75 und 76: In den 1930er-Jahren stellte sich d
- Seite 77 und 78: sogenannten ‚Anschluß‘ 1938 in
- Seite 79 und 80: der Verordnung über den Einsatz de
- Seite 81 und 82: dem SA-Sturmbannführer Mag. Edwin
- Seite 83 und 84: erechnet. Emigrationswillige Juden
- Seite 85 und 86: Zwei Wiener Apotheker setzten sich
- Seite 87 und 88: 5. ‚Arisierung‘ und Rückstellu
- Seite 89 und 90: Dezember, letzterer am 18. Juni 194
- Seite 91 und 92:
ewerkstelligte, wurde die Konzessio
- Seite 93 und 94:
Mit Bescheid der Wiener Magistratsa
- Seite 95 und 96:
der Apotheke „Zum heiligen Geist
- Seite 97 und 98:
Wien 1., Franz Josefskai 47, durch
- Seite 99 und 100:
1934 auch Konzessionär der Apothek
- Seite 101 und 102:
Erna Ahl verkauften die Rechte an d
- Seite 103 und 104:
gefasst und im Lager Pithiviers int
- Seite 105 und 106:
Am 21. November 1938 legte Olga Bra
- Seite 107 und 108:
aufgehoben und die Genehmigung zur
- Seite 109 und 110:
Schweden-Apotheke erwerben zu könn
- Seite 111 und 112:
gleichfalls weitgehend zerstört wu
- Seite 113 und 114:
Apotheke „Zur Hoffnung“ erhielt
- Seite 115 und 116:
1937 einen Jahresumsatz von RM 92.5
- Seite 117 und 118:
Besitzverhältnisse schließlich au
- Seite 119 und 120:
Mathilden-Apotheke mit RM 34.087,70
- Seite 121 und 122:
5.1.3. Wien, Erdberg Apotheke „Zu
- Seite 123 und 124:
den jüdischen Besitzern und dem
- Seite 125 und 126:
Zweiten Rückstellungsgesetzes die
- Seite 127 und 128:
Margarete Werner, die Erbin nach Ma
- Seite 129 und 130:
führer Mag. Edwin Renner, zitiert.
- Seite 131 und 132:
sozialistischen Machtübernahme in
- Seite 133 und 134:
gestellt und von Mag.ª Hermine Urv
- Seite 135 und 136:
seiner Frau Irma am 14. September 1
- Seite 137 und 138:
Leiterin bestellt. 704 Anfang 1948
- Seite 139 und 140:
5.1.7. Wien, Neubau Babenberger-Apo
- Seite 141 und 142:
ich von ihm verwarnt und mir mein g
- Seite 143 und 144:
zur Abdeckung eines Teiles der Auß
- Seite 145 und 146:
missbräuchlicher Bereicherung bei
- Seite 147 und 148:
Apotheke „Zur Universität“, Wi
- Seite 149 und 150:
Apotheke, da nach Abzug der ‚Aris
- Seite 151 und 152:
5.1.10. Wien, Favoriten Apotheke
- Seite 153 und 154:
verkehrsstelle abzuführen. 856 Am
- Seite 155 und 156:
kosten in Höhe von ÖS 10.000,- au
- Seite 157 und 158:
Ansuchen nicht entsprochen werden k
- Seite 159 und 160:
Antonius-Apotheke wieder zu überne
- Seite 161 und 162:
wurden ihr sowohl die Apotheke als
- Seite 163 und 164:
Apotheke „Zum heiligen Josef“,
- Seite 165 und 166:
Die Apotheke „Zum Schutzengel“
- Seite 167 und 168:
der einen Hälfte ihrer 1938 entzog
- Seite 169 und 170:
1945 den Antrag, sie bis zur Kläru
- Seite 171 und 172:
fliehen und emigrierten in die USA.
- Seite 173 und 174:
Apotheke „Zur göttlichen Vorsehu
- Seite 175 und 176:
Apotheke bestellt, da Mag. Bruno Gr
- Seite 177 und 178:
verschuldet. Mag. Goranin versuchte
- Seite 179 und 180:
führung der Apotheke. 1106 Da Mag.
- Seite 181 und 182:
später am Wiener Zentralfriedhof b
- Seite 183 und 184:
nach Wien zurück und unterzog sich
- Seite 185 und 186:
zu vertauschen, wobei ich als Apoth
- Seite 187 und 188:
5.1.17. Wien, Währing Adler-Apothe
- Seite 189 und 190:
entzogener Vermögen“ dazu angibt
- Seite 191 und 192:
Apotheke „Zum Schutzengel“, Wie
- Seite 193 und 194:
Gunsten von Mag. Bronislav Herz ein
- Seite 195 und 196:
Riesenfeld erhielten RM 11.460,40 a
- Seite 197 und 198:
ÖS 35.000,- an den ‚Ariseur‘ M
- Seite 199 und 200:
Mag. Richard Adelstein konnte 1939
- Seite 201 und 202:
ehemaligen BesitzerInnen von diesem
- Seite 203 und 204:
Einrichtung und des Inventars, der
- Seite 205 und 206:
Besagter Kaufvertrag sah RM 33.496,
- Seite 207 und 208:
RM 46.700,-, der Betrieb war mit RM
- Seite 209 und 210:
5.2. ‚Arisierung‘ und Rückstel
- Seite 211 und 212:
25. Juli 1942 von der Geheimen Staa
- Seite 213 und 214:
Dr. Hans Niedermayer übersiedelte
- Seite 215 und 216:
wurde mit Teilerkenntnis der Rücks
- Seite 217 und 218:
entzogenen Apotheke beantragt. 1438
- Seite 219 und 220:
erhielt RM 18.279,70 aus dem Zwangs
- Seite 221 und 222:
Kommissarischen Verwalter der jüdi
- Seite 223 und 224:
Vor meiner Übernahme wurde die Apo
- Seite 225 und 226:
Rückstellung der ihrem Vater 1938
- Seite 227 und 228:
südamerikanische Staaten aus. Die
- Seite 229 und 230:
3. November 1941 fünf Transporte m
- Seite 231 und 232:
nach Izbica. 1530 Die Menschen dies
- Seite 233 und 234:
wurde Mag. Isaak Schatz von Wien na
- Seite 235 und 236:
Innsbruck), kam es zur Errichtung v
- Seite 237 und 238:
Deutsche Reich getroffen hatten. Zw
- Seite 239 und 240:
ausbleibenden Fälle wurden nun vor
- Seite 241 und 242:
6.3.3. Das Verfahren gegen Dr. Hans
- Seite 243 und 244:
wurde er in der weiteren Untersuchu
- Seite 245 und 246:
7. Die österreichische Apothekersc
- Seite 247 und 248:
des Bundesministeriums für soziale
- Seite 249 und 250:
Besatzungsmächten war es auch beso
- Seite 251 und 252:
zur Verfügung gestellt werden. 157
- Seite 253 und 254:
18. Dezember 1906 war die Schaffung
- Seite 255 und 256:
in Baden, welches sich ebenfalls no
- Seite 257 und 258:
Quellen und Methodik Auf den folgen
- Seite 259 und 260:
KonzessionärInnen zu allen Wiener
- Seite 261 und 262:
- Akten des Bundesministeriums für
- Seite 263 und 264:
Jahre 1940 bis 1945 nach 1945 von d
- Seite 265 und 266:
ausgehoben, wovon 77 auch tatsächl
- Seite 267 und 268:
- Verlassenschaftsabhandlungen aus
- Seite 269 und 270:
Datenerfassung Zur Geschichte öste
- Seite 271 und 272:
Leopold Hochberger, Die Geschichte
- Seite 273 und 274:
Artikel und Beiträge in Zeitschrif
- Seite 275 und 276:
Karl Rauch, 50 Jahre Pharmazeutisch
- Seite 277 und 278:
Anhang Abkürzungsverzeichnis BMfI
- Seite 279 und 280:
Wie haben Sie persönlich den ‚An
- Seite 281 und 282:
Waren Sie da eher ein Einzelfall, o
- Seite 283 und 284:
Gab es Probleme, weil viele Pharmaz
- Seite 285 und 286:
Da bin ich hineingegangen zum Anges
- Seite 287:
Visitationen ist immer ein Hofrat v