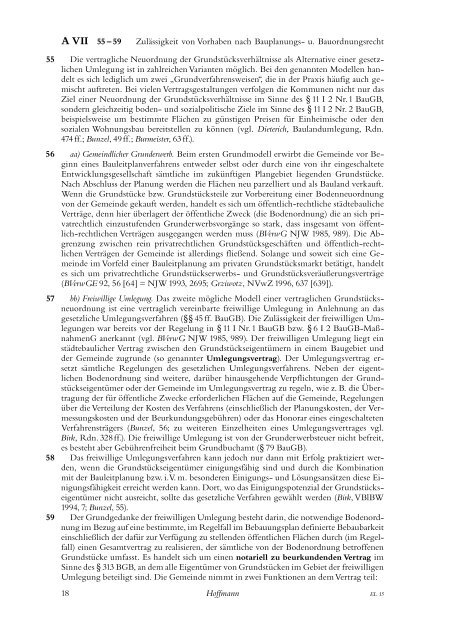die Ãbertragung von GrundstĪcksflÄchen z. B. fĪr Folgeeinrichtungen ...
die Ãbertragung von GrundstĪcksflÄchen z. B. fĪr Folgeeinrichtungen ...
die Ãbertragung von GrundstĪcksflÄchen z. B. fĪr Folgeeinrichtungen ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
55<br />
56<br />
57<br />
58<br />
59<br />
AVII 55 ^ 59 ZulÌssigkeit <strong>von</strong> Vorhaben nach Bauplanungs- u. Bauordnungsrecht<br />
Die vertragliche Neuordnung der GrundstÏcksverhÌltnisse als Alternative einer gesetzlichen<br />
Umlegung ist in zahlreichen Varianten mÎglich. Bei den genannten Modellen handelt<br />
es sich lediglich um zwei ,,Grundverfahrensweisen``, <strong>die</strong> in der Praxis hÌufig auch gemischt<br />
auftreten. Bei vielen Vertragsgestaltungen verfolgen <strong>die</strong> Kommunen nicht nur das<br />
Ziel einer Neuordnung der GrundstÏcksverhÌltnisse im Sinne des § 11 I 2 Nr.1 BauGB,<br />
sondern gleichzeitig boden- und sozialpolitische Ziele im Sinne des § 11 I 2 Nr. 2 BauGB,<br />
beispielsweise um bestimmte FlÌchen zu gÏnstigen Preisen fÏr Einheimische oder den<br />
sozialen Wohnungsbau bereitstellen zu kÎnnen vgl. Dieterich, Baulandumlegung, Rdn.<br />
474 ff.; Bunzel, 49 ff.; Burmeister, 63 ff.).<br />
aa) Gemeindlicher Grunderwerb. Beim ersten Grundmodell erwirbt <strong>die</strong> Gemeinde vor Beginn<br />
eines Bauleitplanverfahrens entweder selbst oder durch eine <strong>von</strong> ihr eingeschaltete<br />
Entwicklungsgesellschaft sÌmtliche im zukÏnftigen Plangebiet liegenden GrundstÏcke.<br />
Nach Abschluss der Planung werden <strong>die</strong> FlÌchen neu parzelliert und als Bauland verkauft.<br />
Wenn <strong>die</strong> GrundstÏcke bzw. GrundstÏcksteile zur Vorbereitung einer Bodenneuordnung<br />
<strong>von</strong> der Gemeinde gekauft werden, handelt es sich um Îffentlich-rechtliche stÌdtebauliche<br />
VertrÌge, denn hier Ïberlagert der Îffentliche Zweck <strong>die</strong> Bodenordnung)<strong>die</strong> an sich privatrechtlich<br />
einzustufenden GrunderwerbsvorgÌnge so stark, dass insgesamt <strong>von</strong> Îffentlich-rechtlichen<br />
VertrÌgen ausgegangen werden muss BVerwG NJW 1985, 989). Die Abgrenzung<br />
zwischen rein privatrechtlichen GrundstÏcksgeschÌften und Îffentlich-rechtlichen<br />
VertrÌgen der Gemeinde ist allerdings flieÞend. Solange und soweit sich eine Gemeinde<br />
im Vorfeld einer Bauleitplanung am privaten GrundstÏcksmarkt betÌtigt, handelt<br />
es sich um privatrechtliche GrundstÏckserwerbs- und GrundstÏcksverÌuÞerungsvertrÌge<br />
BVerwGE 92, 56 [64] = NJW 1993, 2695; Grziwotz, NVwZ 1996, 637 [639]).<br />
bb) Freiwillige Umlegung. Das zweite mÎgliche Modell einer vertraglichen GrundstÏcksneuordnung<br />
ist eine vertraglich vereinbarte freiwillige Umlegung in Anlehnung an das<br />
gesetzliche Umlegungsverfahren §§ 45 ff. BauGB). Die ZulÌssigkeit der freiwilligen Umlegungen<br />
war bereits vor der Regelung in § 11 I Nr.1 BauGB bzw. § 6 I 2 BauGB-MaÞnahmenG<br />
anerkannt vgl. BVerwG NJW 1985, 989). Der freiwilligen Umlegung liegt ein<br />
stÌdtebaulicher Vertrag zwischen den GrundstÏckseigentÏmern in einem Baugebiet und<br />
der Gemeinde zugrunde so genannter Umlegungsvertrag). Der Umlegungsvertrag ersetzt<br />
sÌmtliche Regelungen des gesetzlichen Umlegungsverfahrens. Neben der eigentlichen<br />
Bodenordnung sind weitere, darÏber hinausgehende Verpflichtungen der GrundstÏckseigentÏmer<br />
oder der Gemeinde im Umlegungsvertrag zu regeln, wie z. B. <strong>die</strong> Ûbertragung<br />
der fÏr Îffentliche Zwecke erforderlichen FlÌchen auf <strong>die</strong> Gemeinde, Regelungen<br />
Ïber <strong>die</strong> Verteilung der Kosten des Verfahrens einschlieÞlich der Planungskosten, der Vermessungskosten<br />
und der BeurkundungsgebÏhren)oder das Honorar eines eingeschalteten<br />
VerfahrenstrÌgers Bunzel, 56; zu weiteren Einzelheiten eines Umlegungsvertrages vgl.<br />
Birk, Rdn. 328 ff.). Die freiwillige Umlegung ist <strong>von</strong> der Grunderwerbsteuer nicht befreit,<br />
es besteht aber GebÏhrenfreiheit beim Grundbuchamt § 79 BauGB).<br />
Das freiwillige Umlegungsverfahren kann jedoch nur dann mit Erfolg praktiziert werden,<br />
wenn <strong>die</strong> GrundstÏckseigentÏmer einigungsfÌhig sind und durch <strong>die</strong> Kombination<br />
mit der Bauleitplanung bzw. i.V. m. besonderen Einigungs- und LÎsungsansÌtzen <strong>die</strong>se EinigungsfÌhigkeit<br />
erreicht werden kann. Dort, wo das Einigungspotenzial der GrundstÏckseigentÏmer<br />
nicht ausreicht, sollte das gesetzliche Verfahren gewÌhlt werden Birk,VBlBW<br />
1994, 7; Bunzel,55).<br />
Der Grundgedanke der freiwilligen Umlegung besteht darin, <strong>die</strong> notwendige Bodenordnung<br />
im Bezug auf eine bestimmte, im Regelfall im Bebauungsplan definierte Bebaubarkeit<br />
einschlieÞlich der dafÏr zur VerfÏgung zu stellenden Îffentlichen FlÌchen durch im Regelfall)einen<br />
Gesamtvertrag zu realisieren, der sÌmtliche <strong>von</strong> der Bodenordnung betroffenen<br />
GrundstÏcke umfasst. Es handelt sich um einen notariell zu beurkundenden Vertrag im<br />
Sinne des § 313 BGB, an dem alle EigentÏmer <strong>von</strong> GrundstÏcken im Gebiet der freiwilligen<br />
Umlegung beteiligt sind. Die Gemeinde nimmt in zwei Funktionen an demVertrag teil:<br />
18 Hoffmann EL 15