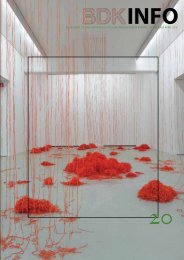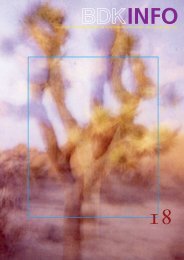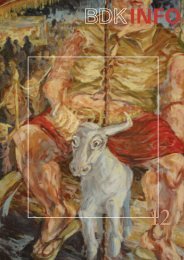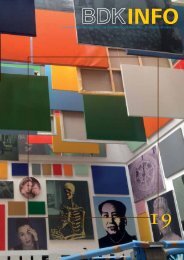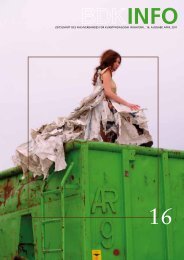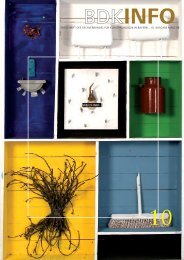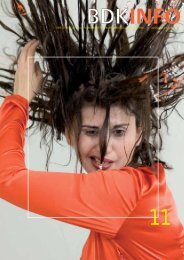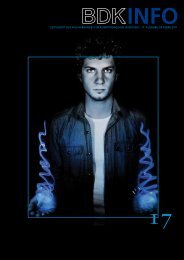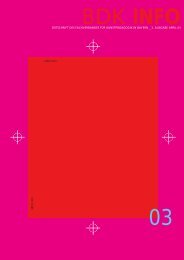Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Drehen der »hinzugedachten« Körper im Raum, wobei sich<br />
das rechte Bild als das gesuchte erweist. Eine solche Umformung<br />
von Vorstellungsbildern wird in der Kognitionspsychologie<br />
als »mentales Drehen« (mental rotation 13 ) bezeichnet,<br />
wozu Google TM mehr als achthunderttausend Einträge aufführt.<br />
Darunter sind auch Hinweise darauf, dass mathematisch<br />
hochbegabte Jugendliche sich weit besser als durchschnittlich<br />
begabte auf das mentale Drehen verstehen. <strong>14</strong><br />
Abb. 2: Ein Sehtest: In der untersten Zeile sind drei Würfelobjekte abgebildet.<br />
Zwei der Bilder zeigen dasselbe Objekt aus verschiedenen Perspektiven, ein drittes<br />
dessen spiegelsymmetrisches Gegenstück. Die Kugelobjekte darüber haben<br />
die gleiche räumliche Grobstruktur. Im Falle der Würfelobjekte ist leicht zu<br />
erkennen, welches Bild dem Gegenstück entspricht. Für die Kugelobjekte gelingt<br />
das nur Probanden, die zuvor körperliche Modelle der Testobjekte anfassen und<br />
hin und her bewegen konnten.<br />
Bei den Kugelbildern (Abbildung 2, mittlere und obere Zeile)<br />
ist es dagegen kaum möglich, das gesuchte Gegenstück herauszufinden.<br />
Das liegt nicht etwa an einer Schwierigkeit mit dem<br />
mentalen Drehen. Die räumliche Struktur der Kugelkörper<br />
bleibt wegen deren gekrümmter Konturen unbestimmt, so dass<br />
dem Versuch des mentalen Drehens ein verlässlicher Gegenstand<br />
fehlt. In den vielen früheren Untersuchungen zum<br />
mentalen Drehen ist das nicht bemerkt worden, weil sie sich<br />
besonders einfach strukturierter Testobjekte bedienten.<br />
Darüber hinaus sind die Versuchspersonen auch noch in<br />
unkontrollierter Weise mit den Testobjekten vertraut gemacht<br />
worden. Die Schwierigkeit der mentalen Rekonstruktion und<br />
damit das Verstehen, räumlicher Strukturen ist jedoch bei<br />
Bildern natürlicher Formen, Zeichnungen aus den Naturwissenschaften<br />
und der Technik 15 sowie Bildwerken der Kunst zuweilen<br />
sehr ausgeprägt.<br />
<strong>BDK</strong> <strong>INFO</strong> <strong>14</strong>/2010<br />
31<br />
Murchison River (Foto: Ingo Rentschler)<br />
S P E C I A L : K U N S T U N D G E H I R N<br />
Für die Frage nach der Erfindung der Form ist die Beobachtung<br />
aufschlussreich, dass auch die räumliche Struktur der<br />
Kugelkörper verständlich wird, wenn die Betrachter(innen)<br />
vor dem Sehtest körperliche Modelle dieser Objekte kurzzeitig<br />
anfassen und hin- und her wenden können (Abbildung 3). 16<br />
Das funktioniert selbst dann, wenn diese Modelle den Blicken<br />
der Versuchspersonen durch Augenbinden entzogen sind. Der<br />
Grund dafür ist in Untersuchungen klar geworden, bei denen<br />
mit Methoden der »Bildgebung« (brain imaging) die hirnphysiologischen<br />
Grundlagen des Sehtests aus Abbildung 2 aufgeklärt<br />
wurden. 17 Demnach hängt die mentale Rekonstruktion<br />
der Kugelkörper von Hirnfunktionen ab, die bei Säugern und<br />
Menschen die Orientierung der Körperbewegung und die<br />
Navigation im Raum ermöglichen. Über die Gleichartigkeit<br />
räumlicher Strukturen im Bild kann also durch bloßes mentales<br />
Drehen entschieden werden, wenn die Strukturen als solche<br />
vertraut sind. Handelt es sich dagegen um neuartige Strukturen,<br />
so ist für deren Begreifen im intellektuellen Sinn ein Lernprozess<br />
erforderlich, der das Begreifen körperlicher Objekte im<br />
motorischen Sinn einschließt.