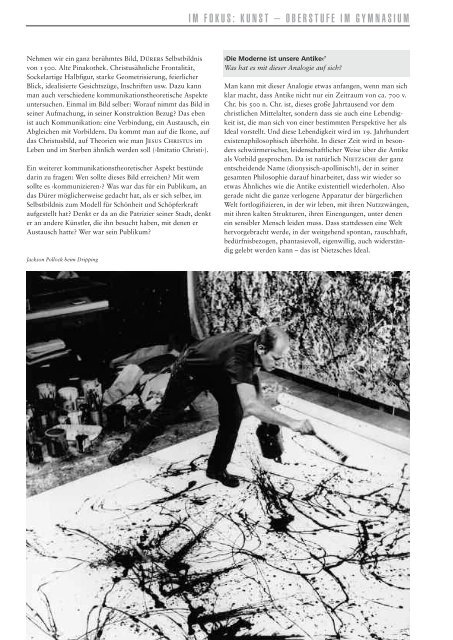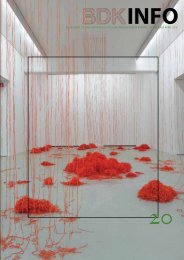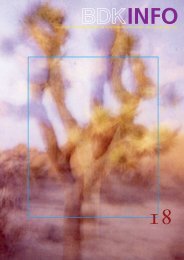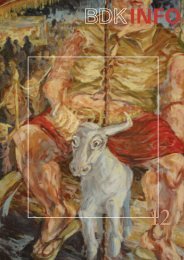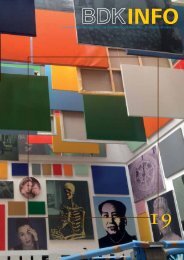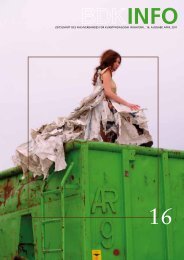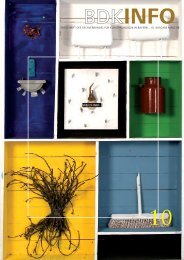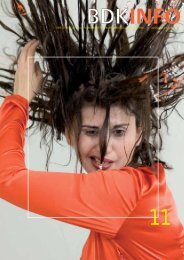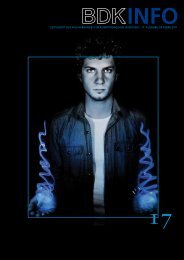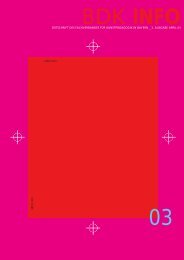Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Nehmen wir ein ganz berühmtes Bild, Dürers Selbstbildnis<br />
von 1500. Alte Pinakothek. Christusähnliche Frontalität,<br />
Sockelartige Halbfigur, starke Geometrisierung, feierlicher<br />
Blick, idealisierte Gesichtszüge, Inschriften usw. Dazu kann<br />
man auch verschiedene kommunikationstheoretische Aspekte<br />
untersuchen. Einmal im Bild selber: Worauf nimmt das Bild in<br />
seiner Aufmachung, in seiner Konstruktion Bezug? Das eben<br />
ist auch Kommunikation: eine Verbindung, ein Austausch, ein<br />
Abgleichen mit Vorbildern. Da kommt man auf die Ikone, auf<br />
das Christusbild, auf Theorien wie man Jesus Christus im<br />
Leben und im Sterben ähnlich werden soll (›Imitatio Christi‹).<br />
Ein weiterer kommunikationstheoretischer Aspekt bestünde<br />
darin zu fragen: Wen sollte dieses Bild erreichen? Mit wem<br />
sollte es ›kommunizieren‹? Was war das für ein Publikum, an<br />
das Dürer möglicherweise gedacht hat, als er sich selber, im<br />
Selbstbildnis zum Modell für Schönheit und Schöpferkraft<br />
aufgestellt hat? Denkt er da an die Patrizier seiner Stadt, denkt<br />
er an andere Künstler, die ihn besucht haben, mit denen er<br />
Austausch hatte? Wer war sein Publikum?<br />
Jackson Pollock beim Dripping<br />
<strong>BDK</strong> <strong>INFO</strong> <strong>14</strong>/2010<br />
I M F O K U S : K U N S T – O B E R S T U F E I M G Y M N A S I U M<br />
41<br />
›Die Moderne ist unsere Antike‹ 7<br />
Was hat es mit dieser Analogie auf sich?<br />
Man kann mit dieser Analogie etwas anfangen, wenn man sich<br />
klar macht, dass Antike nicht nur ein Zeitraum von ca. 700 v.<br />
Chr. bis 500 n. Chr. ist, dieses große Jahrtausend vor dem<br />
christlichen Mittelalter, sondern dass sie auch eine Lebendigkeit<br />
ist, die man sich von einer bestimmten Perspektive her als<br />
Ideal vorstellt. Und diese Lebendigkeit wird im 19. Jahrhundert<br />
existenzphilosophisch überhöht. In dieser Zeit wird in besonders<br />
schwärmerischer, leidenschaftlicher Weise über die Antike<br />
als Vorbild gesprochen. Da ist natürlich Nietzsche der ganz<br />
entscheidende Name (dionysisch-apollinisch!), der in seiner<br />
gesamten Philosophie darauf hinarbeitet, dass wir wieder so<br />
etwas Ähnliches wie die Antike existentiell wiederholen. Also<br />
gerade nicht die ganze verlogene Apparatur der bürgerlichen<br />
Welt fortlogifizieren, in der wir leben, mit ihren Nutzzwängen,<br />
mit ihren kalten Strukturen, ihren Einengungen, unter denen<br />
ein sensibler Mensch leiden muss. Dass stattdessen eine Welt<br />
hervorgebracht werde, in der weitgehend spontan, rauschhaft,<br />
bedürfnisbezogen, phantasievoll, eigenwillig, auch widerständig<br />
gelebt werden kann – das ist Nietzsches Ideal.