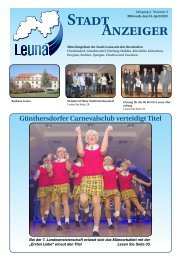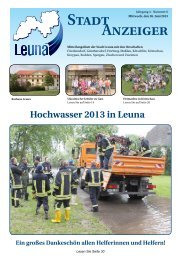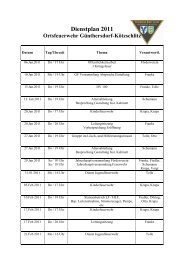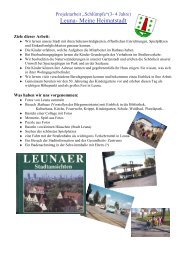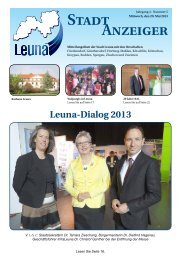Leunaer Stadtanzeiger - Ausgabe 03/12 - Stadt Leuna
Leunaer Stadtanzeiger - Ausgabe 03/12 - Stadt Leuna
Leunaer Stadtanzeiger - Ausgabe 03/12 - Stadt Leuna
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Zur Premiere<br />
Nr. 3/20<strong>12</strong> | 44<br />
des Schauspiels „Von morgens bis mitternachts“<br />
von Georg Kaiser am Leipziger Centraltheater<br />
Von DIETER BEER<br />
In Georg Kaisers expressionistischem Drama „Von morgens bis<br />
mitternachts“ aus dem Jahre 19<strong>12</strong> geht es um den schnöden<br />
Mammon. Weswegen ein biederer kleiner Kassierer seine Bank<br />
um 60 000 Mark erleichtert und damit ausbricht aus der ihn<br />
umgebenden kleinbürgerlichen Enge, um das wirkliche Leben<br />
zu suchen.<br />
„Von morgens bis mitternachts“ ist ein Stationenstück. Für die<br />
Inszenierung von Christiane Pohle am Leipziger Centraltheater<br />
entwarf Maria-Alice Bahra eine weit in den Zuschauerraum reichende<br />
Schräge, ohne die einzelnen Handlungsorte gesondert<br />
zu kennzeichnen. Im Hintergrund der Bühne befindet sich das<br />
Schalterhäuschen mit dem Fenster für den Kassierer, der namenlos<br />
ist und die Hauptperson in diesem Stück.<br />
Bereits hier verwendet die Regisseurin groteske Ausdrucksmittel,<br />
die dem Stück durchaus dienlich sind. Eine schöne Dame<br />
aus Florenz möchte 3 000 Mark auf der Bank abheben. Den<br />
Mann hinter dem Schalterfenster fasziniert sie derart, dass er<br />
mit ihr bekannt werden und, mit Beuteln voller gestohlenem<br />
Geld, fliehen möchte. Doch er kann zunächst nicht zu ihr gelangen.<br />
Er kommt sich wie eingemauert vor, gestikuliert aufgeregt<br />
und zerstört letztlich die Einrichtung, um zu entkommen.<br />
Dieses stimmige Bild zeigt symbolhaft die Richtung der<br />
Inszenierung an. Denn die kleinbürgerliche Enge, der besagter<br />
Familienvater entfliehen will, äußert sich schon durch seine<br />
stereotype Arbeit. Hinzu kommt die langweilige Atmosphäre in<br />
der Familie. Da sind Mutter, Frau und zwei Töchter, eine spielt<br />
auf dem Klavier die Tannhäuser-Ouvertüre von Richard Wagner.<br />
Die Fragerei nach dem Musikstück wird lustvoll wiederholt, obwohl<br />
es so nicht im Text steht. Das von Christiane Pohle angewandte<br />
Stilmittel kommt auch treffend zum Ausdruck, wenn die<br />
Familienmitglieder wie aufgescheuchte Hühner losrennen, um<br />
im Atlas nachzuschauen, wo genau die vermögende Italienerin<br />
wohnt. Das alles ist für den Zuschauer einsehbar und amüsant<br />
zugleich. Zumal durch diese körpersprachliche Darstellung die<br />
Eintönigkeit, unter welcher der Protagonist des Stücks leidet,<br />
transparent gemacht wird..<br />
Was danach in dieser ohne Pause gespielten zweieinhalbstündigen<br />
Aufführung folgte, war jedoch nicht mehr so spannend<br />
und auch nicht immer verständlich. Da gewann man leider<br />
zwiespältige Eindrücke. Zum Beispiel die Szene im Sportpalast.<br />
Dort stiftet der ausgebrochene Kassierer beim Sechstagerennen<br />
das Preisgeld und genießt den Rausch der Menge. In<br />
dessen Namen kündigt „ein Herr“ die jeweilige Höhe des Betrages<br />
für die Sieger an. Doch der joviale Spender verweigert dann<br />
das Geld und macht sich aus dem Staub. Meiner Meinung nach<br />
ist hier die Atmosphäre szenisch nicht überzeugend herübergekommen.<br />
Aus diesem Grunde erinnerte ich mich an die letzte<br />
Leipziger Inszenierung dieses Georg-Kaiser-Stücks Mitte der<br />
1990iger Jahre in der damaligen „Neuen Szene“ in der Regie<br />
von Wolfgang Engel. Dort hatte nämlich Bühnenbildner Horst<br />
Vogelgesang den großartigen Einfall, eine im Raum schwebende<br />
Scheibe zu entwerfen, auf die Sequenzen vom Sechstagerennen<br />
projiziert wurden. - Die Schauspieler werden stark gefordert<br />
an diesem Abend. Körpersprachlich intensiv spielt Guido<br />
Lambrecht den Bankkassierer, der nach seiner Odyssee zu der<br />
Feststellung gelangt: „Das Geld ist der armseligste Schwindel<br />
unter allem Betrug!“ Er ragt genauso aus dem Ensemble heraus<br />
wie Birgit Unterweger, die mehrere Rollen gestaltet. Mit<br />
achtungsvollem Engagement wirken außerdem Matthias Hummitzsch,<br />
Andreas Keller, Günther Harder, Zenzi Huber und Mareike<br />
Beykirch mit. Seitens des Publikums, das der Premiere<br />
sehr aufmerksam folgte, gab es freundlichen Beifall.<br />
Die nächsten Vorstellungen: am 31. März und am 7. April,<br />
jeweils um 19.30 Uhr<br />
Kartentelefon: <strong>03</strong> 41/<strong>12</strong> 68 -1 68<br />
<strong><strong>Leuna</strong>er</strong> <strong><strong>Stadt</strong>anzeiger</strong><br />
1000 Jahre Schladebach<br />
Teil III. Die Tiefenbohrung Schladebach 1880 - 86<br />
Im Jahre 1880 nahm die Königlich Preußische Bergwerksverwaltung<br />
eine Tiefenbohrung in Schladebach zu Zwecken der<br />
geognostischen Landesuntersuchung auf. Diese Bohrung sollte<br />
zur damals tiefsten der Erde werden. Zum einen sollte diese<br />
Bohrung den Ursprung der Solequelle nachweisen, von welcher<br />
die Saline Dürrenberg gespeist wird. Andererseits wollte man<br />
aber auch den sogenannten Leipziger Grauwackesattel, bzw.<br />
dessen karbonische Sedimente, auf eine Steinkohleführung untersuchen.<br />
Geleitet wurden die Arbeiten von dem Bohringenieur,<br />
Oberbergrat und Oberinspektor Karl Köbrich (1843 - 1893). Die<br />
Bohranlagen wurden innerhalb von 10 Wochen auf dem Gelände<br />
neben der Schäferei der Domäne Schladebach, südwestlich<br />
des Dorfes, errichtet. Dazu baute man ein 27 m hohes hölzernes<br />
Bohrgerüst, ein Aufenthaltsgebäude für den Bohrmeister und<br />
die Bohrmannschaft sowie eine kleine Schmiede. Angetrieben<br />
wurde die Bohranlage von einer stationären dampfgetriebenen<br />
Lokomobile der Firma Wolf mit nur 25 PS Leistung. Die lange<br />
Aufbauzeit war durch die Einführung der neuen Bohrtechnik<br />
des modernen Meißelstoß- und Diamantdrehbohrverfahrens begründet.<br />
Die Bohrarbeiten begannen am 16. August 1880. Sie<br />
waren in den nächsten Jahren aber geprägt von so manchen<br />
Schwierigkeiten. Es gab zahlreiche Havarien und technische<br />
Probleme durch Gestängebrüche, deshalb mussten immer wieder<br />
die Arbeiten eingestellt werden. Große Streckenabschnitte<br />
mussten nachgebohrt werden, sehr komplizierte Fangarbeiten<br />
sind erforderlich gewesen. So war man zum Beispiel Anfang<br />
1881 ganze 18 Tage mit dem heraus fräsen eines verklemmten<br />
Bohrinstrumentes in 250 m Tiefe beschäftigt. Nach 175,52 m erreichter<br />
Teufe ging man am 13. Oktober 1880 von der Stoß- zur<br />
Diamantbohrung über. Die Diamantkrone hatte einen Durchmesser<br />
von 210 mm. Durch den natürlichen Verlust durch Abnutzung<br />
hatte man bis zur Einstellung der Bohrarbeiten Diamanten im<br />
Wert von 100 000 Reichsmark verbraucht. Am 11. November<br />
1882 waren schon 734,60 m erreicht, bis zum Juni 1883 stellte<br />
man daraufhin die Arbeiten erst einmal ein. Nach der Wiederaufnahme<br />
wurden bis zum Ende des Jahres 1883 1080,80 m Teufe<br />
niedergebracht. Nach etlichen weiteren technischen Zwischenfällen<br />
waren dann ziemlich schnell bis 1885 1724,20 m erreicht.<br />
Im Verlauf des Jahres 1885 wurden umfangreiche Untersuchungen<br />
und Erdtemperaturmessungen vorgenommen, in dieser Zeit<br />
konnte nicht weiter gebohrt werden. Schon nach Erreichen einer<br />
Tiefe von 1630 m wurde die Hoffnung aufgegeben noch auf<br />
ein Steinkohlenlager zu stoßen. Dennoch wurden die Arbeiten<br />
nicht eingestellt, denn mit dieser Tiefe war schon der bisherige<br />
Tiefenrekord von 1338 m von Lieth bei Elmshorn an der Unter-<br />
Elbe überschritten. In Anbetracht dieser ungewöhnlichen Tiefe<br />
und dem in der Fachwelt erregten Interesse bohrte man rein aus<br />
technischen und wissenschaftlichen Gründen weiter. Die Rotation<br />
des gesamten Bohrgestänges soll, laut Oberbergrat Köbrich,<br />
spielend leicht gegangen sein und sich durch einen ruhigen sowie<br />
leisen Lauf ausgezeichnet haben. Mit regelbaren 50 - 180 Umdrehungen<br />
in der Minute schnitt sich die Bohrkrone immer tiefer<br />
in die Erde. Nach dieser erwähnten achten Röhrentour begannen<br />
am 5. Februar 1886 die letzten Bohrarbeiten. Bis zum 13. März<br />
1886 wurde ohne Störung weiter gebohrt, an diesem Tag waren<br />
dann 1748,40 m erreicht. Zwei Tage später trat ein komplizierter<br />
Gestängebruch ein bei dem etwa 500 m Bohrgestänge und Krone<br />
im Bohrloch verblieben. In mehreren Anläufen versuchte man<br />
durch Fangarbeiten die Krone frei zubekommen, was aber bis<br />
zum <strong>12</strong>. Juni 1886 nicht gelang. Daraufhin wurden die Arbeiten<br />
endgültig eingestellt. Mit den 1748,40 m Teufe in sechs Jahren<br />
ist ein neuer Tiefenweltrekord erreicht worden. Insgesamt wurde<br />
<strong>12</strong>47 Tage gebohrt, was eine tägliche Bohrleistung von 1,40 m<br />
entspricht. Die Gesamtkosten beliefen sich auf 2<strong>12</strong> 304 Mark,<br />
also <strong>12</strong>1,43 Mark pro Meter. Der Rekord hatte bis 1893 Bestand,<br />
dann wurde er von der Bohrung bei Paruschowitz in Oberschlesien<br />
übertroffen.