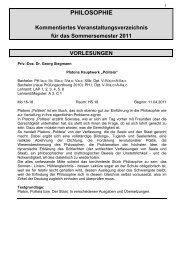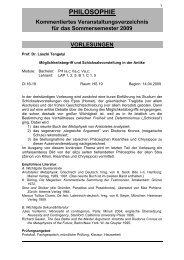Wunsch_2012 - Das Lebendige bei Heidegger - Philosophie
Wunsch_2012 - Das Lebendige bei Heidegger - Philosophie
Wunsch_2012 - Das Lebendige bei Heidegger - Philosophie
- Keine Tags gefunden...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
ten Privationsbegriffs des Entbehrens zu erläutern. Dies mag auch in der Tat <strong>Heidegger</strong>s Motivfür die Wahl der streng privativen Bestimmung der Weltarmut gewesen sein. Allerdings istdiese Wahl nicht alternativlos. Um die Fälle des Nicht-Habens von Welt <strong>bei</strong> Steinen und Tierenbegrifflich zu unterscheiden, ist man keineswegs zu der Einschätzung gezwungen, dassTiere in dem Sinne keine Welt haben, dass sie sie entbehren. Wie man seiner Vorlesung entnehmenkann, verschließt sich auch <strong>Heidegger</strong> selbst dieser Einsicht nicht ganz. In einer sorgfältigenphänomenologischen Analyse zeigt er, dass dem Stein „das, worunter er auch vorhandenist, wesenhaft nicht zugänglich ist“ (GA 29/30, 290). Es ist zwar richtig, wenn <strong>Heidegger</strong>dann feststellt, dass der Stein aufgrund dieser wesenhaften „Zugangslosigkeit“ „überhauptnicht entbehren kann“ (ebd.); der springende Punkt ist aber, dass sich der Stein aufgrund dieserZugangslosigkeit in jedem Fall vom Tier unterscheidet, das heißt unabhängig davon, obdieses als Welt entbehrend konzipiert wird oder nicht. Denn die Seinsart des Tiers, „die wirdas ‚Leben‘ nennen, ist nicht zugangslos zu dem, was auch noch neben ihm ist, worunter esals seiendes Lebewesen vorkommt“ (ebd., 292).Geht nun aber, wenn Tieren auf diese Weise Zugang zu Seiendem zugesprochen wird,nicht der Ausgangsgedanke verloren, dass Tiere keine Welt haben? Dafür dass dies keineswegsder Fall sein muss, steht exemplarisch Jakob Johann von Uexküll, dessen Überlegungenzum Umweltbegriff in den verschiedenen philosophisch-anthropologischen Ansätzen <strong>bei</strong> MaxScheler, Helmuth Plessner und Arnold Gehlen eine wichtige Rolle spielen. Tiere haben zwarkeine Welt, leben aufgrund ihres Bauplans aber in einer artspezifischen Umwelt. Auch <strong>Heidegger</strong>greift Uexkülls Gedanken auf: „Man sagt, […] das Tier hat seine Umwelt und bewegtsich in ihr. <strong>Das</strong> Tier ist in seiner Umwelt in der Dauer seines Lebens wie in einem Rohr, dassich nicht erweitert und verengt, eingesperrt.“ (GA 29/30, 292) Mit der Rede vom Eingesperrtseinbringt <strong>Heidegger</strong> hier zwar erneut seine Position zum Ausdruck, das Nicht-Habenvon Welt (in der Gestalt des Habens einer Umwelt) sei durch eine strikte Privationsbestimmung(‚Freiheitsberaubung‘) gekennzeichnet; eine derartige Bestimmung gehört aber nichtzum Begriff der Umwelt als solchem. 16 Der Umweltgedanke erlaubt es, die Beschaffenheitdes Zugangs der Tiere zu Seiendem von der unseres Zugangs zu Seiendem zu unterscheiden.Ihr Zugang ist umwelt- oder umgebungsgebunden, während unserer weltoffen (Scheler) oder16<strong>Heidegger</strong> selbst räumt dies implizit ein, indem er Uexkülls Umweltbegriff von seinem eigenen Begriffdes „Enthemmungsrings“ her interpretiert. Er erklärt, das Tier sei von solchem umringt, das sein „Fähigsein‚angeht‘, an-läßt“ (GA 29/30, 369). Er nennt dieses Anlassen des Fähigseins des Tieres ‚Enthemmen‘(ebd.) und den Umring, „innerhalb dieses oder jenes Enthemmende enthemmen kann“, den„Enthemmungsring“ des Tiers, der zu seiner „innersten Organisation“ gehört (ebd., 370 f.) und „eine ganzbestimmte Umringung möglicher Reizbarkeit“ festlegt (ebd., 374). In <strong>Heidegger</strong>s Auffassung meintUexkülls Ausdruck ‚Umwelt‘ „faktisch nichts anderes als das, was wir als Enthemmungsringgekennzeichnet haben“ (ebd., 383).12