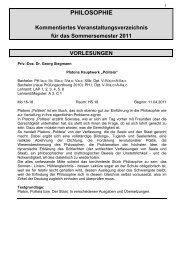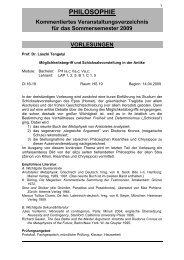Wunsch_2012 - Das Lebendige bei Heidegger - Philosophie
Wunsch_2012 - Das Lebendige bei Heidegger - Philosophie
Wunsch_2012 - Das Lebendige bei Heidegger - Philosophie
- Keine Tags gefunden...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Vor dem Hintergrund einer Reflexion auf den damaligen Stand der Wissenschaften vomLeben 12 nimmt <strong>Heidegger</strong> in der Zugänglichkeitsfrage nun erstmals von der PrivationstheseAbstand. Er stellt fest, „daß alle Disziplinen, die vom <strong>Lebendige</strong>n handeln, heute in einermerkwürdigen Umbildung begriffen sind, deren Grundtendenz dahin geht, dem Leben sein eigenständigesRecht zurückzugeben. <strong>Das</strong> ist nicht ohne weiteres selbstverständlich und leicht,wie die ganze Geschichte des Problems zeigt. In der ganzen Geschichte des Lebensproblemskönnen wir beobachten, daß versucht wird, das Leben, d. h. die Seinsart von Tier und Pflanze,vom Menschen her zu deuten, oder andererseits das Leben zu erklären mit Hilfe der Gesetzesvorgänge,die wir der materiellen Natur entnehmen.“ (GA 29/30, 282) <strong>Das</strong> Zitat liest sich wieeine Selbstkritik von Sein und Zeit. Denn dort war es <strong>Heidegger</strong> selbst, der sich mit der Privationsthesefür die Interpretation der Seinsart des Lebens vom Menschen (<strong>Das</strong>ein) her aussprach.Es sieht so aus, als erschiene ihm dieses Vorgehen nun ebenso unangemessen wie daseines Physikalismus, der glaubt, dass sich biologische Vorgänge vollständig auf physikalischeGesetze zurückführen lassen. Sich gegen <strong>bei</strong>de Ansätze abgrenzend, formuliert <strong>Heidegger</strong> dennun offenbar von ihm favorisierten Zugang: „Was <strong>bei</strong> alldem fehlt, ist der entschlossene Versuchund die Einsicht in die notwendige Aufgabe, das Leben von sich selbst her in seinemWesensgehalt primär zu sichern.“ 13 Indem <strong>Heidegger</strong> eine Ontologie des Lebens damit auf direkteWeise – vom Leben selbst her – projektiert und nicht im Umweg über eine existenzialeAnalytik des <strong>Das</strong>eins, scheint er die Privationsthese hinter sich gelassen zu haben.Im Fortgang der Vorlesung stellt sich allerdings heraus, dass <strong>Heidegger</strong>s methodischeÜberlegungen komplexer und spannungsreicher sind als die Eindeutigkeit des bisher Skizziertenvermuten lässt. Im Zentrum seiner Untersuchung der Lebendigkeit des <strong>Lebendige</strong>n steht,wie erwähnt, die These der Weltarmut des Tiers. „Weltarmut“ selbst ist aber eine privativeBestimmung. Sie scheint nur von der Fülle aus Sinn zu machen, die zur Welthaftigkeit oder„Weltbildung“ gehört, wie sie <strong>Heidegger</strong> zufolge für den Menschen charakteristisch ist. Zwarwehrt <strong>Heidegger</strong> ein Verständnis ab, in dem die Differenz zwischen der Weltarmut des Tiersund der Weltbildung des Menschen mit Hilfe von Gradunterschieden etwa auf einer Vollkommenheitsskalakonzipiert wird (GA 29/30, 284 ff.); sein Ziel ist da<strong>bei</strong> aber nicht, den privativenCharakter von „Weltarmut“ zu leugnen, sondern ihn in einem besonders radikalen Sinnzu betonen.12Die für <strong>Heidegger</strong> in diesem Zusammenhang maßgeblichen Autoren sind Hans Spemann, Hans Drieschund Jakob von Uexküll.13GA 29/30, 283. In der bisherigen philosophischen Diskussion hält <strong>Heidegger</strong> Max Scheler (<strong>bei</strong> allerKritik an dessen Stufenmodell) für denjenigen Philosophen, dessen Fragestellung am ehesten in dieseRichtung geht und da<strong>bei</strong> „in vielen Hinsichten wesentlich und allem Bisherigen überlegen“ ist (ebd.).8