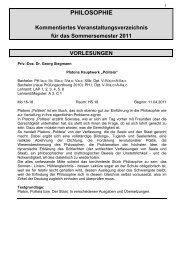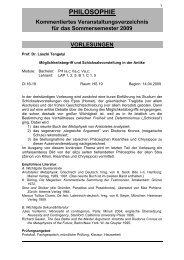Wunsch_2012 - Das Lebendige bei Heidegger - Philosophie
Wunsch_2012 - Das Lebendige bei Heidegger - Philosophie
Wunsch_2012 - Das Lebendige bei Heidegger - Philosophie
- Keine Tags gefunden...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
zen) lässt sich demnach mit dem Lebensbegriff beantworten. Diese Antwort wirft allerdingsneue Probleme auf. Sie ergeben sich aus <strong>Heidegger</strong>s Tendenz, ontologische Begriffe exklusivzu formulieren. <strong>Heidegger</strong>s Begriffe der Existenz und der Vorhandenheit sind insofern ungewöhnlich,als es aus seiner Sicht falsch wäre zu sagen, dass Steine existieren oder Menschen(<strong>Das</strong>ein) vorhanden sind. Mindestens ebenso ungewöhnlich wäre es aber, wenn der Begriffdes Lebens auf die tierische und die pflanzliche Seinsweise beschränkt bliebe. Denn dannwird, was sich von selbst versteht, unverständlich: dass Menschen Lebewesen sind oder <strong>Das</strong>einlebendig ist. Es fällt auf, dass <strong>Heidegger</strong> derartige Aussagen in der Tat vermeidet.Der Grund liegt darin, dass <strong>Heidegger</strong> befürchtet, die Wahl von „Leben“ als Ausgangspunktin der Bestimmung des Menschen lege ihn auf ein, wie ich es nennen möchte, anthropologisches‚Additionsmodell‘ fest, in dem Menschen als Lebewesen plus X konzipiert werden,wo<strong>bei</strong> das X je nach anthropologischem Ansatz mit Rationalität, Sprache, Sozialität,Transzendenz etc. belegt wird. <strong>Das</strong> <strong>Das</strong>ein, behauptet <strong>Heidegger</strong> gegen all diese Ansätze, „istontologisch nie so zu bestimmen, daß man es ansetzt als Leben – (ontologisch unbestimmt)und als überdies noch etwas anderes“ (SuZ 50). Aus <strong>Heidegger</strong>s Sicht müssen Additionsmodelledes Menschen in methodischer und ontologischer Hinsicht als verfehlt gelten. Mit dervon ihnen eingenommenen theoretischen Einstellung wird derjenige Ansatzpunkt übersprungen,der <strong>Heidegger</strong> zufolge allein sicherstellt, dass sich das <strong>Das</strong>ein „an ihm selbst von ihmselbst her zeigen kann“: das <strong>Das</strong>ein „in seiner durchschnittlichen Alltäglichkeit“ (ebd., 16).Die anthropologische Frage nach dem Wesen des Menschen hat, sofern sie es unterlässt, sichden Strukturen unserer praktischen Lebensvollzüge und des In-der-Welt-seins zuzuwenden,die unerlässliche Vorfrage nach dem Sein des Menschen vergessen und bleibt daher „in ihrenentscheidenden ontologischen Fundamenten unbestimmt“ (ebd., 49). Anders gesagt: Solangenicht das Sein des Menschen aufgeklärt wird, solange die ‚Komponenten‘, aus denen derMensch angeblich besteht, nicht existenzial bestimmt, sondern unreflektiert im Sinne der Vorhandenheitangesetzt werden, muss diesem jede Wesensbestimmung äußerlich bleiben. Ummit Sein und Zeit der „Bedürfnislosigkeit“ entgegenzuwirken, nach dem Sein desjenigen Seiendenzu fragen, das wir selbst sind, möchte <strong>Heidegger</strong> zur Bezeichnung dieses Seienden „dieAusdrücke ‚Leben‘ und ‚Mensch‘ […] vermeiden“ (ebd., 46).Resultat dieser Vermeidungstaktik ist, dass das Leben des <strong>Das</strong>eins in Sein und Zeitkaum thematisiert wird. 5 Wenn dort also vom Leben die Rede ist, wird es um die Seinsart des-Zuhandene: die Gebrauchsdinge im weitesten Sinne […]“ (GA 27, 71).5Ich werde auf die wenigen und zweifellos wichtigen Stellen, die es zum Leben des <strong>Das</strong>eins gibt und die inerster Linie den „Zusammenhang des Lebens“ (SuZ 373-375) sowie das Verhältnis von Leben und Todbetreffen (SuZ 246 f.), hier nicht gesondert eingehen können. Siehe dazu Kühn 1991 und Liebsch 1996.4