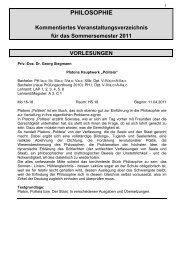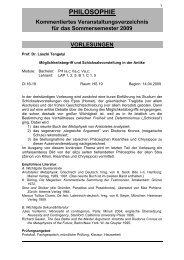Wunsch_2012 - Das Lebendige bei Heidegger - Philosophie
Wunsch_2012 - Das Lebendige bei Heidegger - Philosophie
Wunsch_2012 - Das Lebendige bei Heidegger - Philosophie
- Keine Tags gefunden...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
In dem hier verfolgten Problemzusammenhang ist <strong>Heidegger</strong>s Wesensaufklärung derWeltarmut des Tiers nicht um ihrer selbst willen, sondern vor allem mit Blick auf die Fragevon Interesse, inwieweit privative Bestimmungen für sie maßgeblich sind. Aus diesem Grundverdienen einige negative Formulierungen <strong>Heidegger</strong>s besondere Aufmerksamkeit: „<strong>Das</strong> Saugenan der Blüte ist nicht ein Sichverhalten zur Blüte als etwas Vorhandenem“ (ebd., 353);zum Sichbenehmen des Tieres gehört „kein Vernehmen des Honigs als eines Vorhandenen“(ebd., 354). Während <strong>Heidegger</strong> hier nur mit einfachen Abgrenzungen ar<strong>bei</strong>tet – dem Treibendes Tiers abspricht, was unser Denken und Handeln prägt: die Als-Struktur –, scheint er an einerspäteren Stelle eine strikte Privationsbestimmung ins Spiel zu bringen, indem er die Genommenheitdes Vernehmens als ein Strukturmoment der Benommenheit einführt: „Die Bieneist in all dem Treiben bezogen auf Futterstelle, Sonne, Stock, aber dieses Bezogensein daraufist kein Vernehmen des Genannten als Futterstelle, als Sonne und dergleichen […]. Es ist keinVernehmen, sondern ein Benehmen, ein Treiben, das wir so fassen müssen, weil dem Tier dieMöglichkeit des Vernehmens von etwas als etwas genommen ist, und zwar nicht jetzt undhier, sondern genommen im Sinne des ‚überhaupt nicht gegeben‘.“ (Ebd., 360; Hvh. v. mir;M. W.)Die zitierte Passage ist überaus problematisch und ambivalent. Denn erstens kann einemWesen, von der Wortbedeutung her argumentiert, nur das „genommen“ werden, was eshat. <strong>Das</strong> gilt offensichtlich auch für Möglichkeiten wie die des Vernehmens von etwas als etwas.Vor diesem Hintergrund erscheint es einfach unzutreffend, dass dem Tier diese Möglichkeitgenommen ist. Zweitens argumentiert <strong>Heidegger</strong>, dass wir das Treiben des Tiers nur deshalbals Benehmen fassen dürfen, weil dem Tier die Möglichkeit des Vernehmens genommenist. Auch dies erscheint falsch. Um das Treiben des Tiers als Benehmen zu fassen, wird dieAnnahme, dass ihm diese Möglichkeit genommen ist, nicht benötigt; es reicht aus, dass es sienicht hat. Drittens: Ihr Schillerndes erhält die zitierte Passage schließlich durch den Zusatz„[…] genommen im Sinne des ‚überhaupt nicht gegeben‘“. Die in ihm enthaltene Neubestimmungder Wortbedeutung von „Genommenheit“ hat den Anschein desWillkürlichen. Der Grund dafür ist inzwischen bekannt: Was einem „überhaupt nicht gegeben“ist, kann einem auch nicht genommen sein; man hat es einfach nicht.Sieht man von diesen Schwierigkeiten ab, so scheint es aber sinnvoll zu sein, dem Zusatz„[…] genommen im Sinne des ‚überhaupt nicht gegeben‘“ die Funktion zuzumessen, die„Genommenheit“, <strong>bei</strong> der es sich der Wortbedeutung nach um eine strikte Privationsbestimmunghandelt, rhetorisch in eine lose Privationsbestimmung zu transformieren. Denn <strong>Heidegger</strong>sAusführungen werden auf diese Weise nicht mit der These belastet, die Tiere seien der14