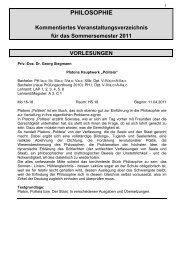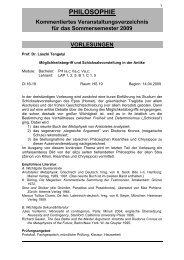Wunsch_2012 - Das Lebendige bei Heidegger - Philosophie
Wunsch_2012 - Das Lebendige bei Heidegger - Philosophie
Wunsch_2012 - Das Lebendige bei Heidegger - Philosophie
- Keine Tags gefunden...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
ens ontologisch zu bestimmen, vom <strong>Das</strong>ein Abstriche machen? Wenn dem so ist, wie lässtsich dann entscheiden, an welcher Stelle und in welchem Maße? Und gesetzt den Fall, dasssich hierüber Klarheit erzielen lässt, warum sollte dieses Vorgehen dem von <strong>Heidegger</strong> kritisiertentraditionellen Vorgehen der Anthropologie vorzuziehen sein? Wird nicht einfach dasfür unbefriedigend gehaltene Additionsmodell des Menschen durch ein ebenso unbefriedigendesSubtraktionsmodell des Lebewesens ersetzt, in dem tierisches oder pflanzliches Leben als<strong>Das</strong>ein minus X konzipiert wird?Vor dem Hintergrund dieser Probleme ist es interessant, dass <strong>Heidegger</strong> seine Privationsthesean einer Stelle von Sein und Zeit einzuschränken oder gar aufzugeben scheint: „Inder Ordnung des möglichen Erfassens und Auslegens ist die Biologie als ‚Wissenschaft vomLeben‘ in der Ontologie des <strong>Das</strong>eins fundiert, wenn auch nicht ausschließlich in ihr.“ 8 Währendder Beginn des Satzes der Privationsthese nahe steht, formuliert der von mir hervorgehobeneNachsatz eine wichtige Einschränkung: Die „Wissenschaft vom Leben“ ist nicht exklusivin der Ontologie des <strong>Das</strong>eins fundiert. Man kann dies je nach Betonung in dem eher harmlosenSinn verstehen, dass die „Wissenschaft vom Leben“ auch andere Fundamente als ontologischehat, d. h. ontische bzw. empirische, oder in dem stärkeren Sinn, dass diese Wissenschaftauch solche ontologischen Fundamente hat, die nicht aus der <strong>Das</strong>einsontologie stammen.Während der Nachsatz, sofern er im ersten, harmlosen Sinn genommen wird, ohne weiteresmit der Privationsthese verträglich ist, läuft ihr der stärkere Sinn des Nachsatzes zuwider.Warum? Da als ontologische Fundamente, die nicht aus der <strong>Das</strong>einsontologie stammen,nur solche einer Ontologie des Lebens in Frage kämen, müsste Leben dem auf diese Weise interpretiertenNachsatz zufolge auch auf anderem Wege ontologisch zu fassen sein als in reduktiverPrivation aus der Ontologie des <strong>Das</strong>eins. Dies widerspricht aber der Privationsthese. 9In Sein und Zeit lassen sich meines Erachtens keine direkten Belege finden, die die eine oderdie andere Lesart des genannten Nachsatzes erzwingen. Nach Maßgabe der Interpretationsmaximedes principle of charity ist es dann jedoch geboten, sich für die schwache Lesart zu ent-8SuZ 49 f.; Hvh. v. mir, M. W.9Auch Axel Beelmann erkennt die Relevanz des genannten Nachsatzes (Beelmann 1994, 47-49). Erübergeht allerdings die wichtige Differenz zwischen den hier unterschiedenen Lesarten. Daher sieht ernicht, dass der Nachsatz, wenn er strikt interpretiert wird, keinen „theoretischen Freiraum“ für diephilosophische Interpretation des Lebens (ebd., 48), sondern einen Widerspruch zur Privationsthesegeneriert, kann aber auch nicht auf die harmlose Lesart setzen, da der Umstand, dass die Biologie ontischbzw. empirisch fundiert ist, zu trivial ist, um Beelmanns anspruchsvolle Rede von einer „zweifache[n]Fundierung der Ontologie des ‚Lebens‘“ (ebd., 49) zu rechtfertigen. Meines Erachtens kann daher auchBeelmanns Einschätzung nicht überzeugen, dass hinsichtlich der methodischen Grundfragen einer<strong>Philosophie</strong> des „Lebens“ zwischen Sein und Zeit sowie <strong>Heidegger</strong>s späterer Vorlesung Die Grundbegriffeder Metaphysik Kontinuität bestehe.6