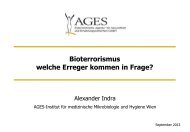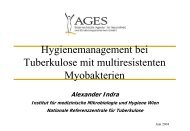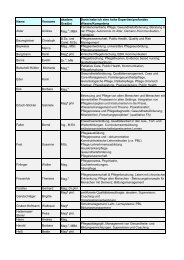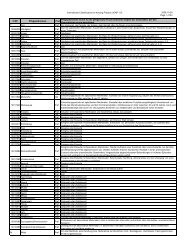Bernhard Viertler
Bernhard Viertler
Bernhard Viertler
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Theoretischer Hindergrund<br />
2.2.3 Folgen von Emotionsarbeit<br />
Zu den Folgen die sich aus geleisteter Emotionsarbeit ergeben gibt es unterschiedliche<br />
Ergebnisse. Wie bereits im vorigen Punkt erwähnt hat sich der von Hochschild (1983)<br />
postulierte einfache Zusammenhang zwischen Häufigkeit der geleisteten Emotionsarbeit und<br />
negativen Beanspruchungsfolgen für den Dienstleister nicht bestätigt. Als bedeutendste Größe<br />
in Verbindung von Emotionsarbeit und negativen Beanspruchungsfolgen gilt emotionale<br />
Dissonanz. Emotionale Dissonanz beschreibt die Anforderung an den Dienstleister bestimmte<br />
Emotionen zeigen zu müssen, die er momentan nicht fühlt (Zapf et al., 1999), was als<br />
belastend und anstrengend angesehen wird (Rastetter, 1999). Emotionale Dissonanz kann<br />
auch als ein Person-Rollen Konflikt bezeichnet werden, da die eigene erlebte<br />
Emotionsantwort nicht mit der Rollenerwartung in Bezug auf die zu zeigenden Emotionen<br />
übereinstimmt (Rafaeli & Sutton, 1987). Am besten belegt ist der Zusammenhang zwischen<br />
emotionaler Dissonanz und Aspekten von Burnout, wie z.B. emotionale Erschöpfung oder<br />
Depersonalisation (vgl. Zapf & Holz, 2006). Eine Erklärung aus Sicht der Interaktionstheorie<br />
(vgl. Côté, 2005) ist, dass emotionale Dissonanz ein sensitiver Indikator für unangenehme<br />
bzw. stressende Interaktionen (Badura, 1990) mit Klienten ist. Ein weiterer Erklärungsansatz<br />
stammt aus der Emotionsregulationstheorie bei der davon ausgegangen wird, dass<br />
Emotionsregulation psychische Kosten unweigerlich mit sich bringt (Gross, 1998). Die bereits<br />
erwähnten Möglichkeiten der Emotionsregulation, das Oberflächenhandeln bzw.<br />
Tiefenhandeln (siehe 2.2.1), wirken sich unterschiedlich auf emotionale Dissonanz aus<br />
(Glomb & Tews, 2004; Holman, Chissick & Totterdell, 2002). Tiefenhandeln wird von Zapf<br />
et al. (1999) als effektive Strategie angesehen mit dem beruflichen Stressor emotionaler<br />
Dissonanz umzugehen. Oberflächenhandeln hingegen steht in enger Verbindung zu negativen<br />
Auswirkungen der Emotionsarbeit (vgl. Zapf & Holz, 2006). In diesem Zusammenhang kann<br />
noch zwischen ‘faking in good faith’, entsteht wenn die Gefühlsregeln vom Arbeiter<br />
akzeptiert werden und in Form von Oberflächenhandeln umgesetzt werden, von ‘faking in bad<br />
faith’ unterschieden werden (Hochschild, 1983; Rafaeli & Sutton, 1987). Letzteres ist der<br />
Fall, wenn die vorgegebenen Gefühlsregeln nicht anerkannt werden. Diese Methode wird mit<br />
den stärksten negativen Konsequenzen in Verbindung gebracht (vgl. Zapf, 2002).<br />
Nach Hochschild (2006) besteht die Gefahr „zu einer immer weitergehenden Entfremdung<br />
vom eigenen Selbst, d.h. zu einer Verinnerlichung der Gefühlsnormen des Unternehmens“ (S.<br />
124). Diese entsteht dann, wenn Emotionen lange Zeit und unter großem Druck an die<br />
14