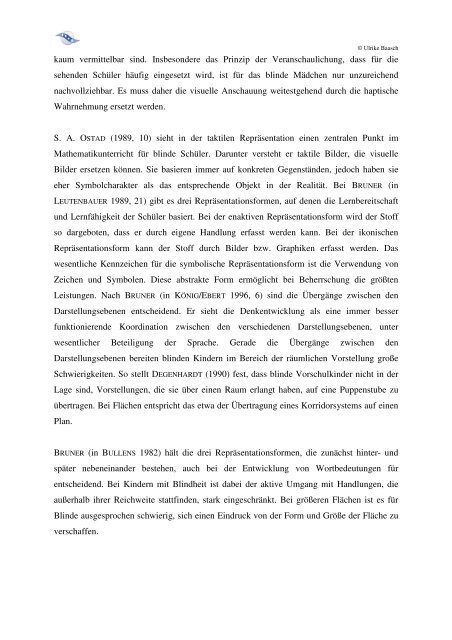Unsichtbare Geometrie - ISaR Projekt
Unsichtbare Geometrie - ISaR Projekt
Unsichtbare Geometrie - ISaR Projekt
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
© Ulrike Baasch<br />
kaum vermittelbar sind. Insbesondere das Prinzip der Veranschaulichung, dass für die<br />
sehenden Schüler häufig eingesetzt wird, ist für das blinde Mädchen nur unzureichend<br />
nachvollziehbar. Es muss daher die visuelle Anschauung weitestgehend durch die haptische<br />
Wahrnehmung ersetzt werden.<br />
S. A. OSTAD (1989, 10) sieht in der taktilen Repräsentation einen zentralen Punkt im<br />
Mathematikunterricht für blinde Schüler. Darunter versteht er taktile Bilder, die visuelle<br />
Bilder ersetzen können. Sie basieren immer auf konkreten Gegenständen, jedoch haben sie<br />
eher Symbolcharakter als das entsprechende Objekt in der Realität. Bei BRUNER (in<br />
LEUTENBAUER 1989, 21) gibt es drei Repräsentationsformen, auf denen die Lernbereitschaft<br />
und Lernfähigkeit der Schüler basiert. Bei der enaktiven Repräsentationsform wird der Stoff<br />
so dargeboten, dass er durch eigene Handlung erfasst werden kann. Bei der ikonischen<br />
Repräsentationsform kann der Stoff durch Bilder bzw. Graphiken erfasst werden. Das<br />
wesentliche Kennzeichen für die symbolische Repräsentationsform ist die Verwendung von<br />
Zeichen und Symbolen. Diese abstrakte Form ermöglicht bei Beherrschung die größten<br />
Leistungen. Nach BRUNER (in KÖNIG/EBERT 1996, 6) sind die Übergänge zwischen den<br />
Darstellungsebenen entscheidend. Er sieht die Denkentwicklung als eine immer besser<br />
funktionierende Koordination zwischen den verschiedenen Darstellungsebenen, unter<br />
wesentlicher Beteiligung der Sprache. Gerade die Übergänge zwischen den<br />
Darstellungsebenen bereiten blinden Kindern im Bereich der räumlichen Vorstellung große<br />
Schwierigkeiten. So stellt DEGENHARDT (1990) fest, dass blinde Vorschulkinder nicht in der<br />
Lage sind, Vorstellungen, die sie über einen Raum erlangt haben, auf eine Puppenstube zu<br />
übertragen. Bei Flächen entspricht das etwa der Übertragung eines Korridorsystems auf einen<br />
Plan.<br />
BRUNER (in BULLENS 1982) hält die drei Repräsentationsformen, die zunächst hinter- und<br />
später nebeneinander bestehen, auch bei der Entwicklung von Wortbedeutungen für<br />
entscheidend. Bei Kindern mit Blindheit ist dabei der aktive Umgang mit Handlungen, die<br />
außerhalb ihrer Reichweite stattfinden, stark eingeschränkt. Bei größeren Flächen ist es für<br />
Blinde ausgesprochen schwierig, sich einen Eindruck von der Form und Größe der Fläche zu<br />
verschaffen.