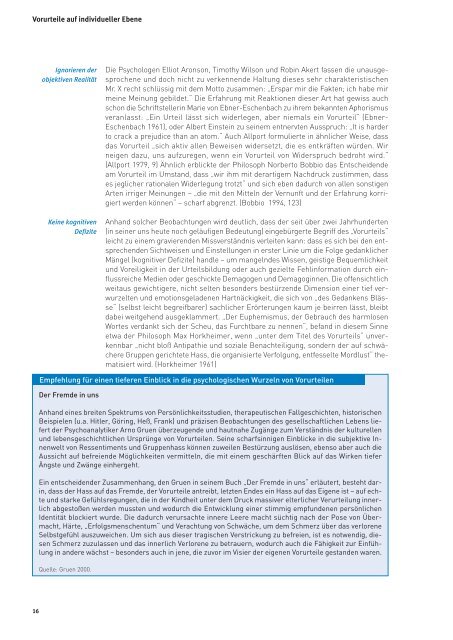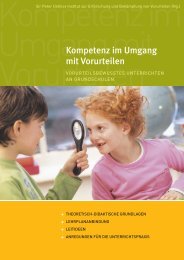theoretisch-didaktische grundlagen - Sir Peter Ustinov Institut
theoretisch-didaktische grundlagen - Sir Peter Ustinov Institut
theoretisch-didaktische grundlagen - Sir Peter Ustinov Institut
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Vorurteile auf individueller Ebene<br />
16<br />
Ignorieren der<br />
objektiven Realität<br />
Keine kognitiven<br />
Defizite<br />
Der Fremde in uns<br />
Die Psychologen Elliot Aronson, Timothy Wilson und Robin Akert fassen die unausgesprochene<br />
und doch nicht zu verkennende Haltung dieses sehr charakteristischen<br />
Mr. X recht schlüssig mit dem Motto zusammen: „Erspar mir die Fakten; ich habe mir<br />
meine Meinung gebildet.“ Die Erfahrung mit Reaktionen dieser Art hat gewiss auch<br />
schon die Schriftstellerin Marie von Ebner-Eschenbach zu ihrem bekannten Aphorismus<br />
veranlasst: „Ein Urteil lässt sich widerlegen, aber niemals ein Vorurteil“ (Ebner-<br />
Eschenbach 1961), oder Albert Einstein zu seinem entnervten Ausspruch: „It is harder<br />
to crack a prejudice than an atom.“ Auch Allport formulierte in ähnlicher Weise, dass<br />
das Vorurteil „sich aktiv allen Beweisen widersetzt, die es entkräften würden. Wir<br />
neigen dazu, uns aufzuregen, wenn ein Vorurteil von Widerspruch bedroht wird.“<br />
(Allport 1979, 9) Ähnlich erblickte der Philosoph Norberto Bobbio das Entscheidende<br />
am Vorurteil im Umstand, dass „wir ihm mit derartigem Nachdruck zustimmen, dass<br />
es jeglicher rationalen Widerlegung trotzt“ und sich eben dadurch von allen sonstigen<br />
Arten irriger Meinungen – „die mit den Mitteln der Vernunft und der Erfahrung korrigiert<br />
werden können“ – scharf abgrenzt. (Bobbio 1994, 123)<br />
Anhand solcher Beobachtungen wird deutlich, dass der seit über zwei Jahrhunderten<br />
(in seiner uns heute noch geläufigen Bedeutung) eingebürgerte Begriff des „Vorurteils“<br />
leicht zu einem gravierenden Missverständnis verleiten kann: dass es sich bei den entsprechenden<br />
Sichtweisen und Einstellungen in erster Linie um die Folge gedanklicher<br />
Mängel (kognitiver Defizite) handle – um mangelndes Wissen, geistige Bequemlichkeit<br />
und Voreiligkeit in der Urteilsbildung oder auch gezielte Fehlinformation durch einflussreiche<br />
Medien oder geschickte Demagogen und Demagoginnen. Die offensichtlich<br />
weitaus gewichtigere, nicht selten besonders bestürzende Dimension einer tief verwurzelten<br />
und emotionsgeladenen Hartnäckigkeit, die sich von „des Gedankens Blässe“<br />
(selbst leicht begreifbarer) sachlicher Erörterungen kaum je beirren lässt, bleibt<br />
dabei weitgehend ausgeklammert. „Der Euphemismus, der Gebrauch des harmlosen<br />
Wortes verdankt sich der Scheu, das Furchtbare zu nennen“, befand in diesem Sinne<br />
etwa der Philosoph Max Horkheimer, wenn „unter dem Titel des Vorurteils“ unverkennbar<br />
„nicht bloß Antipathie und soziale Benachteiligung, sondern der auf schwächere<br />
Gruppen gerichtete Hass, die organisierte Verfolgung, entfesselte Mordlust“ thematisiert<br />
wird. (Horkheimer 1961)<br />
Empfehlung für einen tieferen Einblick in die psychologischen Wurzeln von Vorurteilen<br />
Anhand eines breiten Spektrums von Persönlichkeitsstudien, therapeutischen Fallgeschichten, historischen<br />
Beispielen (u.a. Hitler, Göring, Heß, Frank) und präzisen Beobachtungen des gesellschaftlichen Lebens liefert<br />
der Psychoanalytiker Arno Gruen überzeugende und hautnahe Zugänge zum Verständnis der kulturellen<br />
und lebensgeschichtlichen Ursprünge von Vorurteilen. Seine scharfsinnigen Einblicke in die subjektive Innenwelt<br />
von Ressentiments und Gruppenhass können zuweilen Bestürzung auslösen, ebenso aber auch die<br />
Aussicht auf befreiende Möglichkeiten vermitteln, die mit einem geschärften Blick auf das Wirken tiefer<br />
Ängste und Zwänge einhergeht.<br />
Ein entscheidender Zusammenhang, den Gruen in seinem Buch „Der Fremde in uns“ erläutert, besteht darin,<br />
dass der Hass auf das Fremde, der Vorurteile antreibt, letzten Endes ein Hass auf das Eigene ist – auf echte<br />
und starke Gefühlsregungen, die in der Kindheit unter dem Druck massiver elterlicher Verurteilung innerlich<br />
abgestoßen werden mussten und wodurch die Entwicklung einer stimmig empfundenen persönlichen<br />
Identität blockiert wurde. Die dadurch verursachte innere Leere macht süchtig nach der Pose von Übermacht,<br />
Härte, „Erfolgsmenschentum“ und Verachtung von Schwäche, um dem Schmerz über das verlorene<br />
Selbstgefühl auszuweichen. Um sich aus dieser tragischen Verstrickung zu befreien, ist es notwendig, diesen<br />
Schmerz zuzulassen und das innerlich Verlorene zu betrauern, wodurch auch die Fähigkeit zur Einfühlung<br />
in andere wächst – besonders auch in jene, die zuvor im Visier der eigenen Vorurteile gestanden waren.<br />
Quelle: Gruen 2000.