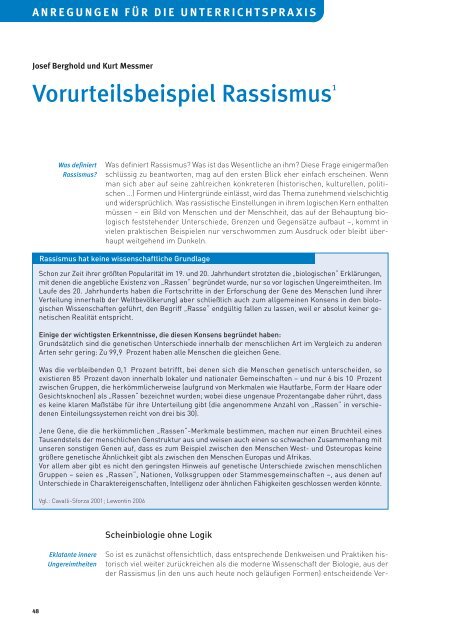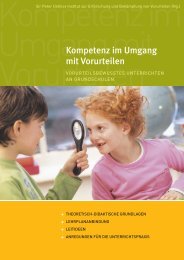theoretisch-didaktische grundlagen - Sir Peter Ustinov Institut
theoretisch-didaktische grundlagen - Sir Peter Ustinov Institut
theoretisch-didaktische grundlagen - Sir Peter Ustinov Institut
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
ANREGUNGEN FÜR DIE UNTERRICHTSPRAXIS<br />
Josef Berghold und Kurt Messmer<br />
Vorurteilsbeispiel Rassismus 1<br />
48<br />
Was definiert<br />
Rassismus?<br />
Eklatante innere<br />
Ungereimtheiten<br />
Was definiert Rassismus? Was ist das Wesentliche an ihm? Diese Frage einigermaßen<br />
schlüssig zu beantworten, mag auf den ersten Blick eher einfach erscheinen. Wenn<br />
man sich aber auf seine zahlreichen konkreteren (historischen, kulturellen, politischen<br />
…) Formen und Hintergründe einlässt, wird das Thema zunehmend vielschichtig<br />
und widersprüchlich. Was rassistische Einstellungen in ihrem logischen Kern enthalten<br />
müssen – ein Bild von Menschen und der Menschheit, das auf der Behauptung biologisch<br />
feststehender Unterschiede, Grenzen und Gegensätze aufbaut –, kommt in<br />
vielen praktischen Beispielen nur verschwommen zum Ausdruck oder bleibt überhaupt<br />
weitgehend im Dunkeln.<br />
Rassismus hat keine wissenschaftliche Grundlage<br />
Schon zur Zeit ihrer größten Popularität im 19. und 20. Jahrhundert strotzten die „biologischen“ Erklärungen,<br />
mit denen die angebliche Existenz von „Rassen“ begründet wurde, nur so vor logischen Ungereimtheiten. Im<br />
Laufe des 20. Jahrhunderts haben die Fortschritte in der Erforschung der Gene des Menschen (und ihrer<br />
Verteilung innerhalb der Weltbevölkerung) aber schließlich auch zum allgemeinen Konsens in den biologischen<br />
Wissenschaften geführt, den Begriff „Rasse“ endgültig fallen zu lassen, weil er absolut keiner genetischen<br />
Realität entspricht.<br />
Einige der wichtigsten Erkenntnisse, die diesen Konsens begründet haben:<br />
Grundsätzlich sind die genetischen Unterschiede innerhalb der menschlichen Art im Vergleich zu anderen<br />
Arten sehr gering: Zu 99,9 Prozent haben alle Menschen die gleichen Gene.<br />
Was die verbleibenden 0,1 Prozent betrifft, bei denen sich die Menschen genetisch unterscheiden, so<br />
existieren 85 Prozent davon innerhalb lokaler und nationaler Gemeinschaften – und nur 6 bis 10 Prozent<br />
zwischen Gruppen, die herkömmlicherweise (aufgrund von Merkmalen wie Hautfarbe, Form der Haare oder<br />
Gesichtsknochen) als „Rassen“ bezeichnet wurden; wobei diese ungenaue Prozentangabe daher rührt, dass<br />
es keine klaren Maßstäbe für ihre Unterteilung gibt (die angenommene Anzahl von „Rassen“ in verschiedenen<br />
Einteilungssystemen reicht von drei bis 30).<br />
Jene Gene, die die herkömmlichen „Rassen“-Merkmale bestimmen, machen nur einen Bruchteil eines<br />
Tausendstels der menschlichen Genstruktur aus und weisen auch einen so schwachen Zusammenhang mit<br />
unseren sonstigen Genen auf, dass es zum Beispiel zwischen den Menschen West- und Osteuropas keine<br />
größere genetische Ähnlichkeit gibt als zwischen den Menschen Europas und Afrikas.<br />
Vor allem aber gibt es nicht den geringsten Hinweis auf genetische Unterschiede zwischen menschlichen<br />
Gruppen – seien es „Rassen“, Nationen, Volksgruppen oder Stammesgemeinschaften –, aus denen auf<br />
Unterschiede in Charaktereigenschaften, Intelligenz oder ähnlichen Fähigkeiten geschlossen werden könnte.<br />
Vgl.: Cavalli-Sforza 2001; Lewontin 2006<br />
Scheinbiologie ohne Logik<br />
So ist es zunächst offensichtlich, dass entsprechende Denkweisen und Praktiken historisch<br />
viel weiter zurückreichen als die moderne Wissenschaft der Biologie, aus der<br />
der Rassismus (in den uns auch heute noch geläufigen Formen) entscheidende Ver-