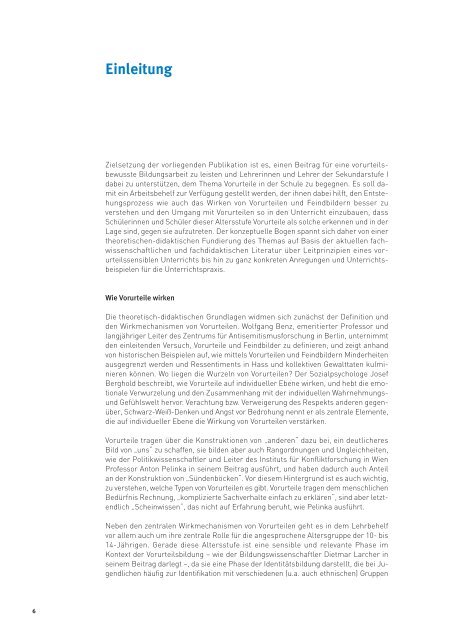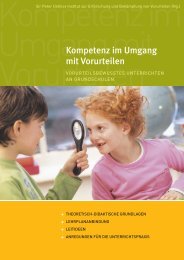theoretisch-didaktische grundlagen - Sir Peter Ustinov Institut
theoretisch-didaktische grundlagen - Sir Peter Ustinov Institut
theoretisch-didaktische grundlagen - Sir Peter Ustinov Institut
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
6<br />
Einleitung<br />
Zielsetzung der vorliegenden Publikation ist es, einen Beitrag für eine vorurteilsbewusste<br />
Bildungsarbeit zu leisten und Lehrerinnen und Lehrer der Sekundarstufe I<br />
dabei zu unterstützen, dem Thema Vorurteile in der Schule zu begegnen. Es soll damit<br />
ein Arbeitsbehelf zur Verfügung gestellt werden, der ihnen dabei hilft, den Entstehungsprozess<br />
wie auch das Wirken von Vorurteilen und Feindbildern besser zu<br />
verstehen und den Umgang mit Vorurteilen so in den Unterricht einzubauen, dass<br />
Schülerinnen und Schüler dieser Altersstufe Vorurteile als solche erkennen und in der<br />
Lage sind, gegen sie aufzutreten. Der konzeptuelle Bogen spannt sich daher von einer<br />
<strong>theoretisch</strong>en-<strong>didaktische</strong>n Fundierung des Themas auf Basis der aktuellen fachwissenschaftlichen<br />
und fach<strong>didaktische</strong>n Literatur über Leitprinzipien eines vorurteilssensiblen<br />
Unterrichts bis hin zu ganz konkreten Anregungen und Unterrichtsbeispielen<br />
für die Unterrichtspraxis.<br />
Wie Vorurteile wirken<br />
Die <strong>theoretisch</strong>-<strong>didaktische</strong>n Grundlagen widmen sich zunächst der Definition und<br />
den Wirkmechanismen von Vorurteilen. Wolfgang Benz, emeritierter Professor und<br />
langjähriger Leiter des Zentrums für Antisemitismusforschung in Berlin, unternimmt<br />
den einleitenden Versuch, Vorurteile und Feindbilder zu definieren, und zeigt anhand<br />
von historischen Beispielen auf, wie mittels Vorurteilen und Feindbildern Minderheiten<br />
ausgegrenzt werden und Ressentiments in Hass und kollektiven Gewalttaten kulminieren<br />
können. Wo liegen die Wurzeln von Vorurteilen? Der Sozialpsychologe Josef<br />
Berghold beschreibt, wie Vorurteile auf individueller Ebene wirken, und hebt die emotionale<br />
Verwurzelung und den Zusammenhang mit der individuellen Wahrnehmungsund<br />
Gefühlswelt hervor. Verachtung bzw. Verweigerung des Respekts anderen gegenüber,<br />
Schwarz-Weiß-Denken und Angst vor Bedrohung nennt er als zentrale Elemente,<br />
die auf individueller Ebene die Wirkung von Vorurteilen verstärken.<br />
Vorurteile tragen über die Konstruktionen von „anderen“ dazu bei, ein deutlicheres<br />
Bild von „uns“ zu schaffen, sie bilden aber auch Rangordnungen und Ungleichheiten,<br />
wie der Politikwissenschaftler und Leiter des <strong>Institut</strong>s für Konfliktforschung in Wien<br />
Professor Anton Pelinka in seinem Beitrag ausführt, und haben dadurch auch Anteil<br />
an der Konstruktion von „Sündenböcken“. Vor diesem Hintergrund ist es auch wichtig,<br />
zu verstehen, welche Typen von Vorurteilen es gibt. Vorurteile tragen dem menschlichen<br />
Bedürfnis Rechnung, „komplizierte Sachverhalte einfach zu erklären“, sind aber letztendlich<br />
„Scheinwissen“, das nicht auf Erfahrung beruht, wie Pelinka ausführt.<br />
Neben den zentralen Wirkmechanismen von Vorurteilen geht es in dem Lehrbehelf<br />
vor allem auch um ihre zentrale Rolle für die angesprochene Altersgruppe der 10- bis<br />
14-Jährigen. Gerade diese Altersstufe ist eine sensible und relevante Phase im<br />
Kontext der Vorurteilsbildung – wie der Bildungswissenschaftler Dietmar Larcher in<br />
seinem Beitrag darlegt –, da sie eine Phase der Identitätsbildung darstellt, die bei Jugendlichen<br />
häufig zur Identifikation mit verschiedenen (u.a. auch ethnischen) Gruppen