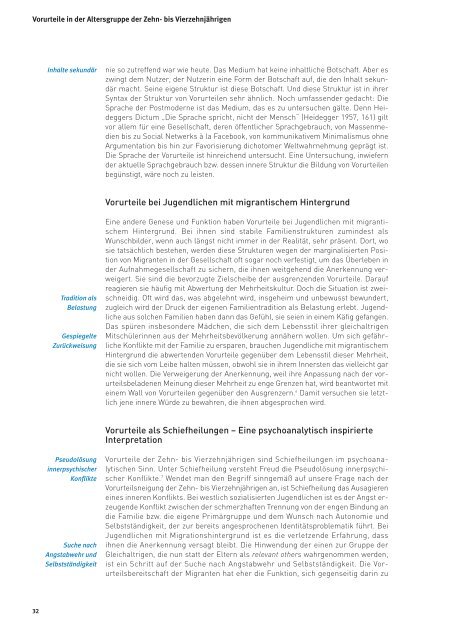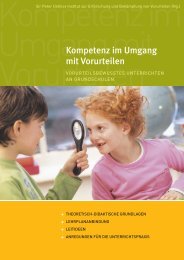theoretisch-didaktische grundlagen - Sir Peter Ustinov Institut
theoretisch-didaktische grundlagen - Sir Peter Ustinov Institut
theoretisch-didaktische grundlagen - Sir Peter Ustinov Institut
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Vorurteile in der Altersgruppe der Zehn- bis Vierzehnjährigen<br />
32<br />
Inhalte sekundär<br />
Tradition als<br />
Belastung<br />
Gespiegelte<br />
Zurückweisung<br />
Pseudolösung<br />
innerpsychischer<br />
Konflikte<br />
Suche nach<br />
Angstabwehr und<br />
Selbstständigkeit<br />
nie so zutreffend war wie heute. Das Medium hat keine inhaltliche Botschaft. Aber es<br />
zwingt dem Nutzer, der Nutzerin eine Form der Botschaft auf, die den Inhalt sekundär<br />
macht. Seine eigene Struktur ist diese Botschaft. Und diese Struktur ist in ihrer<br />
Syntax der Struktur von Vorurteilen sehr ähnlich. Noch umfassender gedacht: Die<br />
Sprache der Postmoderne ist das Medium, das es zu untersuchen gälte. Denn Heideggers<br />
Dictum „Die Sprache spricht, nicht der Mensch“ (Heidegger 1957, 161) gilt<br />
vor allem für eine Gesellschaft, deren öffentlicher Sprachgebrauch, von Massenmedien<br />
bis zu Social Netwerks à la Facebook, von kommunikativem Minimalismus ohne<br />
Argumentation bis hin zur Favorisierung dichotomer Weltwahrnehmung geprägt ist.<br />
Die Sprache der Vorurteile ist hinreichend untersucht. Eine Untersuchung, inwiefern<br />
der aktuelle Sprachgebrauch bzw. dessen innere Struktur die Bildung von Vorurteilen<br />
begünstigt, wäre noch zu leisten.<br />
Vorurteile bei Jugendlichen mit migrantischem Hintergrund<br />
Eine andere Genese und Funktion haben Vorurteile bei Jugendlichen mit migrantischem<br />
Hintergrund. Bei ihnen sind stabile Familienstrukturen zumindest als<br />
Wunschbilder, wenn auch längst nicht immer in der Realität, sehr präsent. Dort, wo<br />
sie tatsächlich bestehen, werden diese Strukturen wegen der marginalisierten Position<br />
von Migranten in der Gesellschaft oft sogar noch verfestigt, um das Überleben in<br />
der Aufnahmegesellschaft zu sichern, die ihnen weitgehend die Anerkennung verweigert.<br />
Sie sind die bevorzugte Zielscheibe der ausgrenzenden Vorurteile. Darauf<br />
reagieren sie häufig mit Abwertung der Mehrheitskultur. Doch die Situation ist zweischneidig.<br />
Oft wird das, was abgelehnt wird, insgeheim und unbewusst bewundert,<br />
zugleich wird der Druck der eigenen Familientradition als Belastung erlebt. Jugendliche<br />
aus solchen Familien haben dann das Gefühl, sie seien in einem Käfig gefangen.<br />
Das spüren insbesondere Mädchen, die sich dem Lebensstil ihrer gleichaltrigen<br />
Mitschülerinnen aus der Mehrheitsbevölkerung annähern wollen. Um sich gefährliche<br />
Konflikte mit der Familie zu ersparen, brauchen Jugendliche mit migrantischem<br />
Hintergrund die abwertenden Vorurteile gegenüber dem Lebensstil dieser Mehrheit,<br />
die sie sich vom Leibe halten müssen, obwohl sie in ihrem Innersten das vielleicht gar<br />
nicht wollen. Die Verweigerung der Anerkennung, weil ihre Anpassung nach der vorurteilsbeladenen<br />
Meinung dieser Mehrheit zu enge Grenzen hat, wird beantwortet mit<br />
einem Wall von Vorurteilen gegenüber den Ausgrenzern. 6 Damit versuchen sie letztlich<br />
jene innere Würde zu bewahren, die ihnen abgesprochen wird.<br />
Vorurteile als Schiefheilungen – Eine psychoanalytisch inspirierte<br />
Interpretation<br />
Vorurteile der Zehn- bis Vierzehnjährigen sind Schiefheilungen im psychoanalytischen<br />
Sinn. Unter Schiefheilung versteht Freud die Pseudolösung innerpsychischer<br />
Konflikte. 7 Wendet man den Begriff sinngemäß auf unsere Frage nach der<br />
Vorurteilsneigung der Zehn- bis Vierzehnjährigen an, ist Schiefheilung das Ausagieren<br />
eines inneren Konflikts. Bei westlich sozialisierten Jugendlichen ist es der Angst erzeugende<br />
Konflikt zwischen der schmerzhaften Trennung von der engen Bindung an<br />
die Familie bzw. die eigene Primärgruppe und dem Wunsch nach Autonomie und<br />
Selbstständigkeit, der zur bereits angesprochenen Identitätsproblematik führt. Bei<br />
Jugendlichen mit Migrationshintergrund ist es die verletzende Erfahrung, dass<br />
ihnen die Anerkennung versagt bleibt. Die Hinwendung der einen zur Gruppe der<br />
Gleichaltrigen, die nun statt der Eltern als relevant others wahrgenommen werden,<br />
ist ein Schritt auf der Suche nach Angstabwehr und Selbstständigkeit. Die Vorurteilsbereitschaft<br />
der Migranten hat eher die Funktion, sich gegenseitig darin zu