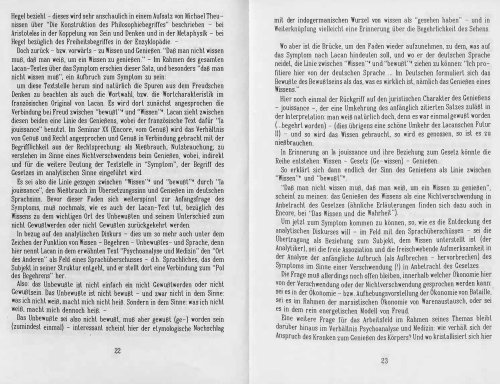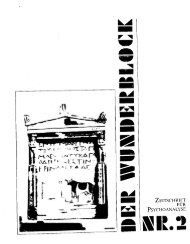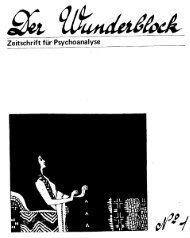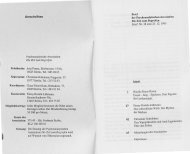Download - Freud Lacan Gesellschaft - Psychoanalytische ...
Download - Freud Lacan Gesellschaft - Psychoanalytische ...
Download - Freud Lacan Gesellschaft - Psychoanalytische ...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Hege! bezieht - dieses wird sehr anschaulich in einem Aufsalz von Michael Theunissenüber "Die Konstruktion des Philosophiebegriffes" beschrieben - beiArisloleles in der Koppelung von Sein und Denken und in der Metaphysik - beiHege! bezüglich des Freiheilsbegriffes in der Enzyklopädie. -Doch zurück - bzw. vorwärts - zu Wissen und Genießen. "Daß man nicht wissenmuß, daß man weiß, um ein Wissen zu genießen." - Im Rahmen des gesamten<strong>Lacan</strong>-Texles über das Symptom erschien dieser Salz, und besonders "daß mannichl wissen muß", ein Aufbruch zum Symptom zu sein:um diese Textstelle herum sind natürlich die Spuren aus dem <strong>Freud</strong>schenDenken zu beachten als auch die Worlwahl, bzw. die Wortcharakteristik imfranzösischen Original von <strong>Lacan</strong>. Es wird dorl zunächst angesprochen dieVerbindung bei <strong>Freud</strong> zwischen "bewußt"* und "Wissen"*. <strong>Lacan</strong> zieht zwischendiesen beiden eine Linie des GenieBens, wobei der französische Texl dafür "Iajouissance" benulzl. Im Seminar XX (Encore, vom Genuß) wird das Verhältnisvon ?euß ud Recht angesprochen und Genuß in Verbindung gebracht mil derBegnffhchkeil aus der Rechtsprechung: als Nießbrauch, Nutzbrauchung; zuverstehen im Sinne eines Nichtverschwendens beim Genießen wobei, indirektund für die weitere Deutung der Textstelle in "Symptom", ' der Begriff desGesetzes im analytischen Sinne eingeführt wird.. Eṣ sei also die Linie gezogen zwischen "Wissen"* und "bewußl"* durch "IaJOUissan . ce", den Nießbrauch im Übersetzungssinn und Genießen im deutschenSprachsmn. Bevor dieser Faden sich weilerspinnt zur Anfangsfrage desSmploms, muß nochmals, wie es auch der <strong>Lacan</strong>-Texl tul, bezüglich desWissens zu dem wichtigen Orl des Unbewußlen und seinem Unterschied zumnicht Gewußtwerden oder nicht Gewußten zurückgekehrt werden.l . n bezug auf den analytischen Diskurs - dies um so mehr auch unter demZIchen der Funktion von Wissen - Begehren - Unbewußles-und Sprache, dennh1er nennl <strong>Lacan</strong> in dem erwähnten Texl "Psychoanalyse und Medizin" den "Orldes . And:ren" als Feld eines Sprachüberschusses - d.h. Sprachliches, das demSubjekt m seiner Slruklur entgeht, und er slelll dorl eine Verbindung zum "Poldes Begehrens" her.Also: das Unbewußle isl nichl einfach ein nichl Gewußtwerden oder nichlGewußlsein. Das Unbewußle isl nichl bewußl - und zwar nicht in dem Sinne:wa ich nichl weiß, machl mich nichl heiß. Sondern in dem Sinne: was ich nichtweiß, machl mich dennoch heiß. -Da Unbew ßte sei also nichl bewußl, muß aber gewußl (ge-) worden sein(zummdest emmal) - interessant scheint hier der etymologische Nachschlag22mil der indogermanischen Wurzel von wissen als "gesehen haben" - und inWeilerknüpfung vielleicht eine Erinnerung über die Begehrlichkeil des Sehens.Wo aber isl die Brücke, um den Faden wieder aufzunehmen, zu dem, was aufdas Symptom nach <strong>Lacan</strong> hindeuten soll, und wo er der deutschen Spracheneidet, die Linie zwischen "Wissen"* und "bewußl"* ziehen zu können: "Ich profilierehier von der deutschen Sprache ... Im Deutschen formuliert sich dasBewußte des Bewußtseins als das, was es wirklich isl, nämlich das Genießen einesWissens."Hier noch einmal der Rückgriff auf den juristischen Charakter des GenieSens- jouissance -, der eine Umkehrung des anfänglich zitierten Salzes zuläßt inder Interpretation: man weiß natürlich doch, denn es war einmal gewußt worden( ... begehrt worden) - (dies übrigens eine schöne Umkehr des <strong>Lacan</strong>schen FuturII) - und so wird das Wissen gebraucht, so wird es genossen, so isl es zunießbrauchen.In Erinnerung an Ia jouissance und ihre Beziehung zum Gesetz könnte dieReihe entstehen: Wissen - Gesetz (Ge-wissen) - Genießen.So erklärt sich dann endlich der Sinn des Genießens als Linie zwischen"Wissen"* und "bewußt"*."Daß . man nicht wissen muß, daß man weiß, um ein Wissen zu genießen",scheint zu meinen: das Genießen des Wissens als eine Nichtverschwendung inAnbetracht des Gesetzes (ähnliche Erläuterungen finden sich dazu auch inEncore, bei "Das Wissen und die Wahrheit").Um jelzt zum Symptom kommen zu können, so, wie es die Entdeckung desnalylischen Diskurses will - im Feld mit den Sprachüberschüssen - sei dieUberlragung als Beziehung zum Subjekt, dem Wissen unlerslelll isl (derAnalyl!ker), sei die freie Assoziation und die freischwebende Aufmerksamkeil inder Analyse der anfängliche Aufbruch (als Aufbrechen - hervorbrechen) desSy ploms im Sinne einer Verschwendung (!) in Anbetracht des Gesetzes.D1e Frage muß allerdings noch offen bleiben, innerhalb welcher Ökonomie hiervo der Versc,hwendung oder der Nichtverschwendung gesprochen werden kann:se es I? der Okonomie - bzw. Aufhebungsvorstellung der Ökonomie von Bataille,·Se! es Im Rahmen der marxistischen Ökonomie von Warenauslausch, oder seies in dem rein energetischen Modell von <strong>Freud</strong>.Eine weitere Frage für das Arbeitsfeld im Rahmen seines Themas bleibtdaruber hinaus im Verhältnis Psychoanalyse und Medizin: wie verhält sich derAnspruch des Kranken zum Genießen des Körpers? Und wo kristallisiert sich hier23