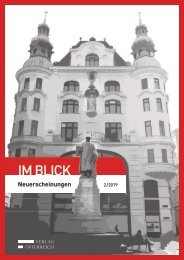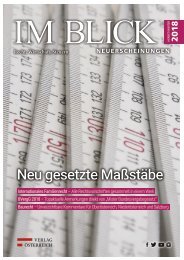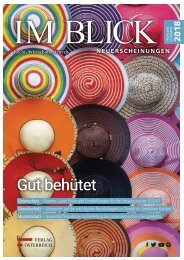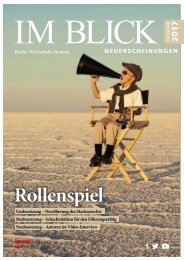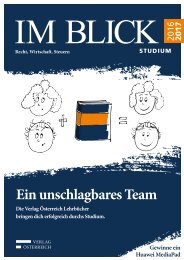IM BLICK Winter 2016
Das Neuerscheinungsmagazin des Verlag Österreich - einem der führenden Verlage für juristische Fachinformation in Österreich.
Das Neuerscheinungsmagazin des Verlag Österreich - einem der führenden Verlage für juristische Fachinformation in Österreich.
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
<strong>IM</strong> INTERVIEW <strong>IM</strong> <strong>BLICK</strong> 5<br />
eine exzellente Verwaltung, die das<br />
Vorhaben operativ umsetzen kann. Im<br />
Speziellen hat die Gemeindestrukturreform<br />
in der Steiermark bisher keine<br />
nachvollziehbaren Nachteile hervorgebracht.<br />
Im Gegenteil, wir merken, dass<br />
die Gemeinden und deren Bürgermeister,<br />
die gelernt haben, mit der neuen<br />
Situation umzugehen, inzwischen auch<br />
das Potenzial größerer Gemeinden<br />
anerkennen. Wo es zuvor Gemeinden<br />
mit 1.500 oder überhaupt nur 500<br />
Einwohnern gab, sind heute Gemeinden<br />
zwischen 3000 bis 10.000 Einwohnern.<br />
In solchen Gemeinden herrscht<br />
Aufbruchsstimmung. Die gewachsene<br />
finanzielle Kraft lässt neue Chancen<br />
und einen größeren Spielraum für Investitionen<br />
und Betriebsansiedelungen<br />
zu, mit denen es bereits erste gute Erfahrungen<br />
gibt. Einen weiteren Vorteil<br />
sehen wir in der effizienten Nutzung<br />
der Infrastruktur. In den kleineren Gemeinden<br />
war zuvor keine volle Auslastung<br />
des Kindergartens, der Volkschule<br />
oder des Bauhofes mehr möglich. Auch<br />
die Amtsstruktur brachte viele Kleinstgemeinden<br />
an die Belastungsgrenzen.<br />
Wenn es nur einen Amtsleiter gab und<br />
der in Urlaub oder krank war, kam das<br />
Werk zum Stehen. Größere Gemeinden<br />
haben auch mehr Mitarbeiter. Damit<br />
können sich nun diese Mitarbeiter auf<br />
unterschiedliche Fachgebiete in den<br />
Verwaltungen spezialisieren oder auch<br />
flexiblere Öffnungszeiten bei Kinderbetreuungseinrichtungen,<br />
Schulen und<br />
Bauhöfen ermöglicht werden. Diese<br />
Veränderungen werden von den Gemeinden<br />
und der Bevölkerung durchaus<br />
positiv wahrgenommen.<br />
Was waren die gewichtigsten<br />
Gründe für die Reform?<br />
Wlattnig: Einer der wichtigsten Gründe<br />
war definitiv die Kleinstrukturiertheit<br />
der Steiermark. Wir hatten mit<br />
200 Gemeinden über dreißig Prozent<br />
aller Kleinstgemeinden in Österreich,<br />
das sind jene Gemeinden unter 1.000<br />
Einwohner. Das Problem lag vor allem<br />
darin, dass wir in vielen peripheren<br />
Kleinstgemeinden kontinuierlich<br />
Bevölkerung verloren haben. Das ist<br />
zwar nach wie vor der Fall und lässt<br />
sich auch nicht über Nacht stoppen.<br />
Dennoch bestand Handlungsbedarf,<br />
zumal es Statistiken gab, aus denen<br />
hervorging, dass mehr als die Hälfte<br />
der steirischen Gemeinden massiv<br />
Einwohner in der Zeit zwischen 1990<br />
und 2010 verloren hat und es Prognosen<br />
gab, dass sich diese Entwicklung<br />
auch in Zukunft fortgesetzt hätte.<br />
Das ist besorgniserregend, wenn man<br />
Einwohnerzahlen von 300 oder 400<br />
hat, denn die finanzielle Lage einer<br />
Gemeinde hängt ja unausweichlich<br />
mit ihrer Struktur und ihrer demografischen<br />
Entwicklung zusammen.<br />
Viele Kleinstgemeinden konnten vor<br />
der Reform ihren Haushalt nicht mehr<br />
„Man braucht Reformwillen,<br />
eine durchdachte<br />
Strategie und eine exzellente<br />
Verwaltung.“<br />
Wolfgang Wlattnig<br />
ausgleichen und waren immer von der<br />
Unterstützung des Landes abhängig,<br />
um überhaupt weiter existieren zu<br />
können. Hinzu kommt der Druck von<br />
oben, von der EU und dem Bund, denn<br />
der Stabilitätspakt gilt ja für alle Gebietskörperschaften.<br />
Mit der vorherigen<br />
Struktur wäre es für viele Gemeinden<br />
immer schwieriger geworden, eine<br />
schwarze Null zu erzielen. Es gab also<br />
ausreichend Anlass, hier gegenzusteuern.<br />
Auch wenn es nicht allen Gemeinden<br />
sofort gelingen wird, finanziell<br />
unabhängig zu agieren, so haben wir<br />
mit der Reform deutlich zum eigenen<br />
Überleben der Gemeinden in der Zukunft<br />
beigetragen.<br />
Es ist anzunehmen, dass jene Argumente,<br />
die für die Reform sprachen,<br />
bereits intensiv im Vorfeld überlegt<br />
wurden. Haben Sie während des Prozesses<br />
noch Überraschungen erlebt?<br />
Wlattnig: Wir haben gut vorgedacht.<br />
Es ist von außen nur schwer wahrnehmbar,<br />
bedarf aber einer unglaublichen<br />
Vorarbeit, wenn über 400<br />
Gemeinden – also 400 Bürgermeister,<br />
7.000 Gemeinderäte und all die mehr<br />
oder weniger aufgebrachten Bürgerinnen<br />
und Bürger – an einem solchen<br />
Prozess beteiligt werden sollen. Da<br />
muss man schon sämtliche Eventualitäten<br />
mitbedenken, und genau das<br />
meinte ich eingangs mit „Strategie“.<br />
Der entscheidende Faktor unseres Erfolges<br />
war der Entwurf eines Leitbildes<br />
zur Strukturreform, der mit sehr viel<br />
Sorgfalt und unter Beteiligung der<br />
verschiedenen Interessenvertretungen<br />
erarbeitet wurde. Ohne diese strategische<br />
Vorarbeit wären wir wahrscheinlich<br />
aufgrund der vielen Einwände<br />
und Widerstände gescheitert. Bei der<br />
Methode des „Zentrale-Orte-Konzept“<br />
waren uns vor allem die Lebensrealitäten<br />
der Menschen wichtig, also wo<br />
gehen sie einkaufen, wo gehen die<br />
Kinder in den Kindergarten oder zur<br />
Schule. Nach diesen Orientierungsparametern<br />
hat man die Zusammenlegung<br />
in vielen Gesprächen und Verhandlungen<br />
bis in die kleinste Gemeinde<br />
herunterdekliniert. Das alles führte<br />
schließlich zum Erfolg: die Erarbeitung<br />
einer Strategie und schlussendlich<br />
die Einhaltung dieser Strategie bis ins<br />
letzte Detail. In unserem Buch kommt<br />
dieser ganzheitliche Ansatz – schon am<br />
Anfang zu wissen, was am Ende sein<br />
kann – deutlich heraus. Das Ende war<br />
in unserem Fall, dass der VfGH über<br />
Beschwerden der Gemeinden zu entscheiden<br />
hatte. Diese Anfechtungen<br />
haben wir mehr oder minder durch die<br />
Aufarbeitung der Rechtsprechung und<br />
mit Hilfe von Universitätsprofessor<br />
Stefan Storr (Uni Graz) in unserem<br />
Leitbild mitbedacht, um den Anforderungen<br />
des Höchstgerichtes Rechnung<br />
zu tragen.