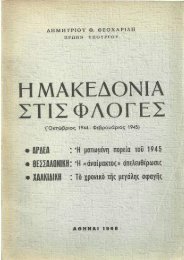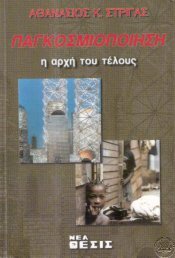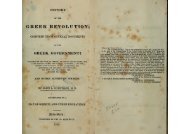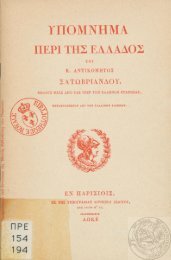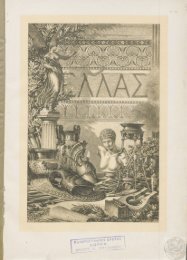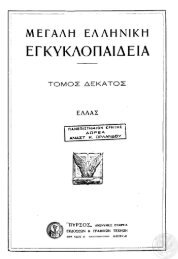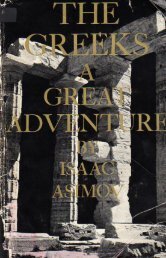AUSFÜHRLICHES LEXIKON DER GRIECHISCHEN UND RÖMISCHEN MYTHOLOGIE , W.H.ROSCHER 1894
MACEDONIA is GREECE and will always be GREECE- (if they are desperate to steal a name, Monkeydonkeys suits them just fine) ΚΑΤΩ Η ΣΥΓΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΔΟΤΩΝ!!! Strabo – “Geography” “There remain of Europe, first, Macedonia and the parts of Thrace that are contiguous to it and extend as far as Byzantium; secondly, Greece; and thirdly, the islands that are close by. Macedonia, of course, is a part of Greece, yet now, since I am following the nature and shape of the places geographically, I have decided to classify it apart from the rest of Greece and to join it with that part of Thrace which borders on it and extends as far as the mouth of the Euxine and the Propontis. Then, a little further on, Strabo mentions Cypsela and the Hebrus River, and also describes a sort of parallelogram in which the whole of Macedonia lies.” (Strab. 7.fragments.9) ΚΚΕ, ΚΝΕ, ΟΝΝΕΔ, ΚΙΝΑΛ,ΝΕΑ,ΦΩΝΗ,ΦΕΚ,ΝΟΜΟΣ,LIFO,MACEDONIA, ALEXANDER, GREECE,IKEA
MACEDONIA is GREECE and will always be GREECE- (if they are desperate to steal a name, Monkeydonkeys suits them just fine)
ΚΑΤΩ Η ΣΥΓΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΔΟΤΩΝ!!!
Strabo – “Geography”
“There remain of Europe, first, Macedonia and the parts of Thrace that are contiguous to it and extend as far as Byzantium; secondly, Greece; and thirdly, the islands that are close by. Macedonia, of course, is a part of Greece, yet now, since I am following the nature and shape of the places geographically, I have decided to classify it apart from the rest of Greece and to join it with that part of Thrace which borders on it and extends as far as the mouth of the Euxine and the Propontis. Then, a little further on, Strabo mentions Cypsela and the Hebrus River, and also describes a sort of parallelogram in which the whole of Macedonia lies.”
(Strab. 7.fragments.9)
ΚΚΕ, ΚΝΕ, ΟΝΝΕΔ, ΚΙΝΑΛ,ΝΕΑ,ΦΩΝΗ,ΦΕΚ,ΝΟΜΟΣ,LIFO,MACEDONIA, ALEXANDER, GREECE,IKEA
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
.<br />
.<br />
37 lanus (Gott aller Anfänge'* lanus (Gott d. Jahres; Erfinder) 38<br />
Eingang, Thüre, Thor und Anfang, Beginn, Ans- ävot^ig rov iviaviov Said. s. v. 'lavovdgiog;<br />
gang, Ende zeigen, insofern oft dieselben Worte mehr bei Marquardt, Staatsv. 3, 273, 5). Vgl.<br />
zur Bezeichnung der beiden Begriffe gebraucht über die Einzelheiten dieser Neujahrsfeier<br />
werden. So bedeutet iuitium ursprünglich das Mart. 8, 8. Preller - Jordan , B. M. 1, 179 ff.<br />
Eingehen, den Eingang, sodann den Anfang, Marquardt, Privatalt. 1, 257. Es war eine<br />
Beginn (vgl. itiire = hineingehen, beginnen). natürliche Konsequenz dieser Anschauungen,<br />
Den Gegensatz dazu bildete exitus und exitium, dafs man lanus als Gott des Jahres dachte<br />
eigentl. Ausgang, auch im Sinne von Ausgangs- und die Finger seiner Hände bildlich so darthür,<br />
sodanu Ausgang im Sinne von Ende, stellte, dafs die Zahl der Tage eines Jahres, also<br />
Ziel , Tod und Verderben. Namentlich er- lo 355 oder 365 herauskam {Plin. 34, 33. Macrob.<br />
scheint Urnen oft in der übertragenen Be- 1, 9, 10. lo. Lyd. 4, 1. Suid. s. v. 'lavovaQios.<br />
deutung Anfangspunkt, Eingang, ebenso wie Mythogr. Vat. 3, 4, 9. Ämob. 3, 29. Serv. A.<br />
ianua {fores; vgl. Mytlwgr. Vat. 3, 4, 9: lanus 7,607. Mart. 8, 2, 1 fastorum genitor. Schwegler,<br />
. . . anni ianuam pandat) im Sinne von Ein- i?.ö. 1,220, 12). Oder man bezog den Schlüssel<br />
leitung, Anfang (vgl. auch introitus, ingressus in der R. des Gottes auf die avoi^ig rov<br />
= Einleitung, Anfang, sonst Eingang, Zugang). iviavxov (Suid. s. v. 'lavovaQiog). Auf Münzen<br />
Vgl. auch Buttmann, Mythol. 2, 76 u. 79. des Commodus (abgebildet Arch. Ztg. 19, Taf.<br />
Schwegler, B. G. 1, 221. Auf Grund dieser 147, 6 ff. vgl. dazu S. 137 ff.) erscheint dieser<br />
sprachlichen Analogieen ist wohl nicht zu Kaiser als lanus stehend mit einer virga in<br />
zweifeln, dafs aus dem Gotte der Eingänge 20 der L.; seine R. legt er auf einen offenen<br />
und Thüren leicht ein Gott der Anfänge werden Bogen (ianus = fores caeli), innerhalb<br />
konnte, zumal wenn man bedenkt, dafs auch dessen die 4 Jahreszeiten (vgl. Ov. f. 1, 125:<br />
die Ausdrücke für Raum und Zeit oft zusammen- praesideo foribus caeli cum mitibtts Horts)<br />
fallen (vgl. z. B. spatium und intervallum, stehen; ihnen entgegen schreitet ein nackter<br />
beides vom Räume und von der Zeit gebraucht). Knabe mit einem vollen Füllhorn (= Novus<br />
Dem lanus als Gott des Anfangs {Aug. Annus). Schliefslich wurde lanus geradezu in der<br />
c. d. 7, 3 omniiim initioriim potestatem habere Bedeutung von annus gebraucht (Auson. epist.<br />
lanum. Varro ibid. 7, 9: penes lanum prima. 20, 13; vgl. Martial. 10,28, 1: annorum mundi-<br />
Mythogr. Vat. 2, 4, 9. August, c. d. 4, 1 1 : in que sator. Lucan. Phars. 5, 6 ducentem tempora<br />
lano Sit Initiator) waren die meisten An- 30 lanum). So entstand einerseits die Identififänge<br />
der natürlichen Zeitabschnitte geweiht, cierung des lanus mit Aion oder dem Vater<br />
d. h. die Morgenfrühe, die Kaienden als Monats- des Aion (Messala b. lo. Lyd. de mens. 4, 1.<br />
anfange, der lanuarius als Anfangsmonat des Longinus b. Suid. a. a. 0. Nemes. Gyneg. 104<br />
Jahres. Aus Horaz Sat. 2, 6, 20 ff. erhellt, teviporis auctor. Mart. 8, 2, 1), andererseits<br />
dafs lanus als Matutinus pater in der Frühe die Vorstellung, er sei scpogog näarjg jrpaletös<br />
des Morgens beim Beginne der Tagesarbeit {Varro b. Lyd. 4, 2; vgl. auch Ovid f. 1,<br />
angerufen wurde (vgl. Myth. Vat. 3, 4, 9: diei 165 ff.) oder der Anfang aller Dinge {Paul,<br />
deiis. Serv. V. A. 7, 607: diei dominus). Auf p. 52 s. v. Chaos: a quo rerum omnium factum<br />
den Gott der Kaienden oder Monatsanfönge putabant initium), eine Idee, welche mit der<br />
bezieht sich unzweifelhaft der Beiname luno- 40 oben besprochenen von lanus als mundus oder<br />
nius, welcher offenbar den mit der Mond- Chaos sehr nahe verwandt ist (s. Sp. 35 u. 39).<br />
göttin luiio zusammen an den Kaienden ver- Nach OtJ^i/". 1, 165ff. (vgl. auchi&n«a ep. 83,<br />
ehrten Gott bezeichnen soll {Macrob. 1, 9, 16 5. Colum.r.r. 11,2 p. 446 ed. Ä^.) mufste jeder<br />
lunoyiium quasi non solum mensis lanuarii, Römer (ominis causa) am ersten Januar an<br />
sed mensium omnium ingressus tenentem, sein jährliches Geschäft die erste Hand anin<br />
dicione autein Junonts sunt omnes Kalendae. legen, aber es gleichsam nur kosten, um so<br />
ib. 1, 15, 19). Auf diesen lunonius bezogen durch einen guten Anfang am ersten Tage des<br />
sich nach Varro die 12 zu Rom dem lanus neuen Jahres seiner Thätigkeit einen guten Ergeweihten<br />
Altäre {Macrob. a. a. 0. lo. Lyd. folg für das ganze Jahr zu sichern (vgl. Peter<br />
4, 2: övoKutds-Aa TiQvzävsig Tigog rov Novtiä 50 z. Ov. f. a. a. 0.). Diese gewifs uralte Sitte,<br />
tovg -Kalovuhovg ZaXiovg oQio^fivaC cpaaiv, welche z. B. Varro a. a. 0. veranlafst, den<br />
v{ivovvtag tov 'lavov xarä xov xäv 'izali-Amv lanus für den icpoQog ndarig ngä^iag zu halten,<br />
uTjväv ägi&uov. 6 8e Baggcov . . . (prjaiv, sowie der Brauch, den Matutinus pater am<br />
avtov . . Isysa^ai Kai IIoTiävcova, Siä z6 iv frühen Morgen vor dem Beginn der Tages-<br />
.<br />
Tais KaXivöaig dvacpEQsa&ai nonava. Paul. arbeit anzuflehen {Hör. sat. 2, 6, 20 ff.), hat<br />
p. 104: lanual libi yenus, quod lano tantum- wohl hauptsächlich die Vorstellung erzeugt,<br />
modo immolatur). Ganz besonders feierlich dafs lanus der Urheber oder Erfinder aller<br />
waren natürlich vmter diesen Kaienden die möglichen nützlichen Thätigkeiten oder ßedes<br />
lanuarius, d. i. des dem lanus ganz rufe sei. So wurde (nach Plut. Q. Born. 22)<br />
speziell (von Numa) geheiligten ersten Monats, 60 nicht blofs die gebildete Sprache und Lebensmit<br />
welchem die Tage wieder zunehmen (vgl. weise {yläaaa -nai öiaita; vgl. genitor vocis<br />
Varro l. l. 6, 34 Lanuarius] a principe deo Serv. 7, 610), der Landbau {ystagystv) und die<br />
.<br />
appellatus. Porphyr, antr. Nymph. 23. Mythogr. Staatsverfassung {nolitsv(ö9ai)^ sondern auch<br />
Vat. 3, 4, 9. Lo. Lyd. de mens. 4, 1: dgirtv die Kunst, Häuser und Thore {oixavg *al<br />
iigaziKOv iviavTOv tov 'lavovdgiov firjVa . . . itvlsävag y.ataay.svdcai Demoph. b. J-iyd. de<br />
Ttagd xov ßaoi).i(og Novuü bgia&rjvai^ vgl. ib. mens. 4, 2) und Tempel zu erbauen {Ttgäxov<br />
3, 15. (Jvid. f. 1, 43 u. 65 Lane biceps, anni xaxaaHSvdaat. xi^ivtj Lyd. a. a. Ü. 4, 2), femer<br />
tacite Idbentis origo; dgxri xov xQÖvov -iial der Schiffsbau (s. ob. Sp. 23 f), die Münz-<br />
2*<br />
39 lanus (erste Stelle bei Gebeten etc.) lanus (Kriegs- u. Quellenfjott ?) 40<br />
prägung {Athen. G92DE. Macrob. 1, 7, 22), ja lieh nicht blofs den gewöhnlichen Ehrentitel<br />
HOgar der ganze religiöse Knltus {Xenon b. der anderen grofsen Götter (vgl. luppiter,<br />
Macrob. 1, 9, 3. 7o. Lyd. 4, 2) auf das Wirken Marspiter etc. Zinzow, d. Vaterbcgri/)' b. d.<br />
des lanus zurückgeführt. Vgl. auch Macrob. röm. Gottheiten, Pyritz 1887 S. 6 f.), sondern<br />
1, 7, 21—25, wo lanus in dieser Beziehung bezieht sich wahrscheinlich auch auf seine<br />
als Schüler des Saturnus aufgefafst wird. Der Stellung als Göttervater schlechthin, auf seine<br />
Beiname Cenulus, den J.abeo h. lo.Lyd.A, 1 Geltung als principium deorum. Vgl. Macrob.<br />
mit {vcoxiccoti-nög erklärt (vgl. Cedren. 1 p. 295, 7 1, 9, 16 : patrem [invocamuH j quasi deorum deum.<br />
Ii07m. PafiaioL yi^ßovg triv TQoq)r)v iKÜXovv, i^ Cato r.r.lM. Lucil.h. J.actant. i. d. 4,3. Verg.A.<br />
oh xal 'lavov Ki^ovXliov 8iu rb svcuxiccati- lo 8,357. Hör. ep. 1, 16,59. saf. 2, 6, 20. luv.sat. 6,<br />
Kov), dürfte sich am besten aus der Idee eines 393. Hin. h. n. 36, 28. Gell. 5, 12, 5. Maaob. 1, 9,<br />
göttlichen Erfinders der 'ars cenarum'' {llor. 15. Mehr b. /ScÄwcflfZer, ü. Cf. 1, 223, 25. Xin:oir<br />
sat. 2, 4, 36) im Gegensatze zu dem 'fcrus et a. a. 0. 6, 4. Preller, R. M.^ 1, 167, 1.<br />
rudis ante fruges connitas victus' {Macrob. 1,<br />
7, 21) orklilren. Nicht recht klar ist, wie<br />
. , , r, . . •<br />
, tr /.^^ :• ^. ,.<br />
c) lanus als Gott des Krieges (?) n. der UueIIon(?).<br />
lanus dazu kam, als Erfinder der Kränze ge- Schon die Alten selbst haben lanus für<br />
nannt zu werden {Drakon v. Kerkyra b. Athen. einen Kriegsgott erklärt und namentlich dio<br />
092 DE). Es fragt sich, welche Art von Öffnung des lanus Geminus in Kriegszeiten<br />
Kränzen in diesem Falle gemeint ist, die zum und seinen Beinamen Quirinus (s. ob. Sp. 16) auf<br />
Apparat des Gastmahls gehörenden, oder die 20 diese Funktion bezogen. Vgl. Ennius b. Hot.<br />
dem religiösen Kultus {Flin. h. n. 21, 11) 1, 4, 60 Discordia taetra Belli ferratas postes<br />
dienenden. Auf den Trientalassen seit 268 portasque refregit. Macrob. 1, 9, 16 Quirinum<br />
(s. unten Sp. 51) erscheint lanus selbst mit quasi bellorum potentem ab hasta quam Sabini<br />
Lorbeer bekränzt, und über der Prora des Re- curin vocant. Lucan. Phars. 1, 62 belligeri<br />
verses steht als Beizeichen ein Kranz. — Aus limini lani. Cedren. 1 p. 295 Bonn, 'lavov<br />
dieser Vorstellung des lanus als Gott aller Kvqtvov coaccvfl nQoyiaxov; Anthol. Lat. ed.<br />
Anfänge und als Stifter des Gottesdienstes so- Riese 394, 1. Hiermit könnte man die auf<br />
wie als Mittler zwischen Göttern' und Menschen Numa {Flut. Marc. 8) zurückgeführte Be-<br />
{Ov. f. 1, 171 ff. Serv. V. A. 7, 610. Macrob. siimmüng tertia*) spolia [opimajianui Quirino<br />
1, 9, 9. Arnob. 3, 29) erklärt sich wohl der 30 a^num marcm caedito {Fest. p. 189) wohl veruralte<br />
Brauch, bei allen Opfern, Gebeten und emigen, wenn nicht bei Plutarch. vita Marc.<br />
Anrufungen zuerst des lanus zu gedenken und 8 {za dt rgiza t« KvqCvco) statt des lanus<br />
ihn an die Spitze zu stellen. Vgl. Cic. N. D. Quirinus der Quirinus als Empfänger der<br />
2, 27, 67 cumque in Omnibus rebus vim haberent dritten Spolien genannt würde, was gegen die<br />
maximam prima . . ., principcm in sacrificando Lesart des Festus einigermafsen mifstrauisch<br />
lanum esse voluerant. Varro b. August, c. d. macht, zumal wenn wir bedenken, dafs Quiri-<br />
7, 9: penes lanum sunt prima, penes lovem nus in diesem Zusammenhange besser zu<br />
summa. Vgl. ferner die Gebete bei Gato r. r. luppiter und Mars pafst als lanus, und dafs<br />
134 u. 141, die Devotionsformel b. Liv. 8, 9, 6, dieser sonst immer im üpferkult und bei Gedie<br />
Götterreihe der arval. Tafeln Henzen, acta 40 beten die erste, nie die dritte Stelle hat (vgl.<br />
fr. arv. 144 f. Festi epit. 52. Ovid. f. 1, 171 ff. namentlich die Devotionsformel bei Liv. 8, 9:<br />
Serv. V. A. 7, 610. Xenon b. Macrob. 1,9,3 lane, luppiter, Mars pater, Quirine, Belu.<br />
9. lo. Lyd. mens. 4, 2. Arnob. 3, 29 u. s. w; lona etc.). Hierzu kommt noch, dafs lanus<br />
mehr b. Marquardt, Staatsv. 3, 25, 7; 26, 1. ebenso oft auch ausdrücklich als Friedensgott<br />
Schwegler, R. G. 1, 222 f. Beachtenswert ist angesehen wird (vgl. Hör. ep. 2, 1, 255:<br />
es , dafs ebenso wie im häuslichen und foren- clauslraque cuslodem pacis cohibentia lanum.<br />
sischen Kult so auch bei allen Opfern und Ge- Ovid f. 1, 281: pace fores obdo, ne qua disbeten<br />
Vesta eine Art Pendant zu lanus bildet, cedere possit. ib. 287 ff. Martini 8, 66, 11 paciindem<br />
sie als „custos rernm intimurum" {Cic. ftcus lanus. Claudian 28, 638. Plut. Q. Rom.<br />
nat. d. 2, 27, 67) die letzte, lanus die erste 50 19: tov 'lavov noXixiv.hv xai yampytxov<br />
Stelle erhielt {Preuner, Hestia S. 28 ff. = 3Iar- (läXlov r] noXffiiKov ysvotisvov). Man erkennt<br />
quardt, Staatsv. 5, 26, 3). hieraus auf das deutlichste, dafs lanus durch-<br />
In nahem Zusammenhang mit diesen und aus nicht als eigentlicher Kriegsgott anzuden<br />
oben Sp. 35 ff. behandelten Anschauungen sehen ist und seine Auffassung als bellorum<br />
und Bräuchen steht die, wie Preller, R. itf. " 1, potens und belHger sich lediglich auf die oben<br />
166 ganz richtig hervorhebt, ge\vissermaf8en Sp. 18 f. behandelte Sitte den lanus Geminus<br />
theogonische oder kosmogonische Idee von im Frieden zu schliefsen, im Kriege offen zu<br />
lanus als dem Gott der Götter oder Urgott. halten bezieht (vgl. auch Ov. f. 1, 254: mV<br />
Wie alt und ehrwürdig diese Idee war, erhellt mihi cum bello. pacem postesque tuebar). Was<br />
am besten aus dem Umstände, dafs lanus be- 60 den Beinamen Quirinus (vgl. auch Kießling<br />
reits in den Liedern der Salier als Divum zu Hör. ca. 4, 16, 9) betrifft, der einzig und<br />
Dens gefeiert wurde. Vgl. Macrob. 1, 9^ 14: allein den am Eingang zu dem Forum der<br />
Saliorum antiquissimis carminibus lanus Dco- (Juirites, d. i. der röm, Bürger, befindlichen<br />
rum Dens canitur. Varro l. l. 7, 27: Divum und daselbst als custos verehrten lanus bc-<br />
JJeo. Seren, fr. 23 Müller bei Tcrent. Maur. zeichnet, so ist es mir bei dem unverkennde<br />
metr. p. 1889: o cate rci-um sator, principium<br />
deorum. Wenn er Pater genannt ) jn^ prima »poli» Kalten dom Inppiter Ferotrin«,<br />
wird, so bedeutet dies Epitheton wahrschein- ,\ie spcHnda i\cm Mara (9. a.). Vgl. unt. Rp. 43 /,. .w.