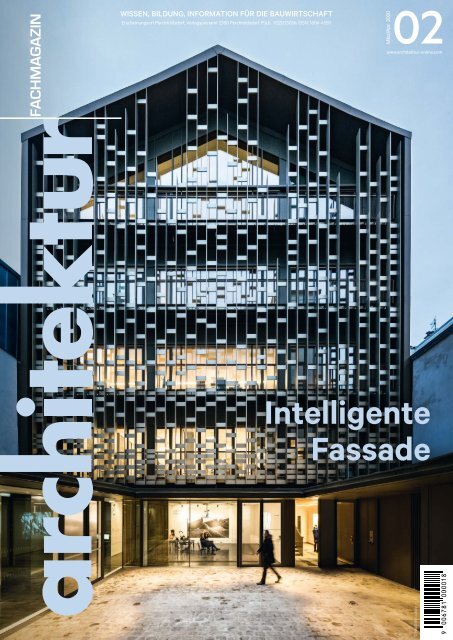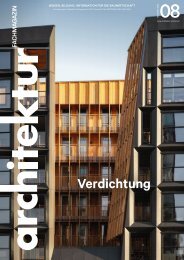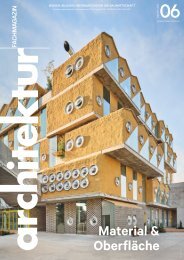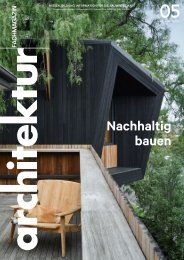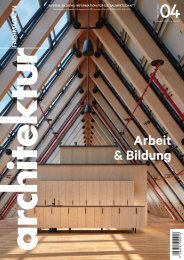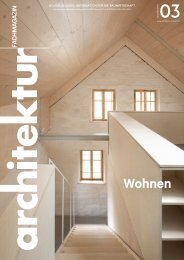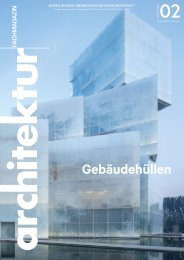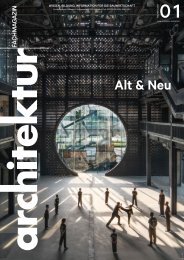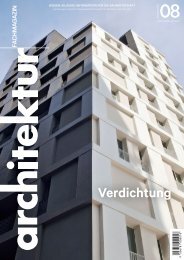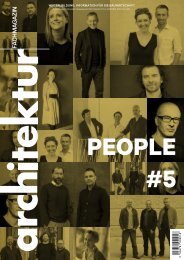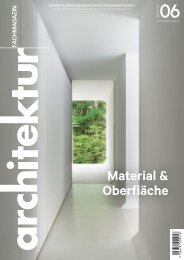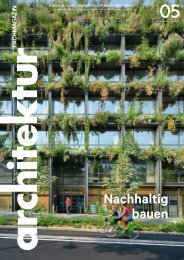architektur Fachmagazin Ausgabe 2 2020
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
FACHMAGAZIN<br />
WISSEN, BILDUNG, INFORMATION FÜR DIE BAUWIRTSCHAFT<br />
Erscheinungsort Perchtoldsdorf, Verlagspostamt 2380 Perchtoldsdorf. P.b.b. 02Z033056; ISSN: 1606-4550<br />
02<br />
www.<strong>architektur</strong>-online.com<br />
© Baptiste Lobjoy<br />
März/Apr. <strong>2020</strong><br />
Intelligente<br />
Fassade
www.<strong>architektur</strong>-online.com<br />
3<br />
Ausdruck der Architektur…<br />
…und technische Wunderwerke<br />
Die Fassaden der Zukunft sollen nicht mehr allein ästhetischen Ansprüchen genügen,<br />
das Bauwerk schützen, Wind und Wetter abhalten, temperieren und Ausblicke<br />
bieten – neben diesen Hygienefaktoren ist Intelligenz bei den Gebäudehüllen<br />
gefordert, die sich in vielerlei Ausprägungen manifestieren kann.<br />
Auch die Forscher haben die Vertikale<br />
in der Architektur für visionäre Innovationen<br />
entdeckt. So arbeitet ein Team an<br />
der ETH-Zürich an einer Solarfassade, die<br />
mit beweglichen Paneelen Strom aus Sonnenlicht<br />
erzeugt und im Testobjekt eines<br />
Büroraums 115 Prozent der erforderlichen<br />
Energie für die Klimatisierung liefert. An<br />
der Hochschule in Augsburg setzt man auf<br />
fassadenintegrierte Fotobioreaktoren zur<br />
Kultivierung von Mikroalgen, die Sonnenlicht<br />
und das in der Luft enthaltene CO 2 für<br />
ihr Wachstum benötigen. Dank ihres hohen<br />
Eiweiß-, Vitamin- und Mineralgehalts sind<br />
diese Algen prädestiniert für die Produktion<br />
von Nahrungsergänzungsmitteln sowie für<br />
die pharmazeutische Nutzung.<br />
Aber auch Architekten wissen die Fassaden<br />
ihrer Projekte vielfältig zu nutzen.<br />
Wie etwa beim Biwak Matteo Corradini<br />
auf knapp 3.000 Metern Höhe, wo die<br />
schwarze Hülle ein wesentliches Element<br />
der Wärmeversorgung im Inneren ist.<br />
Außergewöhnlich ist auch das Wuxi Taihu<br />
Show Theatre in China mit seinem dreiteiligen<br />
Fassadenkonzept: Neben einer Glasfassade<br />
und dem schattenspendenden Vordach<br />
besteht dies aus einem dichten Wald<br />
aus hohen Stützen. Das Krebsforschungszentrum<br />
AGORA in Lausanne wieder verfügt<br />
über eine neuartige Außenfassade in<br />
Form einer durchgehenden, durchlässigen<br />
Sonnenschutzhaut, die eine Überhitzung<br />
der Fassaden verhindert und gleichzeitig<br />
ein hohes Maß an visueller Transparenz bietet.<br />
Neben einigen anderen Beispielen zum<br />
Editorial<br />
Thema, zeigen zwei Projekte aus Frankreich,<br />
wie die Fassade als Haut oder Zeichen einer<br />
Architektur benutzt werden kann.<br />
Unsere Rubrik „Architekturszene“ behandelt<br />
dieses Mal das Bundesland Vorarlberg<br />
mit seiner Vielfalt an spannender<br />
Architektur. Die Fortschrittlichkeit<br />
im Bausektor hat aber nicht nur positive<br />
Seiten gebracht, heute ist das Ländle<br />
aufgrund seiner Freizügigkeit von einer<br />
fortschreitenden Zersiedelung geprägt.<br />
Der Retail-Bereich dieser <strong>Ausgabe</strong> glänzt<br />
wieder mit einer ganzen Reihe von sehenswerten<br />
und innovativen Shopkonzepten.<br />
Immer auffälliger wird bei der Recherche<br />
zu diesem Themenbereich nur, dass sich<br />
die heimische Shopgestaltung immer mehr<br />
zum Einheitsbrei entwickelt und sich kaum<br />
noch Vorzeigeprojekte finden lassen, die<br />
eine architektonische Erwähnung rechtfertigen.<br />
Ein einziges Österreich-Projekt hat es<br />
dennoch in diese <strong>Ausgabe</strong> geschafft.<br />
Abgerundet wird diese <strong>Ausgabe</strong> von <strong>architektur</strong><br />
natürlich auch wieder mit den bekannten<br />
Kolumnen sowie vielen neuen und<br />
innovativen Produktvorstellungen.<br />
Walter Laser
<strong>architektur</strong> FACHMAGAZIN<br />
4<br />
Inhalt<br />
Editorial 03<br />
Architekturszene 06<br />
Vorarlberg –<br />
Eine Vorzeigeregion der Architektur<br />
Magazin 12<br />
Bau & Recht 28<br />
Formvollendete Fassade 30<br />
AGORA PÔLE<br />
de recherche sur le cancer /<br />
Lausanne, Schweiz /<br />
Behnisch Architekten<br />
Symphonie im Stützenwald 38<br />
Wuxi Taihu Show Theatre / Wuxi /<br />
Steven Chilton Architects<br />
Signatur im Hinterhof 42<br />
Fondation-s / Paris /<br />
Lobjoy Bouvier Boisseau<br />
Musik aus 1001 Nacht 48<br />
Élancourt Music School /<br />
Élancourt / OPUS 5<br />
Über den Dingen 54<br />
Biwak Matteo Corradini Biwak /<br />
Cesana Torinese, Italien /<br />
Andrea Cassi e Michele Versaci<br />
Die Fassade 58<br />
als Energielieferant<br />
Mikroalgen und Sonneneinstrahlung<br />
intelligent genutzt<br />
RETAIL <strong>architektur</strong> 62<br />
Licht 74<br />
Produkt News 76<br />
edv 102<br />
Gebäudeautomation:<br />
Home, Smart Home<br />
30 38<br />
42 48<br />
54<br />
68<br />
MEDIENINHABER UND HERAUSGEBER Laser Verlag GmbH; Hochstraße 103, A-2380 Perchtoldsdorf, Österreich<br />
CHEFREDAKTION Ing. Walter Laser (walter.laser@laserverlag.at)<br />
REDAKTION mag. arch. Peter Reischer, Alexandra Ullmann, Linda Pezzei, Edina Obermoser, Dolores Stuttner, DI Marian Behaneck, Ing. Mag. Julia Haumer-Mörzinger, Mag. Matthias Nödl<br />
GESCHÄFTSLEITUNG Silvia Laser (silvia.laser@laserverlag.at) n LTG. PRODUKTREDAKTION Nicolas Paga (nicolas.paga@laserverlag.at) Tel.: +43-1-869 5829-14<br />
GRAFISCHE GESTALTUNG & WEB Andreas Laser n LEKTORAT Helena Prinz n DRUCK Bauer Medien & Handels GmbH<br />
ABONNEMENTS Abonnement (jeweils 8 <strong>Ausgabe</strong>n/Jahr): € 89,- / Ausland: € 109,-, bei Vorauszahlung direkt ab Verlag n Studentenabonnement (geg. Vorlage einer gültigen Inskriptionsbestätigung):<br />
€ 59,- / Ausland: € 86,- (Das Abonnement verlängert sich automatisch, sofern nicht mind. 6 Wochen vor Erscheinen der letzten <strong>Ausgabe</strong> eine schriftliche Kündigung bei uns einlangt.)<br />
EINZELHEFTPREIS € 14,- / Ausland € 18,-<br />
BANKVERBINDUNG BAWAG Mödling, Konto Nr. 22610710917, BLZ 14000, IBAN AT 87 1400022610710917, BIC BAWAATWW n Bank Austria, Konto Nr. 51524477801, BLZ 12000<br />
IBAN AT 231200051524477801, BIC BKAUTWW; UID-Nr. ATU52668304; DVR 0947 270; FN 199813 v; n ISSN: 1606-4550<br />
Mit ++ gekennzeichnete Beiträge und Fotos sind entgeltliche Einschaltungen. Die Redaktion haftet nicht für unaufgefordert eingesandte Manuskripte und Fotos. Berichte, die nicht von einem Mitglied<br />
der Redaktion gekennzeichnet sind, geben nicht unbedingt die Meinung der Redaktion wieder. Das Magazin und alle in ihm enthaltenen Beiträge sind urheberrechtlich geschützt.<br />
www.<strong>architektur</strong>-online.com
Rechenzentrum Universität Osnabrück, Deutschland | TTSP HWP Planungsgesellschaft mbH<br />
concrete skin<br />
| Fassadenplatten aus Glasfaserbeton<br />
| Lebendiger und authentischer Materialcharakter<br />
| Brandschutzklasse A1 – nicht brennbar<br />
| Neue Farben, Texturen und Oberflächen<br />
www.rieder.cc/neu
<strong>architektur</strong> FACHMAGAZIN<br />
6<br />
<strong>architektur</strong>szene<br />
Eine Vorzeigeregion<br />
der Architektur<br />
Mit einem Potpourri an spannender Architektur punktet das Bundesland Vorarlberg<br />
bereits seit fünf Jahrzehnten. Verantwortlich dafür sind experimentierfreudige Bauherren,<br />
kreative Architekten, eine offene Bevölkerung und nicht zuletzt die liberale<br />
Bauordnung. Diese Mischung begünstigte die Entstehung einer hohen Dichte an<br />
interessanten Baustilen, die trotz ihrer Gegensätze Harmonie ausstrahlen.<br />
Text: Dolores Stuttner<br />
Als ressourcenschonend und formal schlüssig<br />
gilt die Architektur im „Ländle“ in Expertenkreisen.<br />
Einige Werke werden gar<br />
als „Synthese konstruktiver und räumlicher<br />
Vernunft“ angesehen. Tatsächlich haben<br />
etliche Erkenntnisse der Vorarlberger Baukunst<br />
auch heute nichts an Aktualität verloren.<br />
Der Frage, warum ausgerechnet im<br />
westlichsten Bundesland Österreichs eine<br />
so hohe Dichte an interessanter Architektur<br />
realisiert wurde, ging auch die Ausstellung<br />
„Vorarlberg – ein Generationendialog“ im<br />
Architekturzentrum Wien (AZW) nach. Sie<br />
beleuchtete die sogenannte „Insel der Seeligen“<br />
der Baukunst aus mehreren Winkeln.<br />
Gespräche zwischen der alten und jungen<br />
Generation standen im Fokus der Veranstaltung.<br />
Damit war es möglich, die Vergangenheit,<br />
Gegenwart und Zukunft der baulichen<br />
Entwicklung in einen begreiflichen<br />
Kontext zu setzen. Ab 13. März <strong>2020</strong> ist die<br />
Ausstellung auch im vai – Vorarlberger Architektur<br />
Institut in Dornbirn zu sehen.<br />
Fort- und Rückschritt –<br />
eine Gegenüberstellung<br />
Während das westliche Bundesland in der<br />
Vergangenheit mit seiner Fortschrittlichkeit<br />
glänzte, so ist der Fall heute ein wenig<br />
komplexer. Mittlerweile ist das Land von einer<br />
fortschreitenden Zersiedelung geprägt.<br />
Eine Aneinanderreihung von Einfamilienhäusern<br />
prägt vielerorts das Landschaftsund<br />
Stadtbild. Maßnahmen, die die Flächenversiegelung<br />
aufhalten sollten, waren<br />
bisher nur begrenzt erfolgreich. Leistbare<br />
Baugründe sind aufgrund des hohen Grünflächenverbrauchs<br />
Mangelware. Dabei stellt<br />
sich die Frage, wieso die Entwicklung der<br />
Architektur in Vorarlberg so eine ungünstige<br />
Wendung nahm.<br />
Matthias Hein, Kinderhaus, Kennelbach, 2017 - 2019<br />
Der markante Holzbau des Kinderhauses in ländlicher Umgebung<br />
© David Schreyer<br />
Es ist trauriger Fakt, dass Vorarlberg heute<br />
nicht mehr zu den „Inseln der Seligen“ der<br />
Architektur gehört. Laut Experten wie dem<br />
Architekten Matthias Hein gelte es, den<br />
Stimmen der Vergangenheit wieder Gehör<br />
zu verschaffen. Denn bereits die Architekten<br />
der 1960er- und 1980er-Jahre waren<br />
der Meinung, dass Vorarlberg vom Siedlungsbau<br />
profitieren könnte. Dieses Bild<br />
existiert in der westlichen Bauszene heute<br />
nicht mehr. Das Einfamilienhaus zählt hier<br />
immer noch zur beliebtesten Wohnform.<br />
Eine hohe Einwohnerdichte wird in Vorarlberg<br />
vielerorts noch mit sozialen Problemen<br />
in Verbindung gebracht.<br />
Die Angst vor der Dichte ist, laut Matthias<br />
Hein, unbegründet. Denn auch Siedlungen<br />
können – soweit sie in Hinblick auf die Bedürfnisse<br />
der Bewohner geplant werden –<br />
hohe Wohnqualität schaffen. Es gelte, in der<br />
Bevölkerung durch gezielte Informationen,<br />
ein Umdenken zu schaffen. Denn Dichte<br />
kann auch das gesellschaftliche Leben, den<br />
Austausch und die individuelle Entwicklung<br />
und damit die Lebensqualität im gesamten<br />
Bundesland fördern.<br />
u
7<br />
MAXIMA LED-Großflächenleuchten für den Innenraum. Für neuartige<br />
und kreative Gestaltungsmöglichkeiten in vielen Bereichen<br />
der Architektur. Großflächige und gleichmäßige Lichtverteilung.<br />
Durch messer 1000 und 1300 mm. DALI steuerbar und wahlweise<br />
mit fester oder variabler Farbtemperatur (Tunable White).<br />
BEGA Leuchten GmbH – Competence Center Innsbruck · Grabenweg 3<br />
6020 Innsbruck · Telefon 0512 34 31 50 · Fax 0512 34 31 50 89<br />
info-austria@bega.com · www.bega.com<br />
www.<strong>architektur</strong>-online.com<br />
<strong>architektur</strong>szene<br />
Das gute Licht.<br />
Für große Statements.
<strong>architektur</strong> FACHMAGAZIN<br />
8<br />
<strong>architektur</strong>szene<br />
Liberale Bauordnung –<br />
Fluch oder Segen?<br />
Auch der Vorarlberger Bauordnung ist zu<br />
verdanken, dass Architekten beim Entwurf<br />
ihrer Projekte zum Teil große Freiheiten gewährt<br />
wurden. Damit war es Planern möglich,<br />
im westlichen Bundesland eine große<br />
Zahl experimenteller und innovativer Bauten<br />
zu realisieren.<br />
Doch hatten und haben die liberalen Vorschriften<br />
nicht nur Vorteile – dies gilt insbesondere<br />
dann, wenn die damit verbundenen<br />
Effekte auf Bevölkerung und Landschaft<br />
betrachtet werden. Die Mehrzahl der Einfamilienhäuser<br />
wird schließlich von Privatpersonen<br />
und damit oft ohne Abstimmung<br />
auf das bestehende Ortsbild in Auftrag<br />
gegeben. Faktoren wie die fortschreitende<br />
Zersiedelung berücksichtigen die Bauherren<br />
in der Regel nicht. Und die liberale Bauordnung<br />
spielt ihnen dabei auch heute noch<br />
in die Hände.<br />
Eine nachhaltige Bauweise berücksichtigt<br />
die landschaftlichen und kulturellen Gegebenheiten<br />
der Region. Und eine auf Zersiedelung<br />
ausgerichtete Architektur wird diesen<br />
Voraussetzungen keinesfalls gerecht.<br />
Hier wäre ein Eingreifen der Gemeinden<br />
gefragt. Nur so ließe sich die zunehmende<br />
Flächenversiegelung eindämmen.<br />
Aus der Geschichte lernen<br />
Heutige Generationen haben die Chance,<br />
aus der Vergangenheit und Gegenwart<br />
Vorarlbergs zu lernen. Dabei gilt es auch,<br />
Visionen und Ratschläge der Architekten<br />
des 20. Jahrhunderts zu berücksichtigen.<br />
Denn viele Ideen, die schon damals Gültigkeit<br />
hatten, sind heute noch aktuell. Das<br />
Hauptbestreben muss darin bestehen, die<br />
© Architekturzentrum Wien, Sammlung, Foto: Margherita Spiluttini<br />
Gunter Wratzfeld, Jakob Albrecht, Eckhard Schulze-Fielitz, Achsiedlung, Bregenz, 1971 - 1982<br />
Niedriggeschossige Punkthäuser gruppieren sich um zahlreiche Höfe.<br />
bauliche Dichte im Bundesland zu fördern.<br />
Voraussetzung dafür sind nicht nur umfassende<br />
Aufklärungsmaßnahmen, sondern<br />
gleichermaßen Projekte, die Lebensqualität<br />
bieten. Dabei gilt es auch in Wohnsiedlungen,<br />
der Bevölkerung eine ausreichende<br />
Zahl an Grünflächen samt intimen Räumen<br />
zur Verfügung zu stellen. Denn der Wunsch<br />
nach Privatsphäre besteht vor allem in Gegenden<br />
mit hoher Einwohnerdichte.<br />
Ein Vorzeigeprojekt der 1970er- und<br />
1980er-Jahre ist die Achsiedlung in Bregenz.<br />
Bis heute ist sie mit ihren 50 Gebäuden<br />
und 839 Wohnungen eines der größten<br />
Siedlungsprojekte Vorarlbergs. Schachbrettartige<br />
Mehrfamilienhäuser mit untereinander<br />
verbundenen Innenhöfen prägen<br />
das Wohngebiet. Der Entwurf stammt aus<br />
der Hand der Architekten Gunter Wratzfeld,<br />
Jakob Albrecht und Eckhard Schulze-Fielitz.<br />
Auch liefern gelungene Projekte wie die „Vision<br />
Rheintal“ Lösungsansätze für das Zersiedelungsproblem.<br />
Hier gelang es Raumplanern,<br />
aus einer zerklüfteten Region ein<br />
zusammenhängendes Siedlungsgefüge zu<br />
schaffen. Durchdachten Raumordnungsprojekten<br />
der vergangen Jahrzehnte ist<br />
es zu verdanken, dass die Region Rheintal<br />
heute ein dicht besiedelter Ballungsraum<br />
und eine dynamische Agglomeration ist.<br />
Heute ist das Rheintal einer der größten<br />
Ballungsräume in Österreich.<br />
Im Laufe des 20. Jahrhunderts veränderte<br />
sich das Aussehen jener Region in Vorarlberg<br />
sehr stark. Während sie in den<br />
1960er-Jahren noch überwiegend aus verstreuten<br />
Dörfern und Kleinstädten bestand,<br />
ist sie heute ein fast geschlossenes Siedlungsband,<br />
das sich von Feldkirch bis nach<br />
Bregenz erstreckt. Ein Netz aus 29 Gemeinden<br />
verbindet die Funktionen Arbeiten, Bildung<br />
und Freizeit. Damit die Bevölkerung<br />
nicht mehr auf ihren Pkw angewiesen ist,<br />
wurde ein flächendeckendes Mobilitätsnetz<br />
erstellt. Dieses beinhaltet unter anderem<br />
Radwege sowie ein reichhaltiges Angebot<br />
an öffentlichen Verkehrsmitteln. Am Beispiel<br />
dieser Raumordnungsstrategie zeigt<br />
sich, dass sich räumliche Dichte auch als<br />
positiv und fortschrittlich erleben lässt. Mit<br />
ihr sind immerhin auch positive Effekte wie<br />
eine verbesserte Erreichbarkeit sowie ein<br />
dichteres Netz an Nahversorgern, Pflegeeinrichtungen<br />
und Unterhaltungsangeboten<br />
verbunden.<br />
u<br />
Achsiedlung, Lageplan<br />
© Architekturzentrum Wien, Sammlung
www.<strong>architektur</strong>-online.com<br />
9<br />
<strong>architektur</strong>szene<br />
<strong>2020</strong><br />
HOCHHAUS<br />
MIT BEGRÜNUNG<br />
Die CONCRETE STUDENT TROPHY ist ein Preis, der für<br />
herausragende Seminararbeiten, Projektarbeiten und<br />
Entwürfe vergeben wird, bei deren Gestaltung und<br />
Konstruktion dem Werkstoff Beton eine wesentliche<br />
Rolle zukommt.<br />
Das Thema <strong>2020</strong> ist der Vorentwurf eines Hochhauses mit Begrünung in<br />
einem der größten Stadtentwicklungsgebiete Europas, der Seestadt Aspern.<br />
Der Preis ist mit insgesamt 12.000 Euro dotiert.<br />
Das interdisziplinäre Arbeiten zwischen Architektur und Bautechnik<br />
ist bei dem zweistufig angelegten Studentenwettbewerb Voraussetzung.<br />
Teilnahmeberechtigt sind bundesweit Studierende der Architekturund<br />
Bauingenieurfakultäten der österreichischen Universitäten.<br />
Ab März <strong>2020</strong> finden Sie alle Unterlagen unter<br />
www.zement.at.
<strong>architektur</strong> FACHMAGAZIN<br />
10<br />
<strong>architektur</strong>szene<br />
© Adolf Bereuter<br />
Cukrowicz Nachbaur Architekten, Vorarlberg Museum, Bregenz, 2008 - 2012, Eingangsfassade<br />
Vorbildliche Kooperationskultur<br />
schafft Potenzial<br />
Die Leiterin des vai, Verena Konrad, sieht<br />
die Vorbildfunkion des westlichen Bundeslands<br />
vor allem in Bezug auf die Herangehensweise<br />
bei der Projektplanung.<br />
Dies gelte insbesondere in Hinblick auf die<br />
Zusammenarbeit beim Entstehungsprozess.<br />
Vorarlberg lege bereits seit mehreren<br />
Jahrzehnten viel Wert auf die Kooperation<br />
verschiedener Disziplinen. So sei es gemäß<br />
Konrad möglich, gut funktionierende Gemeinschaftsleistungen<br />
zu entwickeln. Herausforderungen<br />
muss sich das Bundesland<br />
– hier ist sich die Leiterin des vai mit allen<br />
Experten einig – beim richtigen Umgang<br />
mit knappem Bauland stellen. Es werde<br />
trotz hohen Leerstands noch immer zu viel<br />
Fläche versiegelt.<br />
Eine Vorbildfunktion könnte Vorarlberg im<br />
Umgang mit öffentlichen Bauten erlangen.<br />
Ein Positivbeispiel der letzten Jahre ist das<br />
Bregenzer vorarlberg museum von Cukrowicz<br />
Nachbaur Architekten. Es besticht<br />
durch ein geschicktes Zusammenspiel vielseitiger<br />
Materialien wie Eiche, Lehm und<br />
Messing. Im Atrium befindet sich zudem<br />
die höchste Lehmputzwand Europas – sie<br />
misst eine stattliche Höhe von 23 Metern.<br />
Auch durch Gemeinwohlorientierung und<br />
die Information und Bildung der Bevölkerung<br />
ließe sich in der Architektur wieder ein hoher<br />
Standard erreichen. Potenzial sehe Konrad<br />
außerdem bei jungen Architekten und<br />
Planern. Während ältere Semester überwiegend<br />
in Wien bei Roland Rainer studierten,<br />
gehen Auszubildende heute oft ins Ausland<br />
und versuchen sich zuerst international. „Es<br />
handelt sich hier um eine offene Generation,<br />
die sich in viele Richtungen orientiert. Viele<br />
verlassen auch ihre Heimat, um neue Stilrichtungen<br />
kennenzulernen. Ich halte das für<br />
sehr wichtig“, erzählt die Leiterin des vai.<br />
© Hanspeter Schiess<br />
Für Vorarlberg würde es sich durchaus lohnen,<br />
sich dem Problem der Zersiedelung zu<br />
stellen. Das Ergebnis wäre nicht nur eine<br />
höhere Wohn- und Lebensqualität – Projekte,<br />
die mit dem Puls der Zeit gehen, könnten<br />
dem Bundesland erneut zu einem Stellenwert<br />
als „Geburtsstätte moderner Architektur“<br />
verhelfen.<br />
•<br />
Cukrowicz Nachbaur Architekten, Vorarlberg Museum, Bregenz, 2008 - 2012<br />
Fassadendetail mit Schriftzug und charakteristischer Struktur aus unterschiedlichen Flaschenböden
www.<strong>architektur</strong>-online.com<br />
11<br />
<strong>architektur</strong>szene<br />
OPTIMIERT THERMISCHEN<br />
KOMFORT, BLENDSCHUTZ<br />
UND ENERGIEEFFIZIENZ<br />
Halio®, das fortschrittlichste<br />
Tageslicht-Managementsystem<br />
Natürliches Tageslicht, Komfort und Wohlbefinden sind für Architekten und Projektentwickler die<br />
wesentlichen Nutzerbedürfnisse, die Büroräume, Wohn- oder Dienstleistungsgebäude erfüllen müssen.<br />
Halio Glas eröffnet völlig neue Möglichkeiten beim Design intelligenter, ästhetischer und heller Räume.<br />
Halio Glas reagiert extrem schnell und präzise und gibt dem Nutzer eine beispiellose Kontrolle über<br />
den Raum. In weniger als drei Minuten geht die Scheibe von lichtdurchlässig zu vollständig getönt über.<br />
Mit einem Farbwiedergabeindex von 97 ist Halio im ungetönten Zustand ebenso neutral und transparent<br />
wie herkömmliches Fassadenglas. Auch die energetische Performance ist beeindruckend. Mit U g -Werten<br />
bis zu 0,6 W/(m²K) zeigt sich Halio Glas beim Management von Wärmegewinnen und der Reduzierung<br />
des Kühlbedarfs höchst effizient und trägt damit wesentlich zum Erreichen von BREEAM, LEED und WELL<br />
Zertifizierungen bei.<br />
Halio Glas ist mit allen gängigen Gebäudemanagementsystemen und cloudbasierten Geräten kompatibel.<br />
Die Gläser werden wahlweise automatisch mit spezifischen Regelalgorithmen oder manuell über eine App<br />
gesteuert.<br />
Das perfekte Produkt für die Smart-City-Bewegung und eine verantwortungsvolle Architektur.<br />
Kontakt: Robert W. Jagger<br />
HALIO International<br />
Avenue Jean Monnet 4<br />
1348 Louvain-la-Neuve - Belgien<br />
M: +49 (0) 173-568 55 29<br />
robert.jagger@halioglass.com<br />
www.halioglass.eu/de
<strong>architektur</strong> FACHMAGAZIN<br />
12<br />
Magazin<br />
Donaustern - Siegerprojekt 2019<br />
Grün statt Grau<br />
Eine Interessensgemeinschaft bestehend aus Bauunternehmen und -verbänden<br />
unter der fachlichen Begleitung österreichischer Universitäten und mit inhaltlicher<br />
Unterstützung der Stadt Wien, der wien 3420 aspern development AG und des<br />
Innovationslabors GrünStattGrau vergibt <strong>2020</strong> zum 15. Mal die Concrete Student<br />
Trophy. Der Preis wird für herausragende Projekte und Seminararbeiten vergeben,<br />
die interdisziplinär entwickelt wurden und bei deren Gestaltung und Konstruktion<br />
dem Werkstoff Beton eine wesentliche Rolle zukommt.<br />
Wettbewerbsaufgabe: Hochhaus mit<br />
Begrünung in der Seestadt Aspern<br />
Vorentwurf eines Hochhauses in Betonbauweise<br />
mit Bauwerksbegrünung in einem der<br />
größten Stadtentwicklungsgebiete Europas,<br />
der Seestadt Aspern. Interdisziplinär<br />
zu planen sind Architektur und Tragwerksplanung,<br />
dabei sind Herausforderungen<br />
hinsichtlich Maßnahmen zur Anpassung an<br />
den Klimawandel sowie den Klimaschutz<br />
– insbesondere Begrünungslösungen – zu<br />
meistern. Das Projekt soll in seiner Gesamtheit<br />
positive Auswirkungen auf den<br />
umgebenden Stadtraum – insbesondere<br />
in stadtklimatischer Hinsicht – aufweisen.<br />
Eine attraktive Gestaltung der Sockelzone<br />
sowie des unmittelbaren Umfeldes soll<br />
sich positiv auf die Aufenthaltsqualität im<br />
öffentlichen Raum auswirken. Mit der Lage<br />
am Wasser sowie unmittelbar beim Aus-<br />
gang der U2 ist der Standort einer der attraktivsten<br />
Orte der Seestadt; das geplante<br />
Hochhaus soll als Landmark zu deren Unverwechselbarkeit<br />
beitragen.<br />
Allgemeines<br />
Boden ist ein knappes und kostbares Gut.<br />
Der Baustoff Beton ermöglicht es, in die<br />
Höhe wie auch in die Tiefe zu bauen und die<br />
nutzbare Fläche auf diese Weise zu vervielfachen.<br />
Leitmotiv für die Seestadt Aspern<br />
ist die Auseinandersetzung von Nachhaltigkeitsaspekten<br />
in allen Bereichen der Stadtentwicklung.<br />
Anspruchsvolle Architekturund<br />
Raumplanungskonzepte in Kombination<br />
mit ausgezeichneter Infrastruktur sollen bis<br />
2028 und darüber hinaus die Seestadt zu einem<br />
lebenswerten Stadtteil Wiens machen.<br />
Urbane Grünflächen haben vielfältige soziale,<br />
gesundheitliche, wirtschaftliche, ökologische<br />
und klimatische Funktionen und<br />
leisten einen wichtigen Beitrag sowohl zur<br />
Baukultur als auch zum Stadtklima. Durch<br />
die Begrünung wird die Sonnenstrahlung<br />
in geringerem Ausmaß reflektiert als vom<br />
Mauerwerk. Gerade in urbanen Gebieten<br />
sind Begrünungen auf Fassaden, Terrassen<br />
und Dächern eine wichtige Ergänzung zu<br />
Parks, Alleen und Gärten und schaffen zusätzlichen<br />
Erholungsraum.<br />
Abgabe:<br />
bis 13. Oktober <strong>2020</strong>, 14:00 Uhr bei<br />
Zement+Beton Handels- und Werbeges.m.b.H.<br />
TU Wien Science Center<br />
Franz-Grill-Straße 9, Objekt 214<br />
1030 Wien<br />
Weitere Informationen:<br />
www.zement.at/concretestudenttrophy
www.<strong>architektur</strong>-online.com<br />
13<br />
Magazin<br />
#70 YEARSZUM TOBEL<br />
LIGHT FIELDS III<br />
MEISTER DER ANSPRUCHSVOLLEN SEHAUFGABEN<br />
UNAUFDRINGLICHE ELEGANZ UND RAHMENLOSES DESIGN | DESIGN BY STEFAN AMBROZUS | ZUMTOBEL.COM/LIGHTFIELDS
<strong>architektur</strong> FACHMAGAZIN<br />
14<br />
Magazin<br />
SPS-Programmierkurs<br />
für Spezialisten von morgen<br />
Die „New Automation Technology“ von<br />
Beckhoff steht für universelle und branchenunabhängige<br />
Steuerungs- und Automatisierungslösungen,<br />
die weltweit in<br />
den verschiedensten Anwendungen, von<br />
der CNC gesteuerten Werkzeugmaschine<br />
bis zur intelligenten Gebäudesteuerung,<br />
zum Einsatz kommen.<br />
Im Rahmen der „Beckhoff Summer School“<br />
Wochen bieten die Beckhoff-Spezialisten<br />
an den zwei Beckhoff-Standorten in Bürs<br />
und Hartberg jungen Menschen die Möglichkeit,<br />
die Welt der PC-basierten Steuerungstechnik<br />
von Beckhoff aus erster Hand<br />
kennenzulernen. Neben den Grundbegrifflichkeiten<br />
der Steuerungs- und Digitaltechnik<br />
erlernen die Teilnehmer das Erstellen<br />
von Steuerungslogik in den Programmiersprachen<br />
der IEC-61131-3. Einfache Beispiele<br />
werden helfen, den Zusammenhang<br />
zwischen Hard- und Software im steuerungstechnischen<br />
Umfeld zu verstehen. Das<br />
dabei erworbene Wissen können die Kursteilnehmer<br />
bei ihren Abschlussarbeiten<br />
einsetzen oder das Schulungszertifikat ihrer<br />
nächsten Bewerbung beilegen. Die Teilnahme<br />
ist kostenlos und die Teilnehmeranzahl<br />
ist begrenzt.<br />
Weitere Informationen/Anmeldung:<br />
Beckhoff Automation GmbH<br />
T + 43 (0) 55 52 / 6 88 13 – 0<br />
info@beckhoff.at<br />
www.beckhoff.at<br />
Termine:<br />
Einsteiger: 13. -17. Juli<br />
Fortgeschrittene: 20. - 24. August<br />
Fortgeschrittene: 31. August - 04. September<br />
Dämmstoff-Studie<br />
Eine vom ifeu-Institut und naturplus<br />
in Deutschland durchgeführten Studie<br />
„Ganzheitliche Bewertung von verschiedenen<br />
Dämmstoffalternativen“<br />
zeigt auf, dass in Bauteilen, in denen<br />
nur Dämmstoffplatten eingesetzt werden<br />
können, Styropor am vorteilhaftesten<br />
abschneidet.<br />
Dr. Clemens Demacsek von der GPH Güteschutzgemeinschaft<br />
Polystyrol-Hartschaum<br />
in Österreich merkt dazu an: „Die Ergebnisse<br />
dieser Studie sind für Styropor erfreulich,<br />
aber nicht überraschend. Allerdings würden<br />
sie in Österreich noch einmal besser ausfallen,<br />
da eine schwere weiße Fassadenplatte<br />
mit 23 kg/m 3 berücksichtigt wurde, die es<br />
bei uns gar nicht gibt und selbst in Deutschland<br />
von untergeordneter Bedeutung ist. Bei<br />
einer weißen Standardplatte würde sich der<br />
Rohstoffeinsatz um 21 % reduzieren, bei einer<br />
grauen Platte gar um 37 %!“<br />
Insbesondere bei der werkstofflichen Verwertung<br />
von Styropor-Abfällen aus Abbruch<br />
oder Rückbaumaßnahmen weise das<br />
Dämmmaterial ein Alleinstellungsmerkmal<br />
auf. Die derzeit im Rahmen des Projektes<br />
PolyStyreneLoop mit der Zielsetzung einer<br />
nachhaltigen und länderübergreifenden<br />
Recycling-Organisation in der EU errichtete<br />
Industrieanlage wird zudem eine<br />
geschlossene Kreislaufwirtschaft für Styropor<br />
- ein echtes Recycling im Sinne von<br />
Cradle-to-Cradle (C2C) - in einem Jahr ermöglichen.<br />
Mit der dort angewendeten Verfahrenstechnik<br />
soll aus Styropor-Abfällen<br />
aus Abriss- oder Umbaumaßnahmen das<br />
Basismaterial Polystyrol wiedergewonnen<br />
und gleichzeitig das im Bau-Styropor enthaltene<br />
Flammschutzmittel in Einzelstoffe<br />
zerlegt und dann einer neuen Nutzung zugeführt<br />
werden.<br />
Dr. Clemens Demacsek, Geschäftsführung der GPH<br />
GPH Güteschutzgemeinschaft<br />
Polystyrol-Hartschaum<br />
+43 (0) 2253 / 7277<br />
gph@gph.at<br />
www.styropor.at<br />
© GPH/Schuster
www.<strong>architektur</strong>-online.com<br />
Neue Merkblätter<br />
Auf Baustellen arbeiten verschiedenste<br />
Gewerke an Projekten: Zeitdruck und<br />
mangelnde Kommunikation können dabei<br />
zu Verzögerungen, Schadensfällen und<br />
Konflikten führen. Um das zu verhindern,<br />
entwickelt der Verband Österreichischer<br />
Stuckateur- & Trockenbauunternehmungen<br />
(VÖTB) gemeinsam mit Verbänden<br />
und Innungen eine Reihe von Merkblättern.<br />
Als erstes präsentiert der Verband<br />
nun „Unser Bad“. Das praktische Regelwerk<br />
soll die Zusammenarbeit verbessern<br />
und so Reklamationen vorbeugen.<br />
Besonders beim Trockenbau existieren<br />
Schnittstellen zu beinahe jedem Gewerk<br />
im Innenausbau. Im Berufsalltag wird die<br />
Zusammenarbeit oft für alle Beteiligten<br />
zur Herausforderung. Das war Anlass, das<br />
Merkblatt „Unser Bad“ ins Leben zu rufen.<br />
„Das Badezimmer ist das perfekte erste Beispiel,<br />
denn hier treffen die meisten Gewerke<br />
aufeinander. Das Merkblatt „Unser Bad“ unterstützt<br />
alle Gewerke, ihre Arbeit effizient<br />
15<br />
zu erledigen ohne sich in die Quere zu kommen“,<br />
erklärt VÖTB-Präsident Gregor Todt.<br />
Gemeinsam mit der Bundesinnung der Sanitär-,<br />
Heizungs- und Lüftungstechniker,<br />
der Elektro-, Gebäude-, Alarm- und Kommunikationstechniker,<br />
Maler und Tapezierer,<br />
dem Österreichischen Fliesenverband,<br />
dem Verband der Österreichischen Estrichhersteller<br />
sowie dem Verband der Österreichischen<br />
Arbeitsgemeinschaft Putz (ÖAP)<br />
Magazin<br />
und dem technischen Unterkomitee Putze<br />
(TUK) wurde etwa ein Jahr an der Abstimmung<br />
gearbeitet.<br />
Das Merkblatt gilt für private Bäder und gewerbliche<br />
Sanitäranlagen und umfasst alle<br />
Punkte, die für die erfolgreiche Umsetzung<br />
eines Badezimmers wichtig sind.<br />
Kostenloser Download:<br />
www.voetb.at/service/dokumente.<br />
© shutterstock/Kanghophoto<br />
l<br />
a e H t<br />
L<br />
y h t<br />
v<br />
i<br />
g<br />
n i<br />
i<br />
m u a B<br />
W E R T E<br />
I N N E R E<br />
M A S S E<br />
D Ä M M E N<br />
K L A I S T<br />
F<br />
I R S T<br />
Baumit<br />
open<br />
Klimaschutz<br />
Fassaden<br />
Höchste Atmungsaktivität für mehr Klimaschutz<br />
Gesundes Raumklima beginnt mit gut gedämmten Wänden, damit es<br />
im Winter behaglich warm und im Sommer angenehm kühl im Haus<br />
bleibt. Je atmungsaktiver die Dämmung, desto besser. Mit Baumit open<br />
Wärmedämmverbundsystemen: Baumit open air, open nature und<br />
open mineral. Atmungsaktiv dämmen mit Luft, Holz oder Stein.<br />
■ Energie sparen und Klima schützen<br />
■ für ein behagliches & gesundes Raumklima<br />
■ hohe Lebensdauer<br />
Baumit. Ideen mit Zukunft.
<strong>architektur</strong> FACHMAGAZIN<br />
16<br />
Magazin<br />
Grüne Rechtecke<br />
der Begegnung<br />
Ganz im Zeichen der gemischten Nutzung steht das Projekt „Sky Green“ der Designfirma<br />
WOHA. Im Herzen von Taichung City in Taiwan ist das Bauwerk mit über<br />
104 Metern Höhe angesiedelt, das sich aus zwei verschieden großen Rechtecken<br />
zusammensetzt. Während in den unteren Stockwerken Geschäfte angesiedelt sind,<br />
ist der Raum ab dem vierten Geschoss Wohnungen vorbehalten.<br />
Fotos: Koumin Lee<br />
Bemerkenswert ist aber nicht nur der Nutzungsmix.<br />
Vielseitigkeit beweist das Projekt auch in Bezug auf<br />
seine Fassade. Gestützt durch ein vertikales Gerüst,<br />
ranken sich bis in die oberen Stockwerke Kletterpflanzen.<br />
Sie verleihen dem Bau Lebendigkeit und schirmen<br />
die Bewohner vor direkter Sonneneinstrahlung<br />
ab. Zusätzlich säumen Terrassen mit Beeten die Fassade.<br />
Bereichert werden sie von zentral eingepflanzten<br />
Bäumen. Laut den Planern handelt es sich bei diesen<br />
Grünflächen um offene und trotzdem geschützte<br />
„Himmel-Gärten“. Ebendiese stellen ein für Taiwan<br />
innovatives Konzept dar, wobei sie gleichzeitig dem<br />
Trend der Nachhaltigkeit folgen. Den Bewohnern des<br />
Hochhauses steht damit selbst in einer dicht besiedelten<br />
Stadt wie Taichung Grünraum zur Verfügung.
www.<strong>architektur</strong>-online.com<br />
17<br />
Magazin<br />
Die Grünflächen haben nicht nur funktionalen Charakter.<br />
Denn den Planern war es wichtig, dass sie<br />
auch als Freiraum nutz- und erlebbar sind. Und das<br />
gelang ihnen durch die geschickte Öffnung des Baus.<br />
Alle Stockwerke bieten den Bewohnern Zugang ins<br />
Freie und die Terrassengärten können jederzeit betreten.<br />
Diese Eigenschaft macht die Grünflächen<br />
gleichzeitig zu Orten der Begegnung.<br />
Positiv wirkt sich der Bau aber nicht nur auf die<br />
Menschen, sondern auch auf die Umgebung aus. Als<br />
grüne Lunge und Auflockerung fungiert er inmitten<br />
stark befahrener Straßen. Das prominente Hochhaus<br />
integriert sich ins Ortsbild, wobei es die Stadt gleichzeitig<br />
bereichert. Seine Höhe und Form wurde der<br />
umliegenden Bebauung angepasst. Trotzdem geht<br />
das Gebäude nicht unter. Zu verdanken ist dies dem<br />
natürlichen Grün, das obendrein einem steten Wandel<br />
unterworfen ist. Wechselndes Wetter und Jahreszeiten<br />
lassen die Bepflanzung in einem vielseitigen<br />
Licht erstrahlen.<br />
Die harmonische Konzeption ist ein Musterbeispiel<br />
dafür, wie sich Grünraum stimmig in eine dicht besiedelte<br />
Stadt wie Taichung City integrieren lässt.<br />
DOPPELT<br />
HÄLT<br />
EINFACH<br />
BESSER.<br />
Setzen Sie auf die CLArin von ASCHL. Punkt.
<strong>architektur</strong> FACHMAGAZIN<br />
18<br />
Magazin<br />
Die Vielseitigkeit<br />
des Raums<br />
Eine Mischung aus grünen Taschen und massiven Materialien kennzeichnet das Projekt<br />
von Stu/D/O architects in Bangkok. Das Bürogebäude der thailändischen Firma<br />
MacroCare besticht durch eine Kombination aus Moderne und Natur – eine Formel,<br />
die neben vielseitigen visuellen Reizen einladende Arbeitsbedingungen schafft.<br />
Fotos: SpaceShift Studio<br />
Auf den ersten Blick sticht dem Betrachter die solide<br />
Aluminiumfassade ins Auge. Das gelungene Zusammenspiel<br />
verschiedener Grautöne schafft hier<br />
Abwechslung. Doch hat das Material nicht nur einen<br />
optischen, sondern auch einen funktionalen Nutzen.<br />
So dient es dazu, die heißen Sonnenstrahlen auf der<br />
Westseite abzuwehren. Kleine Öffnungen sorgen für<br />
Ventilation und damit für Kühlung des Gebäudes. Für<br />
visuelle Auflockerung sorgen die sogenannten „grünen<br />
Taschen“, die das Gebäude gleich auf mehreren<br />
Ebenen schmücken und für eine Auflockerung der<br />
Struktur sorgen. Ihre Hauptaufgabe besteht darin,<br />
die Aufenthaltsqualität im Gebäude selbst zu erhöhen.<br />
So sind sie nicht nur von außen, sondern auch<br />
vom Inneren des Baus aus zu sehen.<br />
Den Eingangsbereich ziert ein künstlich angelegter<br />
Teich. Er reflektiert die Fassade, wobei sich durch<br />
seine geschickte Platzierung interessante Lichteffekte<br />
ergeben. Eine Ode an die Natur ist auch das übrige<br />
Design des Eingangs. Seine filigranen Strukturen<br />
und sanften Formen erinnern an Bäume und Hölzer,<br />
die einen Fluss säumen. Trotzdem sind die verwendeten<br />
Materialien solide und vermitteln Stabilität. Ein<br />
einzigartiges Erlebnis bieten Besuchern auch die hohen<br />
Innenräume mitsamt der großen Glasfront. Den<br />
Innenbereich dominiert eine Kombination aus sanftem<br />
Grau und mattem Weiß. Die Farben schaffen eine<br />
Projektions- und Arbeitsfläche, die die Ideenfindung<br />
im Alltag fördern soll. Im Zusammenspiel mit der Bepflanzung<br />
ergeben sie eine interessante Mischung.
www.<strong>architektur</strong>-online.com<br />
19<br />
Magazin<br />
Den Zentralbau prägt die Leere. Und dies ist durchwegs<br />
positiv. Denn eine mittig angelegte Freifläche<br />
schafft einen Ausgleich zur massiven Kernstruktur.<br />
Auch begünstigt sie den Einfall von natürlichem<br />
Licht. Durch den zentral angelegten Schacht wird die<br />
imposante Baustruktur aufgelockert. Auch schafft er<br />
vom Inneren des Gebäudes aus visuelle Verbindungen,<br />
die Abwechslung und eine einladende Atmosphäre<br />
kreieren. Den Architekten war es so möglich,<br />
jeden Aufenthaltsraum an eine Freifläche zu koppeln.<br />
Außenräume mit Bäumen und Sitzgelegenheiten laden<br />
zum Verweilen ein.<br />
Beim Entwurf des Baus schufen die Planer nicht nur<br />
Grün- und Freiräume, sondern auch kommunikationsfördernde<br />
Räume. Die offene, auf Freiflächen<br />
ausgerichtete Bauweise soll den Austausch der Mitarbeiter<br />
untereinander fördern. Damit gelang es den<br />
Architekten, dem Leitspruch „vertraute Verbindung“,<br />
der auch das Motto des thailändischen Unternehmens<br />
ist, mit ihrem Projekt Ausdruck zu verleihen.
<strong>architektur</strong> FACHMAGAZIN<br />
20<br />
Magazin<br />
Die Stadt darunter<br />
In Downtown Montreal wurde der neue Restaurantbereich Le Cathcart Restaurants<br />
et Biergarten von Sid Lee Architecture in Zusammenarbeit mit Menkès<br />
Shooner Dagenais LeTourneux Architectes am Place Ville Marie gestaltet und im<br />
Jänner <strong>2020</strong> eröffnet. Das Besondere daran: Er ist Bestandteil eines unterirdischen<br />
Stadtgefüges mit Verbindungstunnel, Eingängen und Ausgängen. Die Stadt<br />
wird so mit einem unterirdischen Netz verbunden und nach unten hin erweitert.<br />
Fotos: Sid Lee Architecture, Menkès Shooner Dagenais LeTourneux, Seele
www.<strong>architektur</strong>-online.com<br />
21<br />
Magazin<br />
Dem Place Ville Marie liegt ein radikaler Entwurf zugrunde<br />
der in den Jahren 1958-62 umgesetzt wurde:<br />
Der Pritzker-Preisträger I. M. Pei gestaltete zusammen<br />
mit Henry N. Cobb einen Bürokomplex mit dazugehörigem<br />
Wolkenkratzer, bei dem beinahe die Hälfte<br />
seiner Fläche unter dem Straßenniveau liegt. Dieser<br />
Entwurf ließ weiterführend die Idee einer Untergrundstadt<br />
entstehen, die verschiedene U-Bahnstationen,<br />
öffentliche Bauten, Büro- und Wohngebäude<br />
miteinander verbindet und vor klimatischen Einflüssen<br />
schützt. Heute sind die weitesten Bereiche des<br />
Stadtzentrums von Montreal über dieses über 30 km<br />
lange Untergrundnetz miteinander verbunden.<br />
Damals wie heute gehört auch der Place Ville Marie<br />
als dessen ältester Bestandteil dazu. Als erster<br />
Schritt wurde in seinem unterirdischen Teil eine<br />
neue Gastronomie-Meile geschaffen. Ein Highlight<br />
stellt neben dem vielfältigen kulinarischen Angebot<br />
auch das 630 m² große Glasdach dar. Dabei handelt<br />
es sich um eine Glasglaskonstruktion: Isolierglaseinheiten<br />
sind auf Glasträgern gelagert und vermitteln<br />
einen schwebenden Eindruck. Man befindet sich<br />
zwar im Innenraum, bekommt aber dennoch etwas<br />
von den äußeren Geschehnissen mit – ein besonderes<br />
Erlebnis ist es wohl, sich bei Regen unter dem<br />
Glasdach zu befinden.<br />
u<br />
MEHR LICHT,<br />
MEHR RAUM,<br />
MEHR RUHE<br />
Mit dem Trennwandsystem<br />
Variflex gestalten Sie Räume<br />
schnell und kom for tabel<br />
genau nach Bedarf. Die Kombination<br />
mit Glas-Elementen<br />
ermöglicht eine Raumteilung<br />
mit maximaler Transparenz und<br />
gleichzeitigem Schallschutz.<br />
T +43 732 600451<br />
office@dorma-hueppe.at<br />
www.dorma-hueppe.at
<strong>architektur</strong> FACHMAGAZIN<br />
22<br />
Magazin
www.<strong>architektur</strong>-online.com<br />
23<br />
Magazin<br />
Der Umgestaltung des Restaurantbereiches wird die<br />
Revitalisierung des darüberliegenden Platzes Esplanade<br />
folgen. Dieser soll als notwendiger öffentlicher<br />
Außenraum in Downtown gefördert und als wichtigster<br />
innerstädtischer Treffpunkt positioniert werden.<br />
Auf Straßenniveau und auch darunter wird so ein<br />
Mehrwert für die Stadt geschaffen von dem ihre Bewohner<br />
und Bewohnerinnen profitieren – sowohl in<br />
dem Sinne, dass sie wettergeschützt ihre Wege zurücklegen<br />
können und auch, dass sie eine angenehme<br />
Umgebung haben, um ihre Freizeit zu genießen.<br />
Den Restaurantbereich Le Cathcart, sowie die gesamte<br />
Untergrundstadt selbst, kann man als eine<br />
innenräumliche Erweiterung unter der eigentlichen<br />
Stadt sehen. Ursprünglich war diese als Schutz vor<br />
kalten Wintertagen und dem in Montreal häufigen<br />
Regenwetter angedacht. Auch an heißen Tagen<br />
bietet der kühlere Untergrund eine Zufluchtsmöglichkeit.<br />
Dieser Nutzen wird wohl in Zukunft an Bedeutung<br />
gewinnen, weitere Revitalisierungen und<br />
Erweiterungen werden wohl folgen. So kann man in<br />
der Untergrundstadt versuchen dem Klimawandel<br />
zumindest für kurze Zeit zu entkommen. Der neue<br />
Restaurantbereich Le Cathcart im Montrealer Place<br />
Ville Marie bietet jedenfalls eine willkommene Atmosphäre<br />
dazu.<br />
•<br />
BEWEGLICHE GLASFASSADEN<br />
FÜR BALKONE MIT MEHRWERT: Effektiver Schall- und Wetterschutz<br />
raumhoch oder auf Brüstung · komplett zu öffnen · individuelle Projektlösungen<br />
solarlux.com
<strong>architektur</strong> FACHMAGAZIN<br />
24<br />
Magazin<br />
Industrielle Eleganz<br />
Bereits zum zweiten Mal an diesem Ort setzte sich das italienische Architektenduo<br />
GEZA mit der Gestaltung von Industrie<strong>architektur</strong> auseinander.<br />
Schon 2011 wurde es mit dem Firmensitz des norditalienischen Unternehmens<br />
Pratic beauftragt, das alles für „Open air culture“ herstellt: Pergolen,<br />
Markisen und Außenstrukturen.<br />
Fotos: Javier Callejas<br />
Hier wird aber nicht nur produziert, sondern auch<br />
verwaltet, präsentiert, geforscht, gelagert und die<br />
Mitarbeiter können sich im hauseigenen Wellnessbereich<br />
auch entspannen. Die Unterbringung dieser<br />
Vielzahl an Funktionen war nur durch die Vergrößerung<br />
des Gebäudes möglich, das sich durch die Erweiterung<br />
etwas mehr als verdoppelte.
www.<strong>architektur</strong>-online.com<br />
25<br />
Magazin<br />
Die Entscheidung, mit der Erweiterung wieder das<br />
Architekturbüro GEZA zu beauftragen, basierte auf<br />
der Erwartung der Auftraggeber, dass dadurch der<br />
Bau nicht nur wie aus einer Hand wirkt, sondern auch<br />
ist. Sowohl der alte als auch der neue Gebäudeteil<br />
verfügen über einen rechteckigen Grundriss und treffen<br />
auf der breiten Seite zusammen. An der Fassade<br />
setzen sich beide Gebäudeteile gut voneinander ab,<br />
man erkennt aber auch verbindende Elemente. Die<br />
rhythmische Positionierung der Fensteröffnungen als<br />
längliche Schlitze wurde fortgesetzt, das gewählte<br />
Fassadenmaterial unterscheidet sich. Die schwarzen<br />
Betonplatten des bestehenden Gebäudeteils treffen<br />
auf die Polycarbonatplatten des neuen Bauteils. Diese<br />
ummanteln die dahinterliegende Tragstruktur aus<br />
Beton und erstrecken sich mit ihrer Länge von zehn<br />
Metern vertikal über die gesamte Höhe der Fassade.<br />
Die Verbindung beider Gebäudeteile lässt an der<br />
Fassade einige Gegensätzlichkeiten zusammentreffen:<br />
hell und dunkel, leicht und schwer. Der Bau<br />
wirkt dennoch ganzheitlich und führt Industrie mit<br />
Eleganz zusammen.<br />
ROTOP®<br />
DIE TRAGENDE ROLLE<br />
IN IHREM BAUWERK<br />
WWW.CONCRETE-SOLUTIONS.EU
<strong>architektur</strong> FACHMAGAZIN<br />
26<br />
Magazin
www.<strong>architektur</strong>-online.com<br />
27<br />
Magazin<br />
Utopie? Vision?<br />
Die Natur unterwerfen, oder sich der Natur unterwerfen −kann es denn kein<br />
Miteinander geben? Die Architektin und Architekturtheoretikerin Margot<br />
Krasojević plädiert zur Beantwortung dieser Fragen für ein Erkennen von<br />
Potenzialen der Natur, um diese mit der Architektur nutzen zu können. Sie<br />
verfolgt dabei einen radikalen Ansatz, der aber gleichzeitig sehr lösungsorientiert<br />
ist. Mit ihren zukunftsvisionären Entwürfen möchte sie mögliche Antworten<br />
auf komplexe Fragestellungen der Gegenwart für die Zukunft liefern.<br />
Renderings: Margot Krasojević<br />
Als fundamentalen Ausgangspunkt sieht sie das<br />
Überdenken von etablierten Gebäudetypologien. So<br />
müssen Vorhandene neu definiert werden und auch<br />
noch Weitere entstehen, die bis dato noch gar nicht<br />
existent sind. Dazu zählt, dass jedes Gebäude als ein<br />
kleines Kraftwerk gesehen wird, das mithilfe der Natur<br />
nachhaltige Energie produziert. Um diesen effektiven<br />
Mehrwert der Architektur zu erzeugen, muss<br />
man deren Umwelt kennen und verstehen lernen.<br />
Die Vision<br />
Für die russische Küstenstadt Sotschi am Schwarzen<br />
Meer wurde Architektin Margot Krasojević beauftragt,<br />
einen Entwurf für eine Küstengalerie zu gestalten.<br />
Sie sieht das Potenzial, das in der Kraft der<br />
brechenden Wellen liegt, und schlägt vor, dieses zu<br />
nutzen. Fünf Turbinen sollen die Wasserkraft in Energie<br />
umwandeln, sodass damit nicht nur das Galeriegebäude<br />
selbst, sondern auch 200 Haushalte der näheren<br />
Umgebung versorgt werden können.<br />
Zum Ausdruck gebracht wird diese technische Eigenheit<br />
des Gebäudes durch einen expressiven futuristischen<br />
Ausdruck. Was Architektur und Technik hier<br />
schaffen, soll den Besucherinnen und Besuchern der<br />
Galerie nähergebracht werden: Der Wellengang unter<br />
Wasser wird durch Projektionen simuliert und in den<br />
Innenraum übertragen. Um dem Ganzen noch mehr<br />
Dynamik zu verleihen, soll Meerwasser von den Turbinen<br />
auf das Glasdach des Galerieraumes spritzen.<br />
Ob es zu einer Realisierung dieser Vision kommt ist<br />
unklar, derzeit handelt es sich lediglich um einen<br />
Entwurf. Trotzdem wird in diesem Projektstadium die<br />
Zielsetzung sehr deutlich: die Integration von Nachhaltigkeit<br />
in den Designprozess und das Bauen mit<br />
der Natur. „We need to adapt and this will involve new<br />
environments to claim.“, wird hier als Leitsatz der Architektin<br />
großgeschrieben.<br />
Auf der Suche nach neuen Wegen, um Natur und Architektur<br />
als gleichberechtigte Partner zusammenzubringen,<br />
entstehen bei Margot Krasojević expressive<br />
Entwürfe, die alle konventionellen Denkweisen<br />
verwerfen und einen (noch) utopischen Ansatz verfolgen:<br />
die Symbiose von Architektur mit der Erzeugung<br />
von nachhaltiger Energie. Hoffentlich wird aus<br />
dieser Vision bald Realität.
<strong>architektur</strong> FACHMAGAZIN<br />
28<br />
Bau & Recht<br />
Haftungsgefahr für die<br />
örtliche Bauaufsicht?<br />
Der Oberste Gerichtshof hat erstmals entschieden, dass ein Regress des Werkunternehmers<br />
gegenüber der vom Bauherrn beauftragten örtlichen Bauaufsicht möglich<br />
und nicht grundsätzlich von vornherein ausgeschlossen ist. Die Haftung der örtlichen<br />
Bauaufsicht ist jedoch einzelfallbezogen zu beurteilen.<br />
Text: Ing. Mag. Julia Haumer-Mörzinger und Mag. Matthias Nödl<br />
Bei umfangreicheren Bauvorhaben sowie<br />
bei unerfahrenen und fachlich unkundigen<br />
Bauherrn werden immer häufiger fachkundige<br />
Unternehmen oder Personen (z.B.<br />
Architekten, Ziviltechniker, Bauingenieure<br />
oder sonstige Konsulenten) mit den Aufgaben<br />
der örtlichen Bauaufsicht beauftragt,<br />
deren Entgelt vom Bauherrn zu leisten ist.<br />
Die örtliche Bauaufsicht vertritt den Bauherrn<br />
auf der Baustelle und fungiert als<br />
zentraler Ansprechpartner des Bauherrn<br />
für die ausführenden Werkunternehmer.<br />
Nach ständiger Rechtsprechung stellt der<br />
Vertrag zwischen Bauherrn und örtlicher<br />
Bauaufsicht keinen Vertrag mit Schutzwirkung<br />
zugunsten Dritter – somit nicht zugunsten<br />
der bauausführenden Werkunternehmer<br />
– dar. Die Überwachung der von<br />
den Werkunternehmern zu erbringenden<br />
(Bau-)Leistungen durch die örtliche Bauaufsicht<br />
erfolgt ausschließlich im Interesse<br />
des Bauherrn. Die örtliche Bauaufsicht soll<br />
den Bauherrn durch ihre Qualifikation und<br />
Sachkenntnis vor mangelhaften Bauausführungen<br />
schützen, die dem Verantwortungsbereich<br />
der bauausführenden Werkunternehmer<br />
entspringen, jedoch nicht die<br />
Haftung der bauausführenden Werkunternehmer<br />
mindern oder diese gar von deren<br />
Verantwortung entlasten.<br />
Zur Beurteilung eines allfälligen Regressanspruchs<br />
des Werkunternehmers gegenüber<br />
der örtlichen Bauaufsicht ist jedoch zuvor<br />
die Tätigkeit der örtlichen Bauaufsicht zu<br />
definieren, wenn der Tätigkeitsumfang<br />
nicht gesondert im Vertrag mit dem Bauherrn<br />
festgelegt ist.<br />
Gemäß der ständigen Rechtsprechung<br />
des Obersten Gerichtshofes gehören zur<br />
Tätigkeit der örtlichen Bauaufsicht all jene<br />
Kontrolltätigkeiten, die sich unmittelbar auf<br />
den Baufortschritt beziehen und nur im Zusammenhang<br />
mit eigenen Wahrnehmungen<br />
auf der Baustelle sinnvoll ausgeübt werden<br />
können (z.B. die Überwachung der Herstellung<br />
des Werkes auf Übereinstimmung<br />
mit den Plänen, auf Einhaltung der technischen<br />
Regeln, der behördlichen Vorschriften<br />
und des Zeitplanes, die Abnahme von<br />
Teilleistungen und die Kontrolle der für die<br />
Abrechnung erforderlichen Abmessungen,<br />
die Führung des Baubuches etc.). Sonstige<br />
Überwachungs- und Kontrolltätigkeiten<br />
sind nicht als solche der örtlichen Bauaufsicht<br />
zu werten.<br />
Schon bisher konnte der bauausführende<br />
Werkunternehmer Regressansprüche gegenüber<br />
der örtlichen Bauaufsicht geltend<br />
machen, sofern die örtliche Bauaufsicht<br />
nicht nur mit Kontrolltätigkeiten beauftragt<br />
war. Beispielsweise wurde dem Werkunternehmer<br />
gegenüber der örtlichen Bauaufsicht,<br />
die auch mit der Baukoordination<br />
beauftragt war und diese Pflichten verletzt<br />
hat, ein Regressanspruch zuerkannt.<br />
Die Frage, ob ein Werkunternehmer und<br />
die örtliche Bauaufsicht, die lediglich mit<br />
Kontrolltätigkeiten beauftragt wurde, als<br />
Solidarschuldner gegenüber dem Bauherrn<br />
haften und somit eine Schadensteilung gemäß<br />
§§ 1302 iVm 896 ABGB anwendbar ist,<br />
war jedoch bisher unklar. Diese Frage hat<br />
nun der 8. Senat des Obersten Gerichtshofes<br />
in seiner Entscheidung vom 18.11.2019<br />
zu 8 Ob 88/19b entschieden.<br />
Voraussetzung für die Solidarhaftung –<br />
Haftung mehrerer Personen zur ungeteilten<br />
Hand – gegenüber dem Bauherrn gemäß<br />
§ 1302 ABGB ist eine Verletzung der jeweiligen<br />
Sorgfaltspflicht. Das bedeutet, eine<br />
Solidarhaftung gegenüber dem Bauherrn<br />
liegt nur vor, wenn der bauausführende<br />
Werkunternehmer seine Leistung mangelhaft<br />
erbringt, die örtliche Bauaufsicht<br />
ebenfalls ihre Kontrollpflichten verletzt und<br />
der jeweilige Anteil am Gesamtschaden<br />
nicht festgestellt werden kann. Die örtliche<br />
Bauaufsicht haftet daher bei eigener ordnungsgemäßer<br />
Pflichterfüllung gegenüber<br />
dem Bauherrn oder dem bauausführenden<br />
Werkunternehmer nicht für ein mangelhaft<br />
erbrachtes Werk.<br />
Der Oberste Gerichtshof hat nunmehr in<br />
diesem Zusammenhang ausgesprochen,<br />
dass ein rechtswidriges Verhalten nur im<br />
Verhältnis zum Bauherrn eine Rolle spielt.<br />
Entscheidend ist somit nicht, ob das Verhalten<br />
des einen Mitschädigers gegenüber<br />
dem anderen Mitschädiger rechtswidrig ist.<br />
Daher kann aus einem fehlenden Rechtswidrigkeitszusammenhang<br />
zwischen dem<br />
Werkunternehmer und der örtlichen Bauaufsicht<br />
keine Beschränkung der Regressmöglichkeit<br />
abgeleitet werden.<br />
Bei der Solidarhaftung mehrerer Schädiger<br />
– sofern der jeweilige Anteil am Schaden<br />
nicht bestimmbar ist – kommt der allgemeine<br />
Grundsatz „Alle für Einen und Einer<br />
für Alle“ zum Tragen. Der Bauherr kann somit<br />
frei entscheiden, welcher der Mitschädiger<br />
in Anspruch genommen wird und<br />
den Schaden einstweilen tragen muss. Der<br />
Gesamtschuldner kann sich gemäß § 1302<br />
letzter Satz ABGB wiederum den Regressanspruch<br />
gegenüber den anderen Mitschädigern<br />
vorbehalten.
www.<strong>architektur</strong>-online.com<br />
| BA12-17G |<br />
Bau & Recht<br />
Das Gebäude der Zukunft<br />
kann auch so aussehen<br />
Ideal für Modernisierungen: Die offene,<br />
PC-basierte Gebäudeautomation<br />
von Beckhoff<br />
Dieser Regressanspruch ergibt sich auch aus § 896<br />
erster Satz ABGB, wonach ein Solidarschuldner, der<br />
im Außenverhältnis mehr leistet, als er im Innenverhältnis<br />
leisten müsste, gegenüber den anderen Solidarschuldnern<br />
einen Rückgriffsanspruch hat. Das<br />
bedeutet, wenn ein Mitschuldner gegenüber dem<br />
Geschädigten den vollumfänglichen Ersatz leistet,<br />
kann er von den anderen Mitschuldnern einen Teilbetrag<br />
zurückverlangen.<br />
Nach Ansicht des Obersten Gerichtshofes resultiert<br />
die Regressmöglichkeit aus der Konsequenz des unbewussten<br />
Zusammenwirkens durch selbstständige<br />
Handlungen von Werkunternehmer und örtlicher<br />
Bauaufsicht und führt zu keiner – wie in der Literatur<br />
vielfach behaupteten – sachlich ungerechtfertigten<br />
Entlastung des Werkunternehmers.<br />
Die geäußerten Bedenken in der Literatur – wonach<br />
Werkunternehmer bei Beauftragung einer örtlichen<br />
Bauaufsicht durch den Bauherrn anders behandelt<br />
werden als Werkunternehmer ohne gesonderte Überwachung<br />
durch eine örtliche Bauaufsicht – werden im<br />
Zuge der Bestimmung der Regressquote berücksichtigt.<br />
Für den Betrag, den der ersatzleistende Solidarschuldner<br />
zurückverlangen kann, also die Regressquote,<br />
sind einzelne Zurechnungsgründe maßgeblich.<br />
Der bauausführende Werkunternehmer schuldet gegenüber<br />
dem Bauherrn die mangelfreie Erbringung<br />
des beauftragten Werkes und somit allgemein ein<br />
aktives Tun. Die örtliche Bauaufsicht schuldet dem<br />
Bauherrn gegenüber lediglich – wie zuvor ausgeführt<br />
– eine Kontrolltätigkeit. Daraus folgt, dass der<br />
Werkunternehmer den Schaden durch aktives Tun<br />
verursacht und die örtliche Bauaufsicht nur durch<br />
eine Sorgfaltswidrigkeit bei der Erfüllung ihrer Überwachungspflicht<br />
zum Schaden beiträgt. Im Regelfall<br />
wird daher der Verschuldensgrad auf Seiten des<br />
Werk unternehmers wesentlich höher sein als jener<br />
auf Seiten der örtlichen Bauaufsicht. Daraus kann<br />
eine überwiegende oder gar alleinige Haftung des<br />
Werkunternehmers resultieren.<br />
Im Ergebnis kann der mangelhaft leistende Werkunternehmer,<br />
der den verursachten Schaden an den<br />
Bauherrn ersetzt hat, nunmehr Regress an der örtlichen<br />
Bauaufsicht nehmen. Der Regressanspruch<br />
gegen die örtliche Bauaufsicht besteht jedoch nur,<br />
sofern die örtliche Bauaufsicht ihrerseits aufgrund<br />
einer Sorgfaltswidrigkeit bei der Überwachung der<br />
Bauarbeiten einen Schaden verursacht hat und die<br />
Zurechnungsgründe im Einzelfall eine Haftung rechtfertigen.<br />
In der Praxis ist zudem je nach Sachverhalt<br />
zu prüfen, welcher Verschuldensgrad höher und ob<br />
eine allfällige Haftung der örtlichen Bauaufsicht wegen<br />
Geringfügigkeit gänzlich entfällt.<br />
www.beckhoff.at/building<br />
So wird wertvolle Bausubstanz nicht nur erhalten, sondern zukunftsfit<br />
gemacht: Mit der integralen Gebäudeautomation von Beckhoff<br />
implementieren Sie alle Möglichkeiten der Kommunikations- und<br />
Steuerungstechnik – angepasst an die individuellen Bedürfnisse der<br />
Immobilie. Alle Gewerke werden von einer einheitlichen Hard- und<br />
Softwareplattform gesteuert: Ganz gleich, ob es um die nutzungsgerechte<br />
Beleuchtung, die komfortable Raumautomation oder<br />
die hocheffiziente HLK-Regelung geht. Für alle Gewerke stehen<br />
vordefinierte Softwarebausteine zur Verfügung, die das Engineering<br />
enorm vereinfachen. Funktionserweiterungen oder -änderungen sind<br />
jederzeit möglich. Das Ergebnis: Durch die optimale Abstimmung aller<br />
Gewerke werden die Energieeinsparpotenziale voll ausgeschöpft und<br />
die Effizienz der Bewirtschaftung deutlich erhöht.<br />
Die ganzheitliche Automatisierungslösung<br />
von Beckhoff:<br />
Flexible<br />
Visualisierung/<br />
Bedienung<br />
Skalierbare Steuerungstechnik,<br />
modulare I/O-<br />
Busklemmen<br />
Modulare<br />
Software-<br />
Bibliotheken
<strong>architektur</strong> FACHMAGAZIN<br />
30<br />
Intelligente Fassade
www.<strong>architektur</strong>-online.com<br />
31<br />
Behnisch Architekten<br />
Formvollendete<br />
Fassade<br />
AGORA PÔLE de recherche sur le cancer / Lausanne, Schweiz / Behnisch Architekten<br />
Text: Linda Pezzei Fotos: David Matthiessen, Stefan Behnisch<br />
Für das Krebsforschungszentrum<br />
AGORA in<br />
Lausanne entwickelten<br />
Behnisch Architekten eine<br />
neuartige Außenfassade<br />
in Form einer durchgehenden,<br />
durchlässigen<br />
Sonnenschutzhaut, die<br />
eine Überhitzung der<br />
Fassaden verhindert und<br />
gleichzeitig ein hohes<br />
Maß an visueller Transparenz<br />
bietet. Neben den<br />
technischen Vorzügen<br />
besticht die Fassade<br />
zusätzlich durch ihre<br />
schlichte Eleganz.<br />
Die Fassade eines Bauwerkes ist buchstäblich die<br />
Haut über den Knochen, Muskeln und Sehnen des<br />
Tragwerks und Innenraums. Wie die menschliche<br />
Haut soll diese vor äußeren Einflüssen schützen. Neben<br />
dieser Schutzfunktion definiert die Fassade analog<br />
unserer Kleidung aber auch den Charakter und<br />
Stil eines Gebäudes. Zusätzlich müssen die Architekten<br />
das Zusammenspiel von Innen- und Außenraum<br />
erfolgreich entwickeln und dabei eine Vielzahl an<br />
Einflussfaktoren beachten. Behnisch Architekten ist<br />
mit der Fassade des AGORA PÔLE de recherche sur<br />
le cancer unweit des Genfer Sees in dieser Hinsicht<br />
ein kleiner Meilenstein gelungen.<br />
Der 2018 fertiggestellte Neubau des Krebsforschungszentrums<br />
auf dem Campus des CHUV (Centre<br />
hospitalier universitaire vaudois) in Lausanne<br />
stellt Arbeits- und Forschungsräume für 400 Wissenschaftler<br />
und Ärzte unter einem Dach bereit. Die<br />
Gebäudeform wurde bei der Konzeption stark von<br />
Blickachsen und bestehenden visuellen Beziehungen<br />
auf dem Grundstück beeinflusst. Im Erdgeschoss<br />
liegt der sogenannte Agora-Bereich, ein Ort der Interaktion,<br />
des Treffens und der informellen Besprechungen,<br />
der sich zur Talseite hin öffnet. Oberhalb<br />
dieses Bereichs befinden sich drei weitere Etagen mit<br />
Forschungslabors. Die Agora-Ebene soll die Kommunikation<br />
fördern. Hier sind ein Hörsaal, ein Café, ein<br />
Restaurant, Konferenzräume und Verwaltungsräume<br />
untergebracht. Auf den darüber liegenden Etagen<br />
befinden sich jeweils an der Nord- und der Südseite<br />
kleinere Gemeinschaftsbereiche, in denen sich die<br />
Mitarbeiter der Büros und Labors treffen können.<br />
Letztendlich entwickelten Behnisch Architekten für<br />
die Fondation ISREC einen skulptural anmutenden,<br />
gut ablesbaren Baukörper, der sich in die bestehenden<br />
Strukturen einfügt, und gleichzeitig eine identitätsstiftende<br />
Präsenz zeigt.<br />
Zu diesem Eindruck trägt maßgeblich auch die einzigartige<br />
Fassadenstruktur bei. Im Detail filigran und<br />
leicht, fügen sich die Strukturen im Ganzen betrachtet<br />
zu einem lebendig wirkenden Gesamten. Ähnlich<br />
einem vorüberziehenden Vogelschwarm: die Summe<br />
aller Einzelteile zusammengefügt zu einem Bild perfekter<br />
Harmonie. So wie die Gebäudeform und die<br />
räumlichen Qualitäten von Tageslicht, Proportion<br />
und Materialität geprägt sind, so basiert das Konzept<br />
der Gebäudehülle auf dem Streben nach einer<br />
optimalen Tageslichtnutzung in der Gebäudetiefe bei<br />
gleichzeitigem Schutz vor Sonneneinstrahlung.<br />
Besonderheit der Fassade ist deren große Flexibilität,<br />
die auf den unterschiedlichen Anforderungen der<br />
verschiedenen dahinterliegenden Funktionsbereiche<br />
basiert. Ob Restaurant, Café, Verwaltung, Labore, Seminarbereiche<br />
oder dienende Räume - die Fassade<br />
lässt von außen betrachtet keine exakte Ablesbarkeit<br />
zu, bietet aber dennoch individuelle Funktionalität.<br />
Mit Hilfe des feststehenden Sonnenschutzes ist eine<br />
Regulierung der direkten Sonneneinstrahlung durch<br />
individualisierte Neigungen und Tiefen der einzelnen<br />
Elemente möglich. In bestimmten Bereichen erlauben<br />
öffenbare Fenster zudem eine natürliche Be- und<br />
Entlüftung und tragen so zu einem individuellen Klimakomfort<br />
bei.<br />
u
<strong>architektur</strong> FACHMAGAZIN<br />
32<br />
Intelligente Fassade<br />
Mittlerweile auch bei anderen Projekten erprobt<br />
(unlängst beispielsweise für die ikonische adidas<br />
ARENA in Herzogenaurach), wurde die Idee des<br />
hochentwickelten, feststehenden Sonnenschutzgitters<br />
für das Projekt AGORA zum ersten Mal in der<br />
Praxis umgesetzt. Ziel der Architekten war es, einen<br />
Sonnenschutz zu schaffen, der einen nahezu ungehinderten<br />
Blick nach außen ermöglicht, gleichzeitig<br />
aber die Sommersonne fernhält, das Umgebungslicht<br />
in die Tiefe des Raumes reflektiert und die Wintersonne<br />
teilweise in den Raum einfallen lässt. Keine<br />
leichte Aufgabe.<br />
Die Lösung fanden Behnisch Architekten in Form von<br />
Gitternetzelementen, die mit unterschiedlichen Geometrien<br />
auf das skulptural anmutende Gebäudevolumen<br />
reagieren. Die mittels dreidimensionaler Computerprogramme<br />
entwickelten Details wurden im Laufe<br />
des Projekts mit Unterstützung der Klimaingenieure<br />
von Transsolar und des Lichttechnikers Robert Müller<br />
von Bartenbach konkretisiert und mit Simulationen<br />
verifiziert, bevor die Daten an den Schweizer<br />
Hersteller der Fassadenelemente übergeben wurden.<br />
Ziel war es, die einzelnen Sonnenschutzflügel auf<br />
den jeweiligen Lastensammlern mit gleichmäßigem<br />
Fugenbild zwängungsfrei montieren zu können. Das<br />
vielschichtige Gebäudevolumen mit schrägen Wänden<br />
und Ecken, die sich in geometrisch komplexen<br />
Winkeln treffen, wird durch die einheitliche Fassade<br />
harmonisiert. Anstatt einzelne Fenster hervorzuheben,<br />
wird so ein einheitliches Gesamtbild erzielt. Die<br />
Fassade fungiert als unterstützendes, verbindendes<br />
Element mit einer vorgehängten Struktur, welche die<br />
dahinterliegenden Öffnungen überspielt. u
www.<strong>architektur</strong>-online.com<br />
33<br />
Behnisch Architekten<br />
Die Außenfassade von<br />
AGORA ist als durchgehende,<br />
durchlässige<br />
Sonnenschutzhaut konzipiert<br />
und besteht aus<br />
Metallöffnungen, die sich<br />
in ihrer Tiefe und Ausrichtung<br />
an jede Fassade<br />
anpassen.
<strong>architektur</strong> FACHMAGAZIN<br />
34<br />
Intelligente Fassade<br />
Das Atrium, Haupteingang<br />
des Gebäudes,<br />
verbindet AGORA auf<br />
der Ost-Seite mit dem<br />
Nachbargebäude Bu25<br />
und dient als öffentlicher<br />
Treffpunkt.<br />
Ein gleichförmiges Gitternetz umspannt das Laborgebäude<br />
wie eine zweite Haut. Die einzelnen Fassadenelemente<br />
des Gitters unterscheiden sich je nach<br />
Fassadenseite in Tiefe und Ausrichtung und sind individuell<br />
auf die jeweilige Himmelsrichtung und den<br />
Sonnenlichteinfall zugeschnitten. Jede Fassadenfläche<br />
verwendet einen bestimmten Typus, bestehend<br />
aus zwei gefalteten, miteinander verbundenen Aluminiumteilen,<br />
die in ihren Ausprägungen variieren.<br />
Eine unsichtbare Befestigung am Lastensammler ist<br />
über Laschen an den parallelen kurzen Kanten jedes<br />
Fassadenelementes realisiert. Die Aluminiumstruktur<br />
des Lastensammlers wird an der Betonbrüstung der<br />
inneren Fassade über Stahlkonsolen gehalten, die einen<br />
Wartungslaufsteg aufnehmen. Jedes Element ist<br />
teilweise mit lasergeschnittenen Löchern versehen,<br />
um den Kontrast herabzusetzen und so Blendeffekte<br />
zu vermeiden. Anhand von Simulationen wurde die<br />
Fassade auf Sonnen- und Hitzeschutz, Lichtoptimierung<br />
und Blendung geprüft. Laut der Architekten<br />
konnte so nachgewiesen werden, dass die Leistung<br />
des feststehenden Sonnenschutzgitters einer fixen<br />
Einrichtung mit rein horizontal angelegten Verschattungselementen<br />
deutlich überlegen ist. Insbesondere<br />
im Hinblick auf die Lichtoptimierung schneide dieses<br />
neu entwickelte Sonnenschutzsystem deutlich<br />
besser ab als beweglicher Sonnenschutz.
www.<strong>architektur</strong>-online.com<br />
35<br />
Behnisch Architekten<br />
Prinzipiell ist diese Art der fest installierten und für<br />
bestimmte Anwendungsbedingungen konzipierte<br />
Gebäudehülle auf jeden Fall eine gute Lösung, um<br />
die Leistung der Gebäudehülle in Bezug auf ihre<br />
Haltbarkeit, Tageslichtoptimierung und Energieeinsparung<br />
zu verbessern. Formal gesehen überzeugt<br />
die Fassadengestaltung ohnehin – sowohl mit ihren<br />
inneren wie äußeren Werten.<br />
•
<strong>architektur</strong> FACHMAGAZIN<br />
36<br />
Intelligente Fassade<br />
AGORA Pôle de recherche sur le cancer<br />
Schnitt<br />
AGORA Pôle de recherche sur le cancer<br />
Grundriss Erdgeschoss<br />
AGORA Pôle de recherche sur le cancer<br />
Grundriss 1. OG
www.<strong>architektur</strong>-online.com<br />
37<br />
Behnisch Architekten<br />
AGORA PÔLE de recherche sur le cancer<br />
Lausanne, Schweiz<br />
Bauherr:<br />
Planung:<br />
Statik:<br />
Fondation ISREC<br />
Behnisch Architekten, Stuttgart<br />
ZPF Ingenieure AG, CH-Basel<br />
Grundstücksfläche: 22.500 m 2<br />
Planungsbeginn: 2013<br />
Bauzeit: 2015-2018<br />
Fertigstellung: 2018
<strong>architektur</strong> FACHMAGAZIN<br />
38<br />
Intelligente Fassade<br />
Symphonie im<br />
Stützenwald<br />
Wuxi Taihu Show Theatre / Wuxi / Steven Chilton Architects<br />
Text: Edina Obermoser Fotos: Kris Provoost
www.<strong>architektur</strong>-online.com<br />
39<br />
Steven Chilton Architects<br />
Für die Gestaltung des<br />
Taihu Show Theatre im<br />
chinesischen Wuxi holt<br />
sich das Londoner Büro<br />
Steven Chilton Architects<br />
Inspiration aus der Natur.<br />
Sie entwerfen einen kreisrunden<br />
Bau und verpacken<br />
diesen in eine dichte<br />
Säulenstruktur, die einem<br />
Bambuswald nachempfunden<br />
ist. Damit schaffen<br />
die Architekten nicht nur<br />
einen Hingucker, sondern<br />
verschatten außerdem die<br />
Glasfassade auf natürliche<br />
Art und Weise.<br />
Das Taihu Show Theatre entsteht in der ostchinesischen<br />
Metropole Wuxi. Diese zählt über sechs Millionen<br />
Einwohner und liegt am Tai Hu See in unmittelbarer<br />
Nähe Shanghais. Der Neubau entsteht in erster<br />
Linie als Kulisse für eine Wassershow von Franco<br />
Dragone, einem italienischen Theaterdirektor. Dieser<br />
machte sich unter anderem durch Inszenierungen<br />
des Cirque du Soleil einen Namen und soll mit der<br />
geplanten Daueraufführung zukünftig das kulturelle<br />
Angebot der Stadt bereichern.<br />
Die britischen Steven Chilton Architects konzipieren<br />
das Theater als kreisrunden Bau. Eine intelligente<br />
Gebäudehülle, die sich aus drei Komponenten zusammensetzt,<br />
zieht sämtliche Blicke auf sich und<br />
reguliert gleichzeitig das Raumklima im Inneren.<br />
Sie besteht aus einer Glasfassade, einem schattenspendenden<br />
Vordach und einem dichten Wald aus<br />
hohen Stützen. Bei der Gestaltung ließen sich die<br />
Architekten vom größten Bambuswald in China inspirieren.<br />
Dieser befindet sich in unmittelbarer Nähe<br />
von Wuxi im Nationalpark Zhuhai und zählt zu einer<br />
der beliebtesten Touristenattraktionen der Region.<br />
Das naturinspirierte Design macht den Kulturbau mit<br />
seinem charakteristischen Aussehen zu einem neuen<br />
Wahrzeichen der Stadt.<br />
Den Kern des Taihu Show Theatre stellt der zylinderförmige<br />
Saal dar, in dem die Aufführungen stattfinden.<br />
Als Herzstück des Gebäudes bietet er Platz<br />
für 2.000 Besucher. Die übrigen Räume mit Administration,<br />
Büros, Technik und Backstagebereichen sind<br />
rundherum über mehrere Geschosse verteilt angeordnet.<br />
Eine Kombination aus verputztem Betonstein<br />
an der Rückseite und vorgehängten Glaspaneelen<br />
zum Eingang hin bildet die erste Ebene der mehrschichtigen<br />
Gebäudehülle. Diese fungiert als thermischer<br />
Abschluss des Stahlbetonbaus und ist über die<br />
gesamte Höhe mit schmalen, goldenen und weißen<br />
Streifen überzogen. Durch die raumhohen Verglasungen<br />
gelangt viel Tageslicht ins Innere des Theaters,<br />
das für ein stimmungsvolles Ambiente sorgt. u
<strong>architektur</strong> FACHMAGAZIN<br />
40<br />
Intelligente Fassade<br />
Das leichte Sonnendach<br />
dient mit seiner Struktur<br />
aus lamellenartigen<br />
Dreiecken nicht nur<br />
als Schattenspender,<br />
sondern auch als oberer<br />
Abschluss der schlanken<br />
Bambusstützen.<br />
Die übrigen Schichten, die die Fassade komplettieren,<br />
dienen nicht nur der Optik, sondern senken zudem<br />
als passive Maßnahme die Kühllast. Als oberer<br />
Abschluss legt sich ein Sonnendach ringförmig um<br />
den Baukörper. Dort kragt es fast zehn Meter aus und<br />
schirmt die Glasfassade vor der einfallenden Strahlung<br />
ab. Die Architekten ahmen in Form einer zarten<br />
Dreiecksstruktur die schattenspendende Laubkrone<br />
an der Spitze der Bambushalme nach. Unzählige, trianguläre<br />
Flächen treffen, fein perforiert und in unterschiedlichen<br />
Winkeln und Größen aufeinander. Sie<br />
scheinen dabei so willkürlich angeordnet zu sein, wie<br />
das Vorbild aus der lokalen, chinesischen Natur. Die<br />
lamellenartigen Elemente sind aus golden-eloxiertem<br />
Aluminium gefertigt. Sie werfen abwechslungsreiche<br />
Schatten ins Gebäudeinnere. Dadurch erhält<br />
das Theater einen fast organischen Touch, der sich je<br />
nach Tageszeit und Blickwinkel verändert.<br />
Die Einzelteile des Sonnendachs sind auf einer ebenfalls<br />
dreieckigen Gitterstruktur montiert, welche die<br />
Lasten in die konstruktive Hauptebene des Baus abträgt.<br />
Jedes dieser Dreiecke funktioniert gleichzeitig<br />
als obere Einspannung für die über 300 Säulen, die<br />
den Abschluss der Hülle bilden und das Taihu Show<br />
Theater wie ein dichter Bambuswald umgeben. Diese<br />
kommen bei 33 m Höhe mit einem schlanken Durchmesser<br />
von lediglich 30 cm aus, sind dabei leicht in<br />
unterschiedliche Richtungen geneigt und imitieren<br />
die schmalen Halme des Bambus perfekt. Nur an einer<br />
Stelle der Fassade lichtet sich der Stützenwald<br />
und markiert den Haupteingang des Kulturbaus.<br />
Dieser wird von einem kleinen Vordach geschützt,<br />
das sich aus dreieckigen Elementen zusammensetzt<br />
und damit die Gestaltung der Lamellenstruktur des<br />
Dachs wieder aufgreift.<br />
Ein zentraler Punkt der Planung lag in der Positionierung<br />
der einzelnen Stützen. Mittels „Swarm Intelligence“,<br />
einer generativen Methode zur Simulation<br />
verschiedener Szenarien anhand einzelner Parameter,<br />
entwickelten die Planer des britischen Architekturbüros<br />
die endgültige Anordnung. Dabei wurden<br />
mithilfe eines Algorithmus in mehreren Schritten verschiedene<br />
Konstanten geprüft, angepasst und sukzessive<br />
übereinandergelegt. Neben der Dichte des<br />
Säulenwaldes, die eine ausreichende Verschattung<br />
des Theaters und Schutz vor Einblicken garantiert,<br />
wurden die Mindestabstände zwischen den einzelnen<br />
Halmen sowie die Projektionsfläche des Sonnendachs<br />
berücksichtigt und damit das Arrangement<br />
der feingliedrigen Säulen optimiert.
www.<strong>architektur</strong>-online.com<br />
41<br />
Steven Chilton Architects<br />
N<br />
N<br />
or plan, 1:600<br />
00<br />
Besonders bei Nacht zieht der Kulturbau sämtliche<br />
Blicke auf sich. Die Stützen sind rückseitig indirekt<br />
beleuchtet und machen die Fassade zum diffusen<br />
Leuchtmittel, das sich in der glatten Oberfläche des<br />
Tai Hu Sees widerspiegelt. Verschiedenfarbige Lichter<br />
lassen das Theater nicht nur magisch inmitten der<br />
Dunkelheit erstrahlen, sondern sollen die Neugierde<br />
der Passanten auf die Wassershow im Inneren wecken.<br />
Das Taihu Show Theatre zeigt auf eindrucksvolle<br />
Weise, welche Vorteile naturinspirierte Designs und<br />
deren behutsame Übersetzung in zeitgemäße Architektur<br />
mit sich bringen. Neben der optischen Komponente<br />
und dem Wiedererkennungswert, den die<br />
Stützen dem Bau verleihen, können durch die Fassadengestaltung<br />
aufwändige Gebäudetechniksysteme<br />
auf ein Minimum reduziert und damit vor allem auf<br />
lange Sicht viele Kosten eingespart werden. •<br />
Wuxi Taihu Show Theatre<br />
Wuxi, Jiangsu, China<br />
Bauherr:<br />
Planung:<br />
Mitarbeiter:<br />
Sunac China Holdings<br />
Steven Chilton Architects<br />
Steven Chilton, Roberto Monesi, Xuecheng Wang<br />
Statik:<br />
Buro Happold<br />
Bebaute Fläche: 25.000 m 2<br />
Planungsbeginn: 11/2016<br />
Bauzeit:<br />
3 Jahre<br />
Fertigstellung: 12/2019
<strong>architektur</strong> FACHMAGAZIN<br />
42<br />
Intelligente Fassade<br />
Signatur<br />
im Hinterhof<br />
Fondation-s / Paris / Lobjoy Bouvier Boisseau<br />
Text: Peter Reischer Fotos: Baptiste Lobjoy, Jean-Philippe Caulliez<br />
Das Projekt der Lobjoy-Bouvier-Boisseau Architecture<br />
aus Frankreich, in einem Hinterhof an der Rue<br />
des Archives gelegen, verzichtet auf große Gesten,<br />
ist sehr unaufgeregt und trotzdem sehenswert. Wobei<br />
das Adjektiv „sehenswert“ gar nicht so zutreffend<br />
ist. Es ist zwar sehenswert aber nicht so einfach zu<br />
sehen und zu finden. Denn die Attraktion dieser Architektur<br />
befindet sich im hinteren Teil eines tiefen<br />
Grundstückes im Herzen von Marais. Es ist eines<br />
von vielen Beispielen, die auf ganz unterschiedliche<br />
Weise zeigen, wie die Fassade als Haut oder Zeichen<br />
einer Architektur benutzt werden kann.<br />
Hier, im zweiten Hof eines gründerzeitlichen, zweigeschossigen<br />
Hauses, haben die Architekten für<br />
zwei ganz unterschiedliche Auftraggeber, für die<br />
Fondation Henri Cartier-Bresson (siehe Kasten) und<br />
die Fondation François Sommer ein neues Zentrum<br />
geschaffen. Sie haben das Gebäude mit seinen gemischten<br />
Funktionen (Wohnen, Werkstatt, Geschäfte)<br />
komplett neu organisiert und einen Platz für Ausstellungen,<br />
Arbeitsräume, Öffentlichkeit und auch<br />
Zurückgezogenheit und Schutz geschaffen. Möglich<br />
wurde dieser Schritt durch den teilweisen Abbruch<br />
einer ehemaligen Garagenhalle am hinteren Ende des<br />
Grundstückes.<br />
u
www.<strong>architektur</strong>-online.com<br />
43<br />
Lobjoy Bouvier Boisseau
<strong>architektur</strong> FACHMAGAZIN<br />
44<br />
Intelligente Fassade<br />
Von außen weist nichts<br />
auf die Überraschung im<br />
hinteren Hof dieses Gründerzeithauses<br />
in Paris hin.<br />
Straßenseitig hat sich an der Fassade fast nichts<br />
geändert. Links von der breiten Einfahrt signalisiert<br />
ein Schaufenster mit einem kleinen Geschäftslokal<br />
bereits die Fondation Henri Cartier-Bresson. Der<br />
Strom von Laufkundschaften wird so geregelt und<br />
nur Wissende gehen bis in den hinteren Teil zu den<br />
Veranstaltungs- und Schauräumen. So bleiben die<br />
Büros der beiden Stiftungen eher geschützt und der<br />
historische Charakter des Viertels wird in keiner Weise<br />
gestört.<br />
Die teilweise Entfernung der erwähnten Garage – die<br />
ursprünglich in einem Gemüsegarten errichtet worden<br />
war – ermöglichte die Schaffung eines zweiten<br />
Hofes. Gleichzeitig reorganisierten die Planer einige<br />
Bereiche in den bestehen gebliebenen Teilen<br />
zur Straße hin und schufen so Sichtverbindungen<br />
und Achsen, die von ganz vorne bis in die Tiefe des<br />
Komplexes reichen. Glaswände auf der Erdgeschossebene<br />
bieten dem Passanten bereits Einblicke in die,<br />
ganz hinten liegenden Schauräume der Fondation<br />
Henri Cartier-Bresson. Diese Eingangsebene ist wie<br />
ein Bühnenbild gestaltet, ständig wechselnde Stimmungen<br />
und Eindrücke begleiten den Besucher nach<br />
hinten bis in die intimeren Bereiche. Nach dem Durchschreiten<br />
einer überdeckten Passage öffnet sich der<br />
zweite Hof wie der Kreuzgang eines Klosters.
www.<strong>architektur</strong>-online.com<br />
45<br />
Lobjoy Bouvier Boisseau<br />
Und hier tritt auch der Überraschungseffekt ein: Der<br />
fünfgeschossige Bau – mit der archetypischen Silhouette<br />
eines Hauses mit Giebeldach – ist ab dem<br />
ersten Stock komplett hinter einer filigran anmutenden<br />
Vorhangfassade aus anodisierten Aluminiumteilen<br />
verborgen. Diese Idee ist sowohl den Wünschen<br />
nach gegenseitigem Schutz der beiden Auftraggeber,<br />
wie auch der visuellen Attraktion des Projektes<br />
geschuldet. Hofseitig bieten schmale „Pawlatschen“<br />
Raum für die Mitarbeiter, um ein bisschen Luft zu<br />
schnappen oder doch die längst verpönte Zigarette<br />
zu rauchen und die raumhohen Glasscheiben der Büros<br />
geben (vor allem an der hinteren Seite) ziemlich<br />
beeindruckende Aussichten auf Paris ab. Die Gitterfassade<br />
bietet einen Blickschutz auch für die Mieter<br />
des zur Straße gelegenen Hausteiles. Vor allem aber<br />
ist sie die Signatur des Projektes, welches trotz seines<br />
unaufgeregten Designs durch sie eine Wichtigkeit<br />
erhält. Die nach oben hin immer luftiger werdende<br />
Struktur der Fassade entmaterialisiert sozusagen<br />
den Körper, verbirgt die profane Wirkung des eher<br />
beliebigen Bürobaus und ist doch gleichzeitig ein<br />
Eyecatcher und somit die Signatur des Projektes.<br />
Im Erdgeschoss befindet sich die permanente Ausstellung<br />
von Fotoarbeiten, im ersten Stock die Archive<br />
und darüber Büroräumlichkeiten. Ein zusätzlicher,<br />
im zweiten Stock beginnender, grüner Hof belichtet<br />
den hinteren Teil des Hauses. Eine skulpturale Wendeltreppe<br />
– mit einer doppelten Drehung beginnend<br />
– erschließt im Inneren des Körpers (an der Feuermauer<br />
zum Nachbargrundstück gelegen) die vier<br />
oberen Geschosse.<br />
Gerade wegen ihrer zurückhaltenden und bescheidenen<br />
Ausführung haben die Architekten im letzten<br />
Jahr für dieses Projekt eine Auszeichnung beim<br />
Architizer Award 2019 in der Kategorie „Details –<br />
Plus-Architecture + Facades“ erhalten.<br />
•
<strong>architektur</strong> FACHMAGAZIN<br />
46<br />
Intelligente Fassade
..\..\..\..\..\01_CLASSEUR PROJET\00_LOGOS\logo LBB\LBB_Logo rouge (pantone 032).jpg<br />
EP<br />
LOTS DE COPROPRIETE NON CONCERNES PAR LE<br />
PRESENT DOSSIER PRO/DCE<br />
www.<strong>architektur</strong>-online.com<br />
47<br />
Lobjoy Bouvier Boisseau<br />
A<br />
Cour<br />
commune<br />
Porche<br />
commun<br />
COUPE DD<br />
lots de Copropriété non concernés par la présente demande de Permis de Construire<br />
0 1m 5m<br />
10m<br />
Nota : Le présent document graphique est établi par l'architecte sur la base des documents graphiques dressés par le cabinet de géomètre BARDEL - version d'octobre 2014 et du cabinet GEXPERTISE mai 2015. Ne peut être utilisé en l'état pour servir de base à l'exécution des ouvrages. S'agissant d'un bâtiment existant, les côtes sont données à titre indicatif et les niveaux de sol sont donnés finis. Les côtes altimétriques sont rattachées au<br />
nivellement de la ville de Paris (NVP). Documents établis sous réserve d'études complémentaires et de validation des services concernés (Ville, sécurité,....). Documents régis par le code de la propriété intellectuelle et du droit d'auteur.<br />
MAITRE D'OUVRAGE:<br />
FONDATION F.SOMMER<br />
FONDATION H.CARTIER BRESSON<br />
AVEC LE MANDAT DE LA SCI NOEL<br />
C/O Fondation François Sommer<br />
60 rue des Archives - 75003 PARIS<br />
3 rue Jesse Owens - 93200 SAINT-DENIS<br />
tél: 01 53 01 92 40<br />
tél: 01 48 20 70 15<br />
MAITRE D'OUVRAGE DELEGUE : ARCHITECTE :<br />
ARC. D'INTERIEUR FHCB : BET FLUIDES : BUREAU DE CONTROLE :<br />
ARC. D'INTERIEUR FFS : BET STRUCTURE :<br />
LOBJOY &<br />
116 rue du Château - 92100 BOULOGNE BILLANCOURT<br />
SOMETE<br />
tél: 01 41 10 25 25<br />
BOUVIER &<br />
BOISSEAU.<br />
79 RUE DES ARCHIVES - 75 003 PARIS<br />
NOVO<br />
GLI<br />
BTP CONSULTANTS<br />
DOSSIER AVP POUR LA RESTRUCTURATION / TRANSFORMATION DU GARAGE EN IMMEUBLE DE BUREAUX<br />
GEOMETRES :<br />
N° affaire: date: éch:<br />
Réf. PC : N° plan:<br />
P. BARDEL<br />
COUPE LONGITUDINALE - FACADE<br />
PC5 P-303<br />
GEXPERTISE<br />
14.05.PCM 11/12/15 1/200°<br />
COURETTE<br />
COURETTE<br />
Fondation-s<br />
Paris, Frankreich<br />
Bauherr:<br />
Planung:<br />
Statik:<br />
Fondation Henri Cartier-Bresson,<br />
Fondation François Sommer<br />
Lobjoy Bouvier Boisseau<br />
Somete<br />
Bebaute Fläche: 1.969 m 2<br />
Fertigstellung: 10/2018<br />
Baukosten: 10 Mio. Euro
<strong>architektur</strong> FACHMAGAZIN<br />
48<br />
Intelligente Fassade<br />
Musik aus<br />
1001 Nacht<br />
Élancourt Music School / Élancourt / OPUS 5<br />
Text: Peter Reischer Fotos: Luc Boegly
www.<strong>architektur</strong>-online.com<br />
49<br />
OPUS 5<br />
Ein weiteres dieser „unaufgeregten“ Projekte – ebenfalls<br />
in Frankreich – findet sich in Élancourt, einer<br />
französischen Gemeinde mit 25.400 Einwohnern im<br />
Département Yvelines in der Region Île-de-France,<br />
und zwar in dem Gebäude des ehemaligen ökumenischen<br />
Zentrums der Gemeinde. Diese Architektur<br />
wurde zwischen 1974 und 1977 von Architekt Philippe<br />
Deslandes errichtet und stellte einen der wichtigsten<br />
Punkte in der Entwicklung der Stadt dar. Ursprünglich<br />
für Gottesdienste vorgesehen, war das Gebäude einfach,<br />
ohne Ornamente und eine nach innen gerichtete,<br />
ruhige Architektur, modular und anonym. Ende 2018<br />
wurde sie, nach einem Umbau durch das Pariser Architekturbüro<br />
OPUS 5 neu eröffnet und beherbergt heute<br />
die Élancourt Musikschule. Es schwingt im Trend der<br />
Zeit, vertritt den Geist einer Reduktion, der Nachhaltigkeit<br />
und ist gerade deshalb sehenswert. u
<strong>architektur</strong> FACHMAGAZIN<br />
50<br />
Intelligente Fassade<br />
Beton und Ziegel sind die beiden prägenden Materialien<br />
dieser Architektur. Die Fassade, komplett<br />
aus Ziegel errichtet, erweckt einen orientalischen<br />
Eindruck. Gleichzeitig haben die Architekten durch<br />
diese Idee einer ausschließlichen Benutzung dieses<br />
Baustoffes den ursprünglichen Charakter des Gebäudes<br />
bewahren können: das Prinzip des nach-innen-gerichtet-Seins<br />
und der Intimität. Der Trick, den<br />
Körper komplett und fugenlos mit dieser einheitlichen<br />
Fassade zu überziehen, vermittelt zwischen den<br />
vielfältigen, einzelnen Körpern der ursprünglichen<br />
Architektur von Deslandes und dem Gesamteindruck.<br />
Die Gestaltungsart entspricht dem Moucharabieh<br />
oder Maschrabiyya, den traditionellen dekorativen<br />
Holzgitter in der islamischen Architektur, die als<br />
Gitterschranken in Moscheen oder als Fenstergitter<br />
bzw. als Balkonverkleidungen in Wohnhäusern und<br />
Palästen zum Einsatz kamen.<br />
u
www.<strong>architektur</strong>-online.com<br />
51<br />
OPUS 5<br />
Wie bei einer Laterne<br />
strahlen die Lichter<br />
der Inneräume durch<br />
die durchbrochenen<br />
Ziegelwände und vermitteln<br />
Geborgenheit<br />
und Konzentration.
<strong>architektur</strong> FACHMAGAZIN<br />
52<br />
Intelligente Fassade<br />
Auch im Inneren werden<br />
mit geschickten Lichtführungen<br />
die Effekte der<br />
Außenansichten wiederholt.<br />
Die handgeschlagenen Ziegel sind in einer mörtellosen<br />
Verlegetechnik gelegt. Die feinen Farbnuancen<br />
modellieren die einheitlich durchgehende Fassade.<br />
Während der Nachtstunden schimmert das Innere<br />
durch die Zwischenräume der Ziegel und symbolisiert<br />
so den Inhalt dieses Lernortes. Tagsüber erscheint<br />
das Gebäude auf den ersten Blick ge- oder<br />
verschlossen, auf den zweiten Blick löst es sich jedoch<br />
in die einzelnen Körper auf und ermöglicht ein<br />
umfassendes Wahrnehmen der Architektur. Auch im<br />
Inneren wirken die durchbrochenen Ziegelwände mit<br />
interessanten Lichtspielen und -reflexen weiter. Die<br />
Stimmung in den Räumen entspricht dem Gefühl der<br />
Privatheit, Konzentration, Meditation und Rückzug –<br />
bestens geeignet für Musikstunden.<br />
Interessant ist hier auch die fünfte Fassade, das<br />
Dach. Thermisch neu isoliert und technisch zeitgemäß<br />
ausgeführt ist es mit einem durchgehenden,<br />
synthetischen blauen Plastikrasen bedeckt. Dieser<br />
Farbfleck im Stadtgefüge ist von allen höheren Gebäuden<br />
der Umgebung aus sichtbar.<br />
Zurückhaltung und Einfachheit kennzeichnen dieses<br />
Projekt. Es versucht nicht große Wirkung zu erzielen,<br />
sondern – vor allem durch seine Außenansicht – eher<br />
den Ort in der Gemeinde aufzuwerten, sowie Menschen<br />
zur Neugier anzuregen.<br />
•
www.<strong>architektur</strong>-online.com<br />
53<br />
OPUS 5<br />
Élancourt Music School<br />
Élancourt, Frankreich<br />
Bauherr:<br />
Planung:<br />
Mitarbeiter:<br />
Statik:<br />
City of Élancourt<br />
OPUS 5 Architectes<br />
Hùng Tôn, Icegem Construction, Impédance<br />
Batiserf<br />
Bebaute Fläche: 900 m 2<br />
Planungsbeginn: 06/2014<br />
Bauzeit:<br />
18 Monate<br />
Fertigstellung: 10/2018<br />
Baukosten:<br />
2 Mio. Euro
<strong>architektur</strong> FACHMAGAZIN<br />
54<br />
Intelligente Fassade<br />
Über den<br />
Dingen<br />
Biwak Matteo Corradini Biwak / Cesana Torinese, Italien / Andrea Cassi e Michele Versaci<br />
Text: Linda Pezzei Fotos: Delfino Sisto Legnani<br />
Auf knapp 3.000 Metern Höhe befindet sich unter<br />
dem Gipfel Dormillouse das Biwak Matteo Corradini,<br />
ein Rückzugsort für Bergsteiger. Der markante Körper<br />
öffnet sich nur in zwei Richtungen mittels großflächigen<br />
Fenstern, die atemberaubende Ausblicke bieten.<br />
Die ansonsten geschlossene schwarze Hülle sorgt für<br />
die perfekte Wärmeregulierung im Inneren über das<br />
ganze Jahr.
www.<strong>architektur</strong>-online.com<br />
55<br />
Andrea Cassi e Michele Versaci<br />
Manchmal muss man einen Gipfel erklimmen, um die<br />
Dinge klar sehen zu können. Doch je höher man steigt,<br />
desto dünner wird die Luft, umso karger der Boden<br />
und umso kälter die Nacht. Kein Wunder, dass sich<br />
der Mensch in den Bergen seit jeher Zufluchtsorte<br />
geschaffen hat. Behagliche Rückzugsmöglichkeiten,<br />
Schutz vor Wind und Wetter, man rückt zusammen.<br />
Das im oberen Valle di Susa gelegene Biwak Matteo<br />
Corradini ist ein solcher Ort der Einkehr. Es entstand<br />
2019 auf Betreiben von Paolo Corradini und<br />
dessen Familie in Gedenken an deren Sohn, einen<br />
leidenschaftlichen Bergsteiger. Unweit des Gipfels<br />
Dormillouse (2.908 Meter über dem Meeresspiegel),<br />
entworfen von den Architekten Andrea Cassi und Michele<br />
Versaci, liegt der Unterschlupf für Bergsteiger<br />
markant eingebettet in die beeindruckende Bergwelt<br />
an der Grenze zwischen Italien und Frankreich.<br />
Das streng geometrische Objekt wirkt in seiner Stringenz<br />
nahezu skulptural und funktioniert ähnlich einer<br />
Kamera. Zwei großflächige, gegenüberliegende Fenster<br />
bieten in Anlehnung an Kameraobjektive atemberaubende<br />
Ausblicke auf die alpine Bergwelt - der<br />
Zoom auf das Hauptaugenmerk: Fels, Himmel und<br />
Sterne. Das leichte und reversible Gebäudesystem<br />
steckt in einer Außenhülle aus pechschwarzem Metall,<br />
durch die regelmäßigen Falzkantungen vertikal<br />
strukturiert. Die Idee hinter dem Baukörper basiert<br />
auf der reinen Physik, in der ein schwarzer Körper ein<br />
ideales Objekt ist, da die Energie vollständig absorbiert<br />
und wieder in die Umgebung abgestrahlt wird.<br />
Aufgrund seiner exponierten Lage auf dem kleinen<br />
Pass unter den letzten Hängen in der Nähe des<br />
Gipfels ist das Biwak extremen Wetterbedingungen<br />
ausgesetzt. Dank der durchdachten Konstruktion<br />
schützt das dunkle Prisma vor ebendiesen und absorbiert<br />
gleichzeitig ein Maximum der intensiven<br />
Sonneneinstrahlung. Bei der Wahl der Materialien<br />
und der Form bezogen sich die Architekten auf die<br />
umgebende Landschaft: steile, dunkle Felskämme,<br />
die in grasbewachsene Hänge und Felsen übergehen,<br />
welche im Winter vollständig von meterhohem<br />
Schnee bedeckt sind. Der Baukörper fügt sich diskret<br />
in die Bergwelt, will nicht stören oder laut sein, eher<br />
als ein bewohntes Landkunstwerk verstanden werden,<br />
das unerwartete Anblicke und Ausblicke bietet.<br />
u
<strong>architektur</strong> FACHMAGAZIN<br />
56<br />
Intelligente Fassade<br />
So ist es kein Wunder, dass Wiederverwertbarkeit<br />
und ökologische Nachhaltigkeit zentrale Aspekte<br />
bei der Umsetzung des Projekts waren und sind.<br />
Dank vorgefertigter Holzbauteile konnte das Biwak<br />
binnen einer sehr kurzen Montagezeit von nur fünf<br />
Tagen vor Ort aufgestellt werden. Die in einer Werkstatt<br />
gefrästen und vormontierten Module wurden<br />
in deren Größe und Gewicht so konzipiert, dass sie<br />
anschließend per Hubschrauber so schnell wie möglich<br />
auf den Pass geflogen und vor Ort unkompliziert<br />
zusammengebaut werden konnten. Der Leichtbau<br />
ruht an seiner Unterseite nur zu einem Viertel auf<br />
dem Boden - einerseits, um sich der Neigung vor Ort<br />
anzupassen, andererseits, um den Landverbrauch so<br />
gering wie möglich zu halten. Vorhandenes Schiefergestein<br />
dient dabei als Fundament, das auch Regen<br />
oder Tauwasser abhält.<br />
Das Biwak wird hauptsächlich im Frühjahr und Winter<br />
von Skitourengehern aufgesucht, bevor es auf den<br />
Gipfel der Siebenschläfer geht, den höchsten Punkt<br />
des Kamms, der das Val Thuras vom Cervières-Tal<br />
in der Region Briançonnais trennt. Die Bergkette ist<br />
ein äußerst beliebtes Ziel und der kleine Pass, der als<br />
Standort für die Installation des Bauwerks gewählt<br />
wurde, ein beliebter Panorama- und Aussichtspunkt,<br />
der sich ideal für den Bau einer Notunterkunft eignet.<br />
Mehrere Skibergsteiger oder Wanderer können<br />
im Biwak rasten und nächtigen, bevor es in ein paar<br />
Stunden bis zum ersehnten Ziel geht.<br />
Das Innere des Biwaks bildet einen starken Kontrast<br />
zur Außenhaut. Während sich der Baukörper nach außen<br />
hin markant-heroisch präsentiert, empfängt der<br />
Innenraum den Besucher wie ein warmes Nest. Die<br />
harte Metallhaut verfügt auf einer Seite genau in der<br />
Mitte am Knick über eine zweiflügelige Tür, durch die<br />
man ins Innere gelangt. Aus der Ferne unsichtbar, offenbart<br />
sich der Zugang erst bei näherer Betrachtung.<br />
Der besondere Beschlag ist ein liebevolles Detail, das<br />
von der Hingabe zum Design der Gestalter zeugt.<br />
Über eine Schwelle betritt man das komplett mit Zirbenholz<br />
ausgekleidete Innere der Skulptur, von den<br />
Architekten Holzkrippe genannt. Denn die in den<br />
Bergen heimische Zirbe wird in der alpinen Tradition<br />
seit jeher zur Herstellung von Wiegen und Schlafzimmermöbeln<br />
verwendet. Dem Duft der ätherischen<br />
Öle wird eine gesundheitsfördernde Wirkung nachgesagt,<br />
zudem ist das Holz unkompliziert in der Verarbeitung.<br />
So findet sich die Natur mit allen Sinnen<br />
erlebbar auch im Innenraum der Unterkunft wieder.<br />
Das Bivacco ruht scheinbar<br />
schwebend auf einem<br />
Fundament aus Gestein,<br />
das vor Ort zusammengetragen<br />
wurde und findet<br />
so ganz natürlich seine<br />
Erdung.
www.<strong>architektur</strong>-online.com<br />
57<br />
Andrea Cassi e Michele Versaci<br />
Das Biwak ist trotz seiner Größe von nur 15 Quadratmetern<br />
Nutzfläche ein kleines Raumwunder. Die<br />
Architekten haben für das Innere ein System von<br />
Holzstufen entwickelt, die sich an den beiden kurzen<br />
Seiten des Gebäudes um einen zentralen Tisch<br />
herum entwickeln. In der Nacht werden die sechs<br />
Holzstufen, drei auf jeder Seite, zu bequemen Betten.<br />
Am Tag sitzt die Bergsteigergemeinschaft auf dieser<br />
über den Hang des Berges hinausragenden Konstruktion<br />
gesellig zusammen.<br />
So ist das Biwak Matteo Corradini mehr als nur eine<br />
rein funktionale Notunterkunft. Dank des geschickten<br />
Einsatzes von Material, Form und Farbe stemmt<br />
sich das Objekt nicht gegen die Natur, sondern nutzt<br />
vielmehr die Gegebenheiten optimal aus, münzt vermeintliche<br />
negative Umweltaspekte in positive Effekte<br />
um. Auf knapp 3.000 Metern haben die Architekten<br />
auf diese Weise ein gemütliches, einladendes<br />
und geselliges Nest geschaffen: einen Treffpunkt für<br />
Abenteurer und Entdecker.<br />
•<br />
black body mountain shelter | matteo corradini bivouac<br />
Cesana Torinese, Italien<br />
Bauherr:<br />
Planung:<br />
Statik:<br />
Paolo Corradini<br />
Andrea Cassi e Michele Versaci<br />
Luca Giacosa<br />
Grundstücksfläche: 20 m 2<br />
Bebaute Fläche: 20 m 2<br />
Nutzfläche: 15 m 2<br />
Planungsbeginn: 12/2018<br />
Bauzeit:<br />
3 Monate Vorfertigung, 5 Tage Montage vor Ort<br />
Fertigstellung: 07/2019<br />
Baukosten: 60.000 €
<strong>architektur</strong> FACHMAGAZIN<br />
58<br />
Energielieferant Fassade<br />
Die Fassade als<br />
Energielieferant<br />
Mikroalgen und Sonneneinstrahlung intelligent genutzt<br />
Text: Linda Pezzei Rendering: xoio GmbH im Auftrag von Timo Schmidt Fotos: HS Augsburg
www.<strong>architektur</strong>-online.com<br />
59<br />
Energielieferant Fassade<br />
Die Vernetzung unterschiedlicher Funktionen und<br />
Wirkungsebenen wird in Zukunft noch mehr an Bedeutung<br />
gewinnen. Ressourcen, Geld und Flächen<br />
werden immer knapper, innovative Ansätze über den<br />
Tellerrand hinaus gewinnen an Bedeutung. Auch der<br />
Architektur steht ein solcher Wandel bevor - beziehungsweise<br />
steckt diese schon längst mittendrin in<br />
der Neuerfindung ihrer selbst. Dächer werden bereits<br />
heute begrünt oder für das Urban Gardening und<br />
Bienenzucht nutzbar gemacht, Baulücken oder Brachen<br />
werden durch sinnvolle Gemeinschaftsprojekte<br />
reaktiviert und auch in der Vertikalen finden visionäre<br />
Entwickler eine bunte Spielwiese für Innovationen.<br />
So soll die Fassade von morgen nicht mehr allein<br />
ästhetischen Ansprüchen genügen, das Bauwerk<br />
schützen, Wind und Wetter abhalten, temperieren<br />
und Ausblicke bieten - die Fassade der Zukunft ist<br />
ein echter Tausendsassa und produziert ganz nebenbei<br />
noch grüne Energie. Forscher und Entwickler<br />
tüfteln seit einiger Zeit und oft interdisziplinär an<br />
solchen Konzepten. Universitäten, Labore und Hersteller<br />
arbeiten in diesem Zusammenhang meist eng<br />
zusammen und profitieren dabei vom gegenseitigen<br />
Know-how. Ob Sonnenenergie oder Mikroorganismen<br />
- die Bandbreite der Lösungsansätze ist so vielseitig<br />
wie spannend.<br />
u<br />
Die Fassade der Zukunft<br />
kann weitaus mehr, als<br />
bloße Hülle eines Bauwerks<br />
sein. Entwickler<br />
arbeiten bereits heute an<br />
Systemen zur effizienten<br />
Energiegewinnung<br />
mittels Mikroalgen oder<br />
Sonneneinstrahlung.<br />
Dabei soll die Fassade von<br />
morgen natürlich trotzdem<br />
weiterhin auch funktionalen<br />
wie ästhetischen<br />
Ansprüchen gerecht<br />
werden. Eine spannende<br />
Aufgabe für Visionäre<br />
und Gestalter.
<strong>architektur</strong> FACHMAGAZIN<br />
60<br />
Energielieferant Fassade<br />
Strom aus Sonnenenergie<br />
Dass aus Sonneneinstrahlung Energie gewonnen<br />
werden kann, mag erst einmal nicht<br />
sehr innovativ klingen – schließlich sind<br />
Fotovoltaik und Solaranlagen seit etlichen<br />
Jahren auf den Dächern unserer Häuser angekommen.<br />
Neuartig hingegen ist die von<br />
ETH-Forschern entwickelte Solarfassade,<br />
die mittels beweglicher Paneele Strom produziert.<br />
Im Gegensatz zu statischen Solarfassaden<br />
kann nicht nur die Beschattung<br />
nach Bedarf individuell geregelt werden, das<br />
neue System kann (an einem klaren Sonnentag)<br />
auch rund 50 Prozent mehr Energie<br />
als die starre Konkurrenz bereitstellen.<br />
Dr. Arno Schlüter, Professor für Architektur<br />
und Gebäudesysteme an der ETH Zürich,<br />
forscht mit seinem interdisziplinären Team<br />
seit rund zehn Jahren mit dem Schwerpunkt<br />
auf nachhaltigen Gebäudesystemen,<br />
neuen anpassungsfähigen Komponenten<br />
und deren synergetischen Integration in die<br />
architektonische und stadtplanerische Gestaltung<br />
unter Verwendung von daten-und<br />
computerbasierten Ansätzen für Modellierung,<br />
Analyse, Steuerung und Regelung.<br />
Neuester Clou: Die Entwicklung einer Solarfassade<br />
mit beweglichen Solarpaneelen.<br />
Laut einer in der Zeitschrift “Nature Energy”<br />
erschienenen Studie steht am Jahresende<br />
dank der energetischen Regulierung<br />
von Räumen mittels des neuen Fassadensystems<br />
ein Plus vor der Energiebilanz.<br />
Möglich macht dies das “Gedächtnis” der<br />
Fassade: ein lernfähiger Algorithmus. Dieser<br />
steuert unter Berücksichtigung der<br />
jeweiligen Nutzung der hinter der Fassade<br />
liegenden Räume die Bewegungen der<br />
Paneele dahingehend, dass der Energiebedarf<br />
für Heizung und Kühlung entsprechend<br />
minimiert werden kann.<br />
Technisch sind die Solarpaneele soweit<br />
ausgereift, dass diese Wind und Wetter problemlos<br />
standhalten. Die einzelnen Elemente<br />
sitzen nebeneinander in einer Reihe auf<br />
dezenten Stahlseilen und können jeweils<br />
einzeln angesteuert und horizontal wie vertikal<br />
justiert werden. Die Bewegung erfolgt<br />
mittels eines festen U-Gelenks und eines<br />
weichen pneumatischen Elements, das unter<br />
Druck seine Form verändern kann.<br />
Am besten funktioniere das System in den<br />
gemäßigten Regionen Mitteleuropas, wobei<br />
wärmere Regionen gegenüber kälteren<br />
generell im Vorteil sind. Auch bringt eine<br />
Bürohausfassade wohl tendenziell bessere<br />
Ergebnisse als ein Wohnbau. Laut der veröffentlichten<br />
Studie lieferte das Testobjekt<br />
eines Büroraums in Zürich 115 Prozent der<br />
für die Klimatisierung des Raumes nötigen<br />
Energie. Abgesehen von solchen Studien<br />
und virtuellen Berechnungen wird diese<br />
adaptive Fassade in Zukunft wohl Daten in<br />
Echtzeit und Realnutzung liefern können,<br />
denn sie befindet sich bereits im Bau.
www.<strong>architektur</strong>-online.com<br />
61<br />
Energielieferant Fassade<br />
Der Bioreaktor in der Glasfassade<br />
Algen assoziieren die meisten Menschen<br />
gemeinhin eher im Negativkontext (Stichwort<br />
Eutrophierung) oder wenn schon<br />
innovativ, dann mit dem letzten Besuch<br />
beim experimentellen Asiaten nebenan.<br />
Doch Algen können noch viel mehr, als unser<br />
Ökosystem steuern oder kulinarische<br />
Genussmomente bereiten - Algen können<br />
auch industriell zu unserem Wohle genutzt<br />
werden. Die Nachfrage nach bioaktiven<br />
Substanzen für die Lebensmittel-, Futtermittel-,<br />
Kosmetik- und Pharmazie- Industrie<br />
wächst stetig an. Während diese Substanzen<br />
heute mittels Biotechnologie und Bakterien<br />
unter hohem Flächenbedarf produziert<br />
werden, schlagen die Forscher der HS<br />
Augsburg neue Wege ein.<br />
Unter der Leitung von Dr. Timo Schmidt,<br />
Professor an der Fakultät für Architektur<br />
und Bauwesen der Hochschule Augsburg,<br />
konnten fassadenintegrierte Fotobioreaktoren<br />
zur Kultivierung von Mikroalgen entwickelt<br />
werden, deren Einsatz auch den Verbrauch<br />
von Ackerfläche mindern soll. Der<br />
im Rahmen eines vom BMBF geförderten<br />
Verbundforschungsvorhabens an der Hochschule<br />
Augsburg aufgebaute 1:1 Prototyp<br />
funktioniert als aerosolbasierter (Nebel) Reaktor.<br />
State of the art waren bis dato aquatische<br />
(Wasser) Fotobioreaktoren, die mehr<br />
Gewicht aufweisen und ein Ansiedeln von<br />
terrestrischen Algen nicht ermöglichen. Der<br />
aerosolbasierte Fotobioreaktor erweitert somit<br />
das Produktspektrum und ermöglicht im<br />
Vergleich zu aquatischen Systemen einen<br />
energieeffizienteren Betrieb.<br />
Innovativ denken und dabei Ressourcen<br />
schonen, lautet die Devise. Da Algen nur<br />
Sonnenlicht und das in der Luft enthaltene<br />
CO 2 für ihr Wachstum benötigen, bieten<br />
sich vertikale “Anbauflächen” an Fassaden<br />
bestens an. Bodenalgen sind deren optimale<br />
Bewohner, da sie im Vergleich zur Wasseralge<br />
weitaus höhere Temperaturen (bis<br />
zu 100 Grad Celsius) unbeschadet überstehen<br />
können. Wenn die Kultur also in einem<br />
geschlossenen, kontrollierbaren Bioreaktor<br />
gehalten werden kann, der fähig ist, Synergismen<br />
mit dem Gebäude/Quartier (CO 2 ,<br />
Abwärme, Verschattung, Wasseraufbereitung)<br />
zu bilden, dann eignet sich eine entsprechende<br />
Fassadenintegration. Produktionsanlagen<br />
mit hoher Abwärme und hohem<br />
CO 2 -Ausstoß seien laut Prof. Dr. Schmidt<br />
potenzielle Zielobjekte. Im Allgemeinen<br />
seien die Fassaden aber in Klimaregionen<br />
mit weitgehend konstanter Temperatur gut<br />
einsetzbar.<br />
Dank ihres hohen Eiweiß-, Vitamin- und<br />
Mineralgehalts sind Algen prädestiniert für<br />
die Produktion von Nahrungsergänzungsmitteln<br />
sowie für die pharmazeutische Nutzung.<br />
Während die konventionelle vertikale<br />
Landwirtschaft mit erheblichem Aufwand<br />
verbunden ist, fungieren die Algen auf einfache<br />
und günstige Weise als hochwertiger<br />
Dünger für die Nahrungsmittelproduktion.<br />
Die Algen können genauso wie ein Apfel<br />
oder eine Tomate am Ende ihres Reifeprozesses<br />
geerntet und weiterverarbeitet werden.<br />
Großer Pluspunkt: Licht und CO 2 als<br />
“Futtermittel” der Algen kosten nichts, nur<br />
der Reaktor muss mitsamt Medium einmalig<br />
angeschafft werden.<br />
Bislang gibt es zu diesem Thema zwar<br />
eine Vielzahl an Forschungsprojekten,<br />
aber wenig konkret in der Realität erprobte<br />
Beispiele. Man mag also auf innovative<br />
Bauherren und mutige Architekten hoffen,<br />
die die Kooperation mit Wirtschaft und Forschung<br />
nicht scheuen und in Folge neben<br />
der Funktion auch die Ästhetik an unsere<br />
Fassaden der Zukunft bringen. Prof. Dr.<br />
Schmidt jedenfalls sieht in der unterschiedlichen<br />
Bewuchsdichte der transluzenten<br />
Elemente das Potenzial einer spannenden,<br />
dynamischen Innenraumbeleuchtung - obgleich<br />
auch er zugeben muss, dass die<br />
Fassadensysteme bei den heutigen niedrigen<br />
Energiepreisen derzeit finanziell nicht<br />
konkurrenzfähig sind. Aber das kann sich in<br />
Zukunft ja schnell ändern …<br />
•
<strong>architektur</strong> FACHMAGAZIN<br />
62<br />
RETAIL <strong>architektur</strong><br />
Art is<br />
everywhere!<br />
Es ist eine Welt abseits der gewöhnlichen. Tagtäglich sind wir mit einer Überfülle<br />
an Produkten konfrontiert, die uns die Kaufentscheidung mitunter erschwert. Als<br />
Antipode dazu setzt der Louis Vuitton Store in Seoul, Südkorea, auf wenige, dafür<br />
in umso exklusiverem Rahmen, präsentierte Stücke. Es gibt keine gewöhnlichen<br />
Regale, dafür innen und außen Architektur vom Feinsten.<br />
Fotos: Yong Joon Choi
www.<strong>architektur</strong>-online.com<br />
63<br />
RETAIL <strong>architektur</strong><br />
Außen hat Architekt Frank Gehry für den ersten Eindruck<br />
gesorgt. Der Laden wurde eigentlich schon<br />
2000 in Cheongdam-dong im Gangnam Bezirk eröffnet<br />
und nun zum Flagship-Store redesigned. Sein<br />
Entwurf bezieht sich stark auf die koreanische Kultur<br />
und Tradition, wie zum Beispiel den traditionellen<br />
Dongnae Hakchum (Kranichtanz). Dessen dynamische<br />
Bewegungen haben Gehry zu der gekurvten<br />
Glasfassade des Shops inspiriert. Das Resultat ist<br />
eine durchaus poetische, jedoch exakt der Gehryschen<br />
Art entsprechende Gestaltung. Der Architekt<br />
verwendete wieder einmal seine gekurvten Glasflächen,<br />
jeder Teil ist einzeln gefertigt und gebogen<br />
auf einzelgefertigten Metallrahmen montiert. Das<br />
Glas bedeckt die gesamte Eingangsseite der Architektur,<br />
beginnend mit einem Zick-Zack-Vestibül und<br />
Schaufenster, dann aufwärts mit einer Serie von geschlossenen<br />
Terrassen und oben in einer Wolke von<br />
gebogenen Glastafeln kulminierend. Das erzeugt<br />
die Impression einer Flugbewegung, oder als ob das<br />
Dach selbst sich in den Wolken aufzulösen versucht.<br />
Wände und Grundmauern des Gebäudes sind aus<br />
weißen Steinen gemacht – das trägt natürlich zu dem<br />
Anschein von Leichtigkeit und Abheben bei. Schon<br />
das Schaufenster zur Straße zeigte während der Eröffnung<br />
weniger Mode, als kunstvolle, aus gefärbten<br />
Papieren gefaltete, lebensgroße Baumskulpturen.<br />
Für die klassisch, konservativen Innenräume konzipierte<br />
Architekt Peter Marino die Bereiche als Dialog<br />
mit Gehrys Fassade. Harmonisch vermengen sich<br />
ausgedehnte Räume mit edlen Nischen, das Innere<br />
offenbart eine exklusive Erfahrung, in der der Kunde<br />
in eine Welt aus Kunst, Handwerk und Geschicklichkeit<br />
eintauchen kann. Von der Eingangshalle mit<br />
zwölf Meter Höhe wird man über ein luftiges Stiegenhaus<br />
zu den weiteren fünf Ebenen und zu fast intimen<br />
Lounges geführt. Verschiedene Steintexturen<br />
erwecken den Eindruck, als seien Nischen aus ihnen<br />
herausgehauen worden. Das Rechteckige der Räume<br />
steht in einem starken Kontrast zur fast barocken<br />
Glasfläche im Außenraum. Architekt Marino hat auch<br />
– und das ist ein Markenzeichen und Marketingkonzept<br />
von Vuitton – die Kunstwerke und Künstler ausgesucht<br />
und in die Innenräume gehängt. Sie mischen<br />
sich mit den wenigen Modestücken und Accessoires<br />
– strategisch hängen farbenprächtige Bilder und<br />
überall ist Kunst.
<strong>architektur</strong> FACHMAGAZIN<br />
64<br />
RETAIL <strong>architektur</strong><br />
Modisches<br />
Glaskabinett<br />
Das chinesische Modehaus Geijoeng hat das Potenzial von Social Media erkannt und<br />
entschied sich für ein extravagantes Shopdesign, das als Hintergrund für Selfies und<br />
Fotos ausgezeichnet funktioniert. Das Architekturbüro studio 10 ist für die Gestaltung<br />
dieses neuen Concept Stores in der chinesischen Stadt Shezhen verantwortlich.<br />
Fotos: Chao Zhang
www.<strong>architektur</strong>-online.com<br />
65<br />
RETAIL <strong>architektur</strong><br />
Schon von außen wirkt der Shop alles andere als<br />
unscheinbar. Die an der Wand und Decke angebrachten<br />
Spiegel verstärken die Wirkung des dominierenden<br />
Materials Glas. Es wird in Form von Glasbausteinen<br />
und länglichen Glasteilen eingesetzt,<br />
die die Wände, den Fußboden und die massiven<br />
Sockelelemente bilden.<br />
Die für den Kunden relevanten Kleidungsstücke werden<br />
auf filigranen weißen Kleiderstangen zur Schau<br />
gestellt, die sich auf massive mineralische Sockel<br />
stützen. Im Shopbereich ist der Fußboden belegt mit<br />
Bodenplatten einer hochskalierten Terrazzostruktur.<br />
Die Glaselemente werden als raumbildendes Element<br />
verwendet und bilden so die notwendigen Umkleidekabinen.<br />
Die Privatsphäre in diesen transparenten<br />
Räumen muss man sich durch das Zuziehen des innen<br />
liegenden Vorhanges erst selbst schaffen.<br />
Durch das Zusammenwirken von Glas, den Metalloberflächen,<br />
den entsättigten Grüntönen und Weiß<br />
wird eine kühle Raumatmosphäre erzeugt. Der Erlebnisfaktor<br />
wird dabei großgeschrieben: Den Kunden<br />
sollen nicht nur die präsentierten Kleidungsstücke in<br />
Erinnerung bleiben, sondern auch der Hintergrund,<br />
vor dem sie dargeboten werden.
<strong>architektur</strong> FACHMAGAZIN<br />
66<br />
RETAIL <strong>architektur</strong><br />
Endzeitdisplay<br />
Auf insgesamt 250 Quadratmeter Fläche hat das Büro von Kostas Chatzigiannis<br />
Architecture (KAC) in Shanghai den „Shouter Store“ mit einer Kulisse<br />
aus halb offenen Wänden, Löchern und Rissen versehen. Diese Raumteilungen<br />
sind Wände aus Beton, mit großen Öffnungen wie bei einem Abbruchgebäude<br />
oder nach einem Bombentreffer.<br />
Fotos: Derryck Menere
www.<strong>architektur</strong>-online.com<br />
67<br />
RETAIL <strong>architektur</strong><br />
Risse sind teilweise mit Neon oder LED hinterleuchtet.<br />
Diese aus einer dystopischen Welt stammenden Raumelemente<br />
werden zu Fassaden, die die ausgestellten Designstücke<br />
in Versatzstücke aus einer verloren gegangenen<br />
Zeit transformieren.<br />
Interessant ist hier der Kontrast zwischen der rohen Materialität<br />
und der glatten Eleganz der ausgestellten Objekte.<br />
Die Möbel und Accessoires erinnern ein bisschen<br />
an die Zeit des Memphis-Designs und Alessandro Mendini.<br />
Aber sie sollen angeblich den Zeitgeist der modernen<br />
Menschen und ihren Wohnbedürfnissen in Shanghai<br />
entsprechen. Jedenfalls gibt es einen Markt dafür.<br />
Die verschiedenen Kollektionen eigenartiger, spielerischer,<br />
oft limitierter Möbel und Gegenstände fügen<br />
sich gut in die Rauminszenierung ein. Kleinere Objekte<br />
stehen in Vitrinen, größere sind durch beleuchtete Metallrahmen<br />
geschützt und getrennt, über allem schwebt<br />
eine abgehängte Decke aus einem Stahlgitter. Besucher<br />
können frei durch die unterschiedlichen Öffnungen<br />
zirkulieren und durch diverse Ein- und Ausgänge den<br />
Raum wieder verlassen. Die weitere Materialpalette erstreckt<br />
sich über Terrazzo, zu Marmor, Glas und gefärbten<br />
Kunstharzregalen.
<strong>architektur</strong> FACHMAGAZIN<br />
68<br />
RETAIL <strong>architektur</strong><br />
Spiegelkabinett<br />
Für den neuen Laden der Marke CONCEPTS in Shanghai mussten sich die<br />
beauftragten dongqi Architects etwas Besonderes einfallen lassen. Das Lokal<br />
befindet sich in einem der traditionellen Gebäude des sogenannten Shikumen-Stils.<br />
Dieser traditionelle Shanghaier Baustil, der westliche und chinesische<br />
Elemente kombiniert, tauchte erstmals in den 1860er Jahren auf.<br />
Fotos: dongqi Architects
www.<strong>architektur</strong>-online.com<br />
69<br />
RETAIL <strong>architektur</strong><br />
Auf dem Höhepunkt seiner Popularität gab<br />
es in Shanghai über 9.000 Gebäude im Shikumen-Stil,<br />
sie machten 60 % des gesamten<br />
Baubestandes der Stadt aus. Dieses Ziegelgebäude<br />
stand nun schon seit über 100 Jahren<br />
und entsprach der Typologie der steinernen<br />
Lagerhäuser der Stadt. Die Architekten<br />
haben die ursprüngliche Fassade restauriert<br />
und die Innenräume mit einer zeitgemäßen,<br />
metallischen Intervention aufgewertet.<br />
Das Layout des Grundrisses sieht zwei getrennte<br />
Zonen vor: der alltägliche Verkaufsbereich<br />
und eine Zone für die Präsentation<br />
von limitierten Sneakerserien. Für diese<br />
Trennung entwickelten die Planer zwei getrennte<br />
atmosphärische Bereiche. Der vordere<br />
Teil des Shops ist in der typischen gemütlichen<br />
Ausstattung des Shikumen-Stils<br />
des alten Shanghais gehalten und somit<br />
ideal für Produktpräsentationen und Events.<br />
Der hintere Teil ist ganz bewusst von der<br />
Hauptblickrichtung separiert und so wird<br />
schon eine geheimnisvolle Stimmung kreiert.<br />
Im Gegensatz zu vorne (Ziegel und Parkett)<br />
schaffen hier anodisiertes Aluminium,<br />
rostfreier Stahl, Metallgewebe, Glasfaser<br />
und Terrazzo eine eigene Atmosphäre.<br />
Das Originalgebäude hatte eine Säulenreihe<br />
in der Raummitte. Die Architekten entschlossen<br />
sich, diese Wirkung durch zwei<br />
weitere, seitlich angeordnete Reihen zu<br />
verstärken. So ließ sich auch das regenschirmartige<br />
Raumsystem verwirklichen,<br />
das fast zur Gänze aus Metall besteht. Die<br />
jeweils zwischen den Säulenreihen installierten<br />
metallenen Bögen verstärken die<br />
Kraft und Struktur des länglichen Raumes.<br />
In und unter den Gewölbebögen befinden<br />
sich relativ unabhängige und unauffällige<br />
Displays für die Waren. Diese Elemente sollen<br />
ein Gefühl der Feierlichkeit für den Kunden<br />
schaffen und das Einkaufen zu einem<br />
Erlebnis stilisieren. Außerdem hält man so<br />
die Verkehrswege im Store frei und dramatisiert<br />
den Raum.<br />
Die aus unterschiedlich großen Metallstreifen<br />
geformten Bögen sind eigentlich<br />
nur eine Fassade, eine Verkleidung der<br />
statischen Säulen. Ihre anodisierten Aluminiumteile<br />
werden mit Fittings (die speziell<br />
für den Auftraggeber entworfen und produziert<br />
wurden) fixiert. Die Beschläge ermöglichen<br />
eine 3-achsige Rotation der Lamellen,<br />
sodass praktisch jede vom Kunden<br />
gewünschte Stellung erreicht werden kann.<br />
Ebenso werden diese Fittings für Regale,<br />
Wände der Umkleidekabinen, Displays, Türgriffe<br />
und Aufhängungen verwendet.<br />
Die Seitenwände des Raumes sind mit auf<br />
Hochglanz polierten Metallplatten verkleidet,<br />
so erweitert sich durch Spiegelungen<br />
der Raum und verdoppelt optisch die Zahl<br />
der Säulen. Eine weitere optische Illusion<br />
oder Verwischung wird durch – sich mit der<br />
orthogonalen Projektion der Bögen – überlappende<br />
Linien und wechselnde Terrazzomischungen<br />
im Bodenbelag erzielt.<br />
Zitate dieser Gestaltung findet man dann<br />
auch in der Fassade, und zwar bei den Türund<br />
Fensterumrahmungen wieder, hier wurde<br />
der rostfreie Stahl zur Verschönerung<br />
der alten Ziegelfassaden verwendet. Er<br />
symbolisiert auch den Passanten als erstes<br />
Zeichen, dass hier etwas Besonderes im Inneren<br />
der alten Architektur passiert ist.
<strong>architektur</strong> FACHMAGAZIN<br />
70<br />
RETAIL <strong>architektur</strong><br />
Maßstabsverwischung<br />
Gigantische Woll- und Garnknäuel drängen aus dem Schaufenster des Rockbund<br />
Art Museum in Shanghai. Die Fassade scheint einem surrealistischen Film entsprungen<br />
zu sein. Die Knäuel materialisieren sich im Inneren, hinter der Glasscheibe und<br />
einigen gelingt sogar der Weg in den Außenraum. Dieses außergewöhnliche Design<br />
entwickelte das in Beijing, Hongkong und Vancouver agierende Architektur- und<br />
Designstudio WAY.<br />
Fotos: i-Joyer Photography<br />
Gerade rechtzeitig zu Weihnachten 2019 wurde diese<br />
Fassaden- oder Schaufenstergestaltung der Öffentlichkeit<br />
präsentiert. Die Designer wollten mit dieser<br />
Gestaltung den üblichen Weihnachtsschaufenstern<br />
einen Kontrapunkt setzen. Statt drei Fenstern mit jeweils<br />
eigenen Markenpräsentationen und Artikeln und<br />
Displays zu präsentieren, vereinten sie den Raum hinter<br />
den Scheiben zu einem ganzen Eventspace. Die schwebenden<br />
Bälle sind ausgehöhlt und in ihnen werden die<br />
diversen Brands oder Weihnachtsprodukte präsentiert:<br />
In der Mitte finden sich Geschenke für alle Sinne, links<br />
wird Werbung für eine Kaffeemarke gemacht und rechts<br />
sieht man die wohl berühmteste Fotomarke der Welt.<br />
Diese Präsentation verweist direkt auf das Rockbund<br />
Art Museum mit seinen Künsten und den fotografischen<br />
Spezialausstellungen.<br />
Auf einer Gesamtfläche von 48 m 2 und mit einer Höhe<br />
von 3,3 m wirkt diese „Fassade“ wie eine Reminiszenz<br />
der Erde oder des Weltraums, der Passant kann sich das<br />
jedenfalls beim Vorbeigehen überlegen. Bis Mitte Jänner<br />
<strong>2020</strong> war dieses Schaufenster in Shanghai zu sehen.
www.<strong>architektur</strong>-online.com<br />
71<br />
RETAIL <strong>architektur</strong><br />
Anspruchsvolles<br />
Raumregal<br />
Das Wiener Architektenteam heri&salli gestalteten 2015 einen Showroom für den<br />
Essig- und Bierbrauer Erwin Gegenbauer und bezeichneten ihn passend als „Edelsauren<br />
Laden“. Dessen Raumkonzept greifen sie nun für denselben Bauherren als<br />
Verkaufsraum am Wiener Naschmarkt auf und zeigen, dass es auch für die geringere<br />
Grundfläche im neuen „Edlen Laden“ hervorragend geeignet ist.<br />
Fotos: Hans Schubert<br />
Die Warenpräsentation im „Edlen Laden“ ist von der<br />
Zweidimensionalität losgelöst, das Verkaufsregal<br />
greift die dritte Dimension auf und erscheint raumumfassend.<br />
Es erstreckt sich entlang der Wände und<br />
der Decke, zieht sich von dort sogar in den Raum hinein.<br />
Als Holzkonstruktion ausgeführt nimmt es alle<br />
notwendigen Funktionen in sich auf. Neben der Präsentationsfläche<br />
und dem erforderlichen Stauraum<br />
sind auch die Verkaufstische, der Kassatresen, ein<br />
Waschbecken und Anrichten untergebracht.<br />
Falls benötigt, können klappbare Tische als zusätzliche<br />
Nutzfläche geöffnet werden. Der Verkaufsraum<br />
mit annähernd quadratischer Grundfläche ist auf drei<br />
Seiten zum Marktraum hin geöffnet. Über eine Seite<br />
kann er betreten werden, auf den beiden anderen<br />
verglasten Seiten ist er durch das Raumregal hindurch<br />
einsehbar und weckt so mit seinen Produkten<br />
und der Konstruktion die Neugier der Passanten. Mit<br />
seinem Essig, dem Bier und dem Kaffee stellt der Laden<br />
eine Bereicherung für den Markt dar und macht<br />
seiner Bezeichnung auch durch die Shopgestaltung<br />
alle Ehre.
<strong>architektur</strong> FACHMAGAZIN<br />
72<br />
RETAIL <strong>architektur</strong><br />
Städtische<br />
Blumenwiese<br />
Blumen, Blätter, Bäume, zarte Farben, Licht, ein süßlich frischer Duft – das<br />
vermittelt Architekt Román Izquierdo Bouldstridge mit seinem Projekt für den<br />
Floristen Colvin in Barcelona.<br />
Fotos: Adrià Goula
www.<strong>architektur</strong>-online.com<br />
| BA12-14G |<br />
Eine Steuerung<br />
RETAIL <strong>architektur</strong><br />
für alle Gewerke<br />
Integrale, PC-basierte Gebäudeautomation<br />
von Beckhoff<br />
Nichts erinnert mehr daran, dass sich zuvor in dem Geschäftslokal<br />
eine Bankfiliale befunden hat. Die hohen<br />
Decken wurden wiederhergestellt, das Ziegelmauerwerk<br />
freigelegt und beides weiß gestrichen. Im Vordergrund<br />
stehen die Blumen und Blumensträuße, die auf unterschiedlich<br />
hohen Holzzylindern präsentiert werden.<br />
Diese dienen auch als Pflanztröge für die behutsam platzierten<br />
Bäume und als Kassenpult. Große Schaufenster<br />
mit Holzrahmung vermitteln den Passanten schon<br />
einen Teil des überwältigenden Eindrucks, der sie im<br />
Geschäft erwartet. Nach hinten schließt der Raum mit<br />
einem Schiebetürensystem ab, das die straßenseitigen<br />
Öffnungen in gewisser Weise spiegelt. Fixe und auch<br />
bewegliche Türelemente aus Glas markieren hier den<br />
Übergang zu einer privateren Zone. Dort werden die einzelnen<br />
Blumenbouquets und andere Bestellungen von<br />
den Floristen zusammengestellt. Im hintersten Bereich<br />
des Ladens sind dann noch Lager und Kühlraum, sowie<br />
Büro und Sanitärbereich untergebracht.<br />
Alle Bereiche strahlen Leichtigkeit und Wohlbefinden<br />
aus, auch der rohe Charakter der Wände und Decke<br />
findet sich überall wieder. Eichenholz findet sich bei<br />
verschiedenen Elementen wieder und unterstreicht den<br />
einheitlichen Charakter. Nur die Möblierung unterscheidet<br />
sich und kennzeichnet die verschiedenen Bereiche.<br />
www.beckhoff.at/building<br />
Microsoft Technology<br />
Center, Köln:<br />
Die integrale Gebäudeautomatisierung<br />
wurde mit<br />
PC- und Ethernet-basierter<br />
Steuerungstechnik von<br />
Beckhoff realisiert.<br />
Die offene, PC-basierte Steuerungstechnik von Beckhoff bildet die<br />
Grundlage einer integralen Gebäudeautomation, die alle Anforderungen<br />
an eine nachhaltige und effiziente Lösung erfüllt. Eine<br />
einheitliche Hard- und Softwareplattform steuert alle Gewerke, von<br />
der nutzungsgerechten Beleuchtung über die komfortable Raumautomation<br />
bis zur hocheffizienten HLK-Regelung. Das Ergebnis:<br />
Durch die optimale Abstimmung aller Gewerke werden die<br />
Energieeinsparpotenziale über die Energieeffizienzklassen hinaus<br />
voll ausgeschöpft. Darüber hinaus reduziert die integrale Gebäudeautomation<br />
Hardware-, Software- und Betriebskosten. Für alle<br />
Gewerke stehen vordefinierte Softwarebausteine zur Verfügung,<br />
die das Engineering enorm vereinfachen. Funktionserweiterungen<br />
oder -änderungen sind jederzeit möglich.<br />
Die ganzheitliche Automatisierungslösung<br />
von Beckhoff:<br />
Flexible<br />
Visualisierung/<br />
Bedienung<br />
Skalierbare Steuerungstechnik,<br />
modulare I/O-<br />
Busklemmen<br />
Modulare<br />
Software-<br />
Bibliotheken
<strong>architektur</strong> FACHMAGAZIN<br />
74<br />
Licht<br />
Vier Fassaden<br />
Die Beleuchtung der Fassade des Ameron Frankfurt Neckarvillen Boutique Hotels<br />
zeigt, wie Licht als Gestaltungsmittel die denkmalgeschützten Fassaden als einzigartiges<br />
Ensemble betont und zugleich ihre historische Bedeutung respektiert.<br />
Text: Alexander Magyar Fotos: Ameron Frankfurt Neckarvillen Boutique<br />
Vier unterschiedliche, historistische und denkmalgeschützte<br />
Fassaden, die nach dem Umbau der zwei<br />
Doppelhäuser zur Visitenkarte eines First Class Hotels<br />
im prominent-hippen Frankfurter Bahnhofsviertel<br />
werden – das war die Ausgangslage für die Lichtgestaltung.<br />
Ziel war, die Fassaden sowohl in ihrer<br />
Einzigartig- und Unterschiedlichkeit zu betonen, als<br />
auch ihre Zusammengehörigkeit - für die neue Nutzung<br />
als Hotel - sichtbar zu machen.<br />
Die vier denkmalgeschützten Villen in der Neckarstraße<br />
7 – 13 in Frankfurt gehören zu den historisch<br />
wertvollsten und interessantesten Häusern in Frankfurt.<br />
Erbaut zwischen 1905 und 1906 sind zwei der<br />
Fassaden dem Jugendstil, die anderen Beiden dem<br />
Neobarock bzw. der Neorenaissance zuzuordnen.<br />
Während sie sich im Stil stark voneinander unterscheiden,<br />
ist das Material dasselbe: Heller, fränkischer<br />
Sandstein.<br />
Die vorgeschlagene Lösung fand nicht nur die uneingeschränkte<br />
Zustimmung des Auftraggebers, sondern<br />
auch des Bundesdenkmalamtes: Die Lichtlösung<br />
berücksichtigt die Unterschiedlichkeit der vier<br />
Fassaden, indem sie die historisch wichtigen Elemente<br />
akzentuiert – es gab also nicht eine, sondern vier<br />
individuelle Lichtlösungen. Die Zusammengehörigkeit<br />
entsteht durch die Verwendung einer Lichtfarbe<br />
und ähnlicher Abstrahlwinkel, die das Material Sandstein<br />
hervorheben. Insgesamt kamen 190 Leuchten<br />
und sieben verschiedene Strahlertypen zum Einsatz.<br />
Auf Wunsch des Bundesdenkmalamtes wurden die<br />
Oberflächen aller Strahler in einer eigens vorgegebenen<br />
RAL-Farbe, passend zu Fassadenfarbe, als Sonderanfertigung<br />
für dieses Projekt angefertigt.
www.<strong>architektur</strong>-online.com<br />
75<br />
Licht<br />
DI Ute Giesecke von Giesecke & Giesecke Architektur<br />
verantwortete den Um- und Ausbau des Ensembles<br />
zum Ameron Frankfurt Neckarvillen Boutique<br />
Hotels mit 133 Zimmern, eines von 15 Hotels der<br />
Ameron-Gruppe in Europa. Die Ameron-Gruppe hat<br />
es sich zur Aufgabe gemacht, in ihren Hotels hervorragende<br />
Lage, erstklassige Architektur und stilsichere<br />
Innen<strong>architektur</strong> zu verbinden. Das Interieurdesign<br />
stammt von Luigi Fragola.<br />
Die Hotelbetreiber erhalten sowohl von ihren Gästen<br />
als auch von der Frankfurter Bevölkerung ausschließlich<br />
positive Rückmeldungen für eine Lichtlösung,<br />
die die Schönheit der Fassaden sichtbar macht<br />
und zugleich ihre historische Bedeutung respektiert.<br />
Zum Autor:<br />
Mit seinem Lichtgestaltungsbüro „Illuminator“ realisiert<br />
Alexander Magyar als freier Lichtplaner projektbezogene,<br />
individuelle Lichtlösungen.<br />
www.illuminator.at<br />
Projekt: Fassadenbeleuchtung im Zuge des Um- und Ausbaus<br />
des Ameron Frankfurt Neckarvillen Boutique Hotel<br />
Auftraggeber / Bauherr: NeVi GmbH & Co.KG<br />
Hotelbetreiber: Ameron Hotels, www.ameronhotels.com<br />
Lichtberatung & Projektleitung: Manfred Peckal, www.peckal.at<br />
Architektur: DI Ute Giesecke, Giesecke & Giesecke Architektur, München<br />
www.giesecke-giesecke.de<br />
Zeitplan: 2017 – 2018 Lichtplanung, Oktober 2019 Eröffnung
<strong>architektur</strong> FACHMAGAZIN<br />
76<br />
Produkt News<br />
Unverwechselbare und<br />
nachhaltige Holzoptik<br />
Zwei Marktführer bündeln ihre Kompetenz für neue Produkte von außerordentlicher<br />
Qualität und Nachhaltigkeit: BEGA als Leuchtenproduzent sowie Aubrilam als<br />
weltweit geschätzte Marke für High-Performance-Holzmaste, Poller und Lösungen<br />
für die Stadtmöblierung präsentieren im Rahmen ihrer Systempartnerschaft eine<br />
Reihe überzeugender Beleuchtungslösungen mit unverwechselbarer Holzoptik.<br />
Holz- und Metallkomponenten sowie Lichttechnik<br />
von hoher Qualität bilden die Grundlage für die Produkte,<br />
die BEGA und Aubrilam als Partner präsentieren.<br />
So entstanden nachhaltige, werterhaltende<br />
Leuchten in spannender Materialkombination. Sie<br />
tragen dem Marktinteresse an derartigen Werkstoffkombinationen<br />
Rechnung und setzen optische Akzente.<br />
„Beste Lichttechnik und Metallverarbeitung,<br />
die als eingetragene Warenzeichen geschützt sind,<br />
treffen auf beste Holzverarbeitung“, sagt Heinrich<br />
Gantenbrink, geschäftsführender BEGA Gesellschafter.<br />
„Da für beide Partner die Philosophie elementar<br />
ist, dass allein außergewöhnliche Qualität sowie die<br />
Langlebigkeit der Produkte akzeptabel sind, ist diese<br />
Kooperation ein logischer Schritt zur Erweiterung<br />
unseres Portfolios.“<br />
Die BEGA Systempollerleuchten mit freier Wahl der<br />
Pollerleuchtenköpfe wurden um Holzpollerrohre mit<br />
dem von Aubrilam gelieferten passgenauen und maßhaltigen<br />
Accoya®-Holz erweitert. Im Rahmen der Partnerschaft<br />
wurden zudem für den öffentlichen Bereich<br />
Lichtbauelemente mit unterschiedlichen Licht- und<br />
Beleuchtungslösungen sowie Holzmaste für Aufsatzleuchten<br />
entwickelt. Für Grünflächen und Parks werden<br />
Garten- und Wegeleuchten produziert, die das<br />
moderne Kombinationsverständnis der unterschiedlichen<br />
Materialien Aluminium, Aluminiumguss und Holz<br />
mit unverwechselbaren Leuchten berücksichtigen.<br />
Für alle Komponenten der neuen Leuchten gilt der<br />
Aubrilam und BEGA Grundsatz: Höchsteffizienter<br />
Schutz vor Wetter- und Umwelteinflüssen garantiert<br />
die Wertbeständigkeit der Produkte. „Darüber hinaus<br />
sind und bleiben aber selbstverständlich auch<br />
die Betreuung und der Service im Aftersales-Bereich<br />
wichtige Elemente unserer Kundenkommunikation“,<br />
betont Heinrich Gantenbrink.<br />
BEGA Leuchten GmbH<br />
Competence Center Innsbruck<br />
T +43 (0)512 343150<br />
info-austria@bega.com<br />
www.bega.com
www.<strong>architektur</strong>-online.com<br />
77<br />
Produkt News<br />
Licht und Transparenz<br />
Die Leuchte Iris-L 600 von RIDI, die als Pendel-, Aufbau- und Wandleuchte angeboten<br />
wird, setzt neue Maßstäbe in der Architekturbeleuchtung. Das komplett neu<br />
entwickelte, transparente Gehäuse aus teilprismatischem Kunststoff gibt Einblicke<br />
in die innenliegende Technik und ermöglicht in allen Bauvarianten eine außerordentlich<br />
effiziente Beleuchtung.<br />
Die Kombination aus klarer Transparenz,<br />
mikroprismatischer Lichtlenkung und diffus<br />
streuender seitlicher Gehäuseflächen<br />
ergeben ein eigenständiges Bild. Wie das<br />
menschliche Auge, gibt es die Iris in verschiedenen<br />
Farben. Diese Akzente werden<br />
durch seitliche Folien erzeugt – und können<br />
z.B. das Corporate Design eines Unternehmens<br />
widerspiegeln.<br />
Das transparente, ringförmige Leuchtengehäuse<br />
mit 600 mm Durchmesser liefert<br />
bis zu 10.600 lm Lichtstrom und ist standardmäßig<br />
in Lichtfarben 830, 840 und in<br />
Tunable White erhältlich. Die abgependelte<br />
Variante verfügt zudem über einen magnetisch<br />
geschlossenen Baldachin ohne Sichtschrauben.<br />
RIDI Leuchten GmbH<br />
T +43 (0)1 7344 210-0<br />
office@ridi.at<br />
www.ridi-group.com
<strong>architektur</strong> FACHMAGAZIN<br />
78<br />
Produkt News<br />
Funktionserhalt schützt Leben<br />
Das 1938 gegründete heimische Traditionsunternehmen Siblik Elektrik beschäftigt<br />
über 130 Mitarbeiter an vier Standorten in Wien, Graz, Vöcklabruck und<br />
Innsbruck. Namhafte in- und ausländische Hersteller aus der Elektro- und Haustechnik-Branche<br />
sind eng mit Siblik verbunden und werden exklusiv in Österreich<br />
vertreten. Wie etwa das Unternehmen Spelsberg, das unter der Dachmarke<br />
„Lifeline“ smarte Brandschutzlösungen anbietet, die auch im Brandfall unterbrechungsfrei<br />
arbeiten.<br />
Nur absolut zuverlässige Produkte können<br />
im Falle eines Brandes den elektrischen<br />
Funktionserhalt sicherstellen und somit die<br />
Ausbreitung eines Feuers verhindern um<br />
Leben zu schützen. Aufzüge, Notbeleuchtung,<br />
Entrauchungsanlagen – bei Bränden<br />
sind diese und weitere Sicherheitseinrichtungen<br />
überlebenswichtig. Gerade in Gebäuden,<br />
die von vielen Menschen frequentiert<br />
werden, gilt es, sicherheitstechnische<br />
Anlagen möglichst immun gegen Feuer<br />
und Hitze zu halten. Besondere Bedeutung<br />
kommt in diesem Zusammenhang den Kabelabzweig-<br />
und Verbindungskästen zu. Sie<br />
sind die verbindenden Elemente, die nicht<br />
nur Strom weiterleiten und verteilen, sondern<br />
auch wichtige Daten, etwa von Feuer-<br />
und Rauchmeldern, die über Kommunikationsleitungen<br />
durch Kabelabzweig- und<br />
Verbindungskästen laufen.<br />
Lifeline-Produkte garantiert die Funktion<br />
dieser lebensrettenden Anlagen: Die Kabel-<br />
abzweig- und Verbindungskästen, sowie<br />
die WKE-AK Kleinverteiler bieten im Brandfall<br />
elektrischen Funktionserhalt zwischen<br />
30 und 90 Minuten und sorgen somit im<br />
Ernstfall für einen wertvollen Zeitgewinn<br />
für eine Evakuierung und den Kampf gegen<br />
das Feuer.<br />
Verbinden, abzweigen, absichern<br />
Die Serie WKE 2-6 von Lifeline präsentiert<br />
sich in drei Gehäusegrößen. Die Produkte<br />
sind mit feuerfesten Basisträgern, Trägerschienen<br />
und Klemmen aus hochtemperaturbeständiger<br />
Spezialkeramik bestückt. Aufgrund<br />
ihrer Witterungsbeständigkeit eignen<br />
sie sich auch für Außenanwendungen. Die<br />
Kästen werden vormontiert ausgeliefert und<br />
sind mit ihren 90 Grad drehbaren Außenbefestigungslaschen<br />
sofort einsatzbereit.<br />
Die Kabelabzweig- und Verbindungskästen<br />
für Kommunikationslösungen von Lifeline<br />
sind flexibel einsetzbar und umfassen bis<br />
zu 32 Klemmen. Ausgeliefert werden sie in<br />
zwei Gehäusegrößen mit einem elektrischen<br />
Funktionserhalt von 30 bis 90 Minuten.<br />
Das Lifeline-Sortiment bietet darüber hinaus<br />
auch Kabelabzweig- und Verbindungskästen<br />
mit eingebauter Sicherung. Im Hauptstrang<br />
beträgt der elektrische Funktionserhalt hierbei<br />
30 bis 90 Minuten. Bei dieser Lösung<br />
wird für jeden Brandabschnitt ein separater,<br />
abgesicherter Abzweig installiert. Im Fehlerfall<br />
werden elektrische Verbraucher automatisch<br />
vom Hauptstrang getrennt. Daher ist<br />
bei Versorgungsausfall lediglich der jeweilige<br />
Abschnitt bis zur Sicherung betroffen.<br />
Bei Kurz- oder Erdschlüssen kann auf diese<br />
Weise der Ausfall der gesamten Anlage verhindert<br />
werden.<br />
Siblik Elektrik GmbH & Co. KG<br />
T +43 (0)1 68 006-0<br />
info@siblik.com<br />
www.siblik.com
www.<strong>architektur</strong>-online.com<br />
79<br />
Produkt News<br />
Gut für Körper und<br />
Geist!<br />
Gesundheitsschutz<br />
für Verarbeiter und<br />
Bauherren.<br />
Martin Dolenz<br />
Rhode Oberflächentechnik<br />
aus Enzersfeld<br />
X-CUBE X2<br />
Optimierte Lösungen<br />
Mit der X-CUBE Raumlufttechnik-Geräteserie hat TROX neue Maßstäbe für Flexibilität,<br />
Hygiene, Energieeffizienz, Wartungsfreundlichkeit und Vernetzbarkeit gesetzt. X-CU-<br />
BE X2 ist eine neu entwickelte Baureihe, mit der TROX sein X-CUBE Programm nun<br />
gezielt erweitert. Die Geräte der neuen Baureihe sind die optimale Lösung für Volumenströme<br />
bis 25.000 m³/h (6,9 m³/s). Sie sind frei konfigurierbar und können für alle<br />
Luftbehandlungsvorgänge eingesetzt werden.<br />
Der X-CUBE X2 compact deckt dabei Volumenströme bis 15.000 m³/h (4,2 m³/s) ab.<br />
Vorkonfiguriert zeichnet er sich durch eine besonders kurze Lieferzeit aus. Mit den<br />
aufeinander abgestimmten Komponenten und der cleveren integrierten Regelung arbeitet<br />
er höchst effizient. Ein konstruktives Highlight der neuen Serie ist der optional<br />
erhältliche schwingungsgedämpfte Grundrahmen. Das RLT-Gerät kann hiermit direkt<br />
auf den Untergrund gestellt werden – ganz ohne zusätzliche schwingungsentkoppelnde<br />
Maßnahmen.<br />
Mit dem webbasierten X-CUBE Konfigurator kann das RLT-Gerät ganz einfach anhand<br />
individueller Parameter konfiguriert werden. Nach Eingabe von wenigen Informationen<br />
wie Aufstellungsart und Wärmerückgewinnung sowie der wichtigsten Dimensionierungspunkte<br />
ermittelt das System sekundenschnell die optimale Geräteauslegung und<br />
prognostiziert standortspezifisch die Lebenszykluskosten. Investitions-, Wartungsund<br />
Energiekosten werden detailliert aufgeschlüsselt und verständlich visualisiert.<br />
Ausgestattet ist der X-CUBE X2 mit der neuen Steuerungssoftware X-CUBE control<br />
2.0. Das Gerät lässt sich über ein hochperformantes Touchpanel bedienen und an die<br />
TROX Systeme X-AIRCONTROL, TROXNETCOM und X-TAIRMINAL anbinden. Die Monitoring-Funktionen<br />
mit automatischen Statusmeldungen ermöglichen eine bequeme<br />
Systemkontrolle rund um die Uhr.<br />
Über BACnet IP oder Modbus TCP/IP wird der X-CUBE X2 nahtlos in die Gebäudeleittechnik<br />
integriert. Dank dieser universellen Vernetzbarkeit lässt sich die Leistung des<br />
Geräts anforderungsgerecht steuern. So wird bester Komfort mit maximaler Energieeinsparung<br />
verknüpft.<br />
TROX Austria GmbH<br />
T +43 (0)1 25043-0<br />
trox@trox.at<br />
www.trox.at<br />
BEST4YOU<br />
Die Produktlinie für Profis<br />
MUREXIN Produkte verwende ich<br />
schon ewig und drei Tage. Weil sie<br />
unbedenklich in der Verarbeitung<br />
sind. Zusätzlich fordere ich auch<br />
meinen Geist mit Schulungen<br />
im neuen MUREXIN Technikum.<br />
Dort erlernt man auch alles über<br />
BEST4YOU, die Produktlinie mit<br />
Premium-Qualität, großer Umweltfreundlichkeit,<br />
maximaler Performance<br />
und hoher Arbeitserleichterung.<br />
Mein Produkttipp:<br />
Physiologisch unbedenklich:<br />
Murexin Natursteinteppichharz MS-1K<br />
RLT-Gerätekonfigurator<br />
MUREXIN. Das hält.
<strong>architektur</strong> FACHMAGAZIN<br />
80<br />
Produkt News<br />
Das Bad als Wohnraum<br />
Der Sanitärspezialist Laufen bietet Qualität und Design aus österreichischer Produktion,<br />
wobei eine Hauptrolle im Produktprogramm das revolutionäre Material<br />
SaphirKeramik spielt: Das ausgesprochen schlanke Material verfeinert die Raumwirkung<br />
des Bades und besitzt gleichzeitig das gestalterische Potenzial, dem Bad<br />
mit haptischen Oberflächentexturen eine neue wohnliche Qualität zu verleihen.<br />
Um dieses Potenzial voll auszuschöpfen hat Laufen<br />
mit renommierten Designern kooperiert und mit ihnen<br />
Produkte aus SaphirKeramik entwickelt, die Architekten<br />
und Badplanern neue Spielräume bei der Ausstattung<br />
hochwertiger, wohnlicher Bäder schenken.<br />
„The New Classic“ ist eine neue Badkollektion von<br />
Laufen, für die Star-Designer Marcel Wanders klassische<br />
Formen mit SaphirKeramik neu interpretiert hat.<br />
In jedem Stück der Kollektion verbinden sich Flair<br />
und Kreativität des Designers mit der meisterhaften<br />
Beherrschung des Materials durch Laufen. Ikonische,<br />
klassische Formen verbinden sich mit femininen, geschwungenen<br />
Linien. Die neue Kollektion umfasst<br />
Waschtische und Waschtisch-Schalen, WCs, ein Bidet,<br />
Badewanne, Armaturen, Spiegel und Accessoires<br />
sowie Möbel.<br />
Konstantin Grcic realisiert für Laufen den Traum vom<br />
Designer-Bad aus einem Guss. Seine vielfach prämierte<br />
Linie Val wurde nun um eine neue Funktion<br />
erweitert und konzentriert sich mit neuen Waschtischen<br />
besonders auf kompakte und anspruchsvolle<br />
Badgrungrisse. Dabei zeigt sich, dass die SaphirKeramik<br />
für diese Aufgabe geradezu prädestiniert ist.<br />
Dank ihrer feinen Wände und schmalen Kantenradien<br />
tragen die Waschtische aus der innovativen Keramik<br />
kaum auf, was die Raumwirkung gerade bei kleinen<br />
Bädern transparenter und freier macht.<br />
LAUFEN Austria AG<br />
T +43 (0)2746 6060-0<br />
office.wi@at.laufen.com<br />
www.laufen.co.at<br />
LAUFEN Showroom Wien<br />
Salzgries 21, 1010 Wien<br />
Ausgestellt sind die Serien<br />
„The New Classic“ und „Val“.
www.<strong>architektur</strong>-online.com<br />
81<br />
Produkt News<br />
Funktional und zeitlos…<br />
…das sind Attribute, die für Badprodukte von Repabad stehen. Die Entwickler des<br />
Badspezialisten setzen ihre Schwerpunkte darauf, Produkte und Badlösungen zu<br />
schaffen, die verschiedenen Stilrichtungen entsprechen und sich individuell in<br />
jedes Badezimmer einfügen. Auch Understatement ist ein Privileg der Repabad<br />
Produkte: Badewannen, Duschen und Badspiegel zeigen oft erst auf den zweiten<br />
Blick, was alles in ihnen steckt.<br />
Die vermeintliche Dusche ist zum Beispiel ein Dampfbad<br />
mit Zusatzfunktionen wie Infrarot, Sole, Musik,<br />
Farblicht- und Aromatherapie. Oder die Badewanne<br />
versteckt gekonnt Lautsprecher, Scheinwerfer<br />
und Massagedüsen. Und auch der Spiegel oder die<br />
Waschtischplatten aus Mineralwerkstoff entpuppen<br />
sich als Soundbox.<br />
Produkte aus dem Hause Repabad machen das Badezimmer<br />
zum Private Spa und ermöglichen zum<br />
Beispiel auch Hotels mit eingeschränkten Platzverhältnissen,<br />
im Wellness-Markt ein Wörtchen mitzureden.<br />
Damit ist das Private Spa erst zweitrangig von<br />
den zur Verfügung stehenden Raumverhältnissen<br />
abhängig, denn der Platzbedarf entspricht einer<br />
Wanne bzw. einer Dusche. Entscheidend sind individueller<br />
Kundenwunsch und Budget.<br />
Understatement mit Überraschungen<br />
Die Badewanne wird zum persönlichen Masseur inklusive<br />
farbigem Licht und Musik. Dafür werden<br />
verschiedene Massagesysteme für bestimmte Kör-<br />
perzonen, wie Rückentherapie für den Rücken-Schulter-Bereich,<br />
Aquapunktur für Rücken und Füße und<br />
Aqua Comfort für den ganzen Körper angeboten. Die<br />
verfügbaren Whirlsysteme ermöglichen Ganzkörpermassagen,<br />
die sich individuell regulieren lassen.<br />
Farbiges Licht und Musik runden das Wohlfühlpaket<br />
„Badewanne“ ab. Die Badewanne wird dabei zum<br />
Klangkörper. Lautsprecher und Bluetooth Receiver<br />
sind auf der Rückseite der Wanne unsichtbar verbaut.<br />
Und auch die Repabad-Dusche ist gleichzeitig<br />
Infrarotkabine oder gleich Dampfbad mit Sole-Funktion,<br />
Infrarot, Farblicht-, Aromatherapie und Musik.<br />
Aber „Musik“ lässt sich fast in jedem Repabad Produkt<br />
verstecken: Badewanne, Infrarotpaneel, Waschtischplatte<br />
und Spiegel werden zu Klangkörpern, wobei<br />
die Bluetooth Receiver und Lautsprecher immer<br />
nicht sichtbar verbaut sind.<br />
Im Hotel bringt jeder Gast seine Musikquelle selbst<br />
mit – das Wiedergabegerät wird einfach per Bluetooth<br />
verbunden und die eigene Playlist ist so jederzeit nur<br />
einen Klick entfernt.<br />
repaBAD GmbH<br />
T +43 (0)800 29 35 18<br />
info@repabad.com<br />
www.repabad.com
<strong>architektur</strong> FACHMAGAZIN<br />
82<br />
Produkt News<br />
Mehr Badekomfort<br />
Zeitlose Linienführung, vielfältige Formate, hohe Alltagstauglichkeit, langlebige<br />
Qualität und ein erschwinglicher Preis – damit avancierte die Einbau-Badewanne<br />
BetteForm zum Klassiker im Basis-Segment des Badezimmers. Wie man ein solches<br />
Erfolgsmodell in Form und Funktion aktualisiert, demonstriert Bette mit einem<br />
wohlüberlegten Redesign der beliebten Badewanne.<br />
Die Evolution der BetteForm zeichnet sich vor allem<br />
durch ein geradlinigeres Design des Innenkörpers<br />
aus: Denn die Seitenwände laufen nun parallel zueinander<br />
statt sich zum Fußende hin zu verjüngen.<br />
Das verleiht der Badewanne einen frischen, modernen<br />
Look und ein präsentes Volumen, das handfeste<br />
Vorteile für den Benutzer bietet: Dank der Überarbeitung<br />
ist der Rückenbereich nun breiter und fällt<br />
ergonomisch sanfter nach unten ab. Gearbeitet hat<br />
Bette außerdem am präzisen Erscheinungsbild des<br />
glasierten Titan-Stahls. Die Ecken der Badewanne<br />
sind jetzt mit einem kleineren R10-Radius so definiert<br />
gestaltet, dass sie sich bei der Befliesung des Wannenträgers<br />
sehr exakt ins Muster einpassen lassen.<br />
Dank der enormen Farbpalette kann die klassische<br />
Körperformwanne passend zu unterschiedlichen<br />
Milieus und Oberflächen sowie aktuellen Farbtrends<br />
geplant werden. Zwölf Formate zwischen 1400 ×<br />
700 mm bis 1900 × 800 mm und eine Wannentiefe<br />
von 420 mm bringen entspannten Badekomfort und<br />
Lebensqualität in kompakte Bäder genauso wie in<br />
geräumige Familienbäder.<br />
Bette GmbH & Co. KG<br />
T +49 (0)5250 511-0<br />
projekte@bette.de<br />
www.my-bette.com
www.<strong>architektur</strong>-online.com<br />
83<br />
Produkt News<br />
Minibäder<br />
barrierefrei<br />
gestalten<br />
Mit den richtigen Badlösungen wird selbst das Minibad zur<br />
barrierefreien Zone. Dreh- und Angelpunkt sind dabei Lösungen,<br />
die nicht nur in puncto Material, Funktion und Design einen<br />
Mehrwert bieten, sondern auch den Kriterien zur Barrierefreiheit<br />
entsprechen.<br />
Viele Bäder bieten eine Fläche von nur sechs Quadratmetern,<br />
wodurch die vorgegebenen Bewegungsflächen für die Barrierefreiheit<br />
von bis zu 150 x 150 cm vor jedem Sanitärgegenstand<br />
nicht leicht einzuhalten sind. Diese Bewegungsflächen dürfen<br />
sich jedoch überschneiden – so kann eine schwellenfreie Dusche<br />
unter bestimmten Voraussetzungen in die Bewegungsflächen<br />
einbezogen werden.<br />
Als Innovationstreiber am Markt und Partner für barrierefreie<br />
Badgestaltung hat Kaldewei Speziallösungen für schwierige<br />
Einbausituationen und Grundrisse entwickelt: Die Duschfläche<br />
Cayonoplan Multispace ist die weltweit erste emaillierte Duschfläche,<br />
die sowohl Dusch- als auch Bewegungsfläche sein kann.<br />
Franz Kaldewei GmbH & Co. KG<br />
T +49 (0)2382 785-0<br />
info@kaldewei.de<br />
www.kaldewei.de<br />
#greywood<br />
Die fein nuancierten Grautöne aus der Natur<br />
sind in der Reihe „Natürlich Inspiriert“ erhältlich.<br />
Broschüre anfordern unter<br />
inspiriert@synthesa.at<br />
www.synthesa.at
<strong>architektur</strong> FACHMAGAZIN<br />
84<br />
Produkt News<br />
© Parlamentsdirektion / Jabornegg&Pálffy_AXIS / ZoomVP © Geberit / Stephan Huger<br />
Modern, transparent, nachhaltig<br />
Seit Sommer 2017 wird das vor über 130 Jahren eröffnete Österreichische Parlament<br />
generalsaniert. 2021 wird das geschichtsträchtige Haus an der Ringstraße<br />
wieder eröffnet und modern und zukunftsfit sein.<br />
Während die Gebäudehülle des Parlaments<br />
im Zuge der Generalsanierung weitestgehend<br />
unberührt bleibt, wird das Innere von<br />
unten bis oben einem technischen Update<br />
unterzogen. Mit streng limitierten finanziellen<br />
Mitteln und auf beschränkter Baufläche<br />
wird der Bestandsbau unter der Federführung<br />
vom Generalplaner Jabornegg & Pálffy_<br />
AXIS auf den neuesten Stand der Technik<br />
gebracht: Trockenlegung, Wärmedämmung<br />
und die Verstärkung von Tragkonstruktionen<br />
stehen ebenso am Plan wie die Erneuerung<br />
von Heizung, Lüftung und Klimaanlagen und<br />
der Einbau neuer kompakter Sanitäreinheiten<br />
mit Wasserspareinrichtungen.<br />
Für die Bereiche Heizung, Kühlung und Sanitäranlagen<br />
sowie die Regenentwässerung<br />
ist bei diesem Projekt das Unternehmen Bacon<br />
Gebäudetechnik zuständig und zeichnet<br />
so sowohl für verlässlich arbeitende<br />
technische Einrichtungen wie in Folge für<br />
ein gesundes Raumklima im „neuen“ Hohen<br />
Haus verantwortlich.<br />
Mit Abschluss der allgemeinen statischen<br />
Überprüfungen auf Bau- und Erdbebensicherheit<br />
und diversen baulichen Vorarbeiten,<br />
startete das Installationsteam mit den<br />
umfangreichen Leitungs- und Rohrverlegungen<br />
und der Anbringung von sanitären<br />
Unterputz-Elementen in den Nassgruppen.<br />
Materialseitig setzt Bacon dabei auf die<br />
vielseitigen Geberit Rohrsysteme Mapress<br />
und Mepla sowie auf bewährte Huter Unterputz-Elemente<br />
und Geberit iCon Keramiken.<br />
Die neu ausgebauten Dachbereiche des<br />
Ringstraßenbaus sind zudem mit der Pluvia<br />
Dachentwässerung von Geberit ausgestattet<br />
und werden künftig mit innovativer Unterdrucktechnik<br />
das verlässliche Ablaufen<br />
von Regenwasser sicherstellen.<br />
Der Energiebedarf der Nutzflächen wird mit<br />
Wärmedämmung, Wärmerückgewinnung,<br />
modernen Steuermodulen, neuen Fenstern<br />
und Türen, u.v.m. um bis zu 60 Prozent reduziert<br />
werden. Ansprechende Multifunktionsräume<br />
sollen dabei künftig Nutzungsflexibilität<br />
bieten – ob für den Sitzungsbetrieb<br />
oder Veranstaltungen. Eine neue Dachlandschaft<br />
mit vier Terrassen und zusätzlichen<br />
Galerien soll zudem einen beeindruckenden<br />
Panoramablick auf Wien erlauben.<br />
Mit barrierefreien Eingängen, Sanitäranlagen,<br />
Aufzügen, Rampen und einem neuen<br />
Leitsystem wird sich das Parlament auch allen<br />
Besucherinnen und Besuchern präsentieren,<br />
die sich für Führungen und Einblicke<br />
ins Plenumsgeschehen einfinden werden.<br />
Sie können künftig – nach dem Betrachten<br />
aufpolierter Marmorsäulen, historischer<br />
Statuen und spektakulärerer Architektur –<br />
die neu geschaffenen Besucherzonen inklusive<br />
Gastronomiebereich und die Aussicht<br />
auf den Dachterrassen genießen.<br />
Geberit Vertriebs GmbH & Co KG<br />
T +43 (0)2742 401 0<br />
sales.at@geberit.com<br />
www.geberit.at<br />
© Geberit / Stephan Huger<br />
Die zukünftigen neuen Toilettenräume werden<br />
hinter der Wand mit Geberit und Huter<br />
Montageelementen ausgestattet, vor der<br />
Wand mit Geberit iCon Keramiken.<br />
© Geberit / Stephan Huger<br />
Ein Blick in die sogenannte Sandwich-Zone mit<br />
den HKLS Leitungen: Die Fußbodenheizungsverteilung<br />
und -anbindung wurde mit Geberit<br />
Mepla ausgeführt, Trinkwasser- bzw. Kälteleitungen<br />
mit Geberit Mapress, Geberit PE-HD<br />
kam für die Abwasserleitungen zum Einsatz.
www.<strong>architektur</strong>-online.com<br />
85<br />
Produkt News<br />
Fotos: WICONA/Mediashots<br />
Eine der grünsten<br />
Aluminiumlegierungen<br />
Dass Nachhaltigkeit bei WICONA im Fokus steht, beweist das Aluminium-Systemhaus<br />
einmal mehr durch den Einsatz von Hydros CIRCAL in seinen Aluminium-Systemlösungen.<br />
Bei Hydro CIRCAL handelt es sich um eine Aluminiumlegierung mit<br />
dem derzeit höchsten Recyclinggehalt auf dem Markt. Nun gibt es die ersten Bauaufträge<br />
mit WICONA Systemen in dieser Legierung u.a. in Kuwait, Deutschland,<br />
Frankreich, Schweden, Großbritannien, den Niederlanden und Norwegen.<br />
2018 hat die norwegische Hydro-Gruppe, zu der auch<br />
WICONA gehört, seine neue Aluminiumlegierung Hydro<br />
CIRCAL 75R vorgestellt. Die Legierung besteht<br />
aus mindestens 75% Post-Consumer-Schrott, also<br />
Altschrott, wie zum Beispiel Fassaden und Fenstern,<br />
die am Ende ihrer Nutzung von Gebäuden demontiert<br />
und vollständig recycelt wurden. Es handelt sich um<br />
eine Legierung in Premiumqualität mit dem derzeit<br />
höchsten Anteil an wiederverwertetem Aluminium.<br />
Das Einschmelzen von Aluminium für die erneute<br />
Verwendung benötigt nur 5% der Energie, die bei<br />
der Herstellung von Primäraluminium benötigt wird.<br />
Je höher also der Recycling-Anteil von Post-Consumer-Schrott<br />
(Altschrotten), desto geringer ist der<br />
CO 2 -Fußabdruck. Hydro CIRCAL 75R kommt nachweislich<br />
auf den weltweit geringsten CO 2 -Fußabdruck:<br />
rund 2,0 kg CO 2 (1,5 – 2,3 kg CO 2 ) pro Kilo Aluminium<br />
– 6-mal oder 84% weniger als der weltweite<br />
Durchschnitt in der Primärgewinnung.<br />
Die ersten Aufträge für WICONA Systeme in dieser<br />
Legierung werden nun ausgeführt, u.a. auch für das<br />
Bürogebäude DIN-Institut in Berlin.<br />
Hydro ist der erste Aluminiumproduzent, der hochwertiges<br />
Aluminium mit einem zertifizierten Gehalt<br />
von mehr als 75% wiederverwertetem End-of-life-Aluminium<br />
liefert. Das Zerkleinern und Sortieren<br />
von Schrott findet im Werk in Dormagen statt. Von<br />
dort geht das Metall zum Umschmelzen nach Clervaux,<br />
Luxemburg, wo die Hydro CIRCAL 75R-Bolzen<br />
hergestellt werden. Der Produktionsprozess ist<br />
lückenlos nachvollziehbar, und das Produkt ist von<br />
einem unabhängigen Dritten (DNV-GL) zertifiziert.<br />
Mit Hydro CIRCAL 75R ermöglicht WICONA Bauherren<br />
und Architekten, die anspruchsvollen Nachhaltigkeitsziele<br />
von morgen heute schon zu erreichen<br />
– darunter auch Umwelt-Gebäudezertifizierung nach<br />
LEED, BREEAM oder DGNB.<br />
Hydro Building Systems Austria GmbH<br />
T +43 (0)6212 20000<br />
info@wicona.at<br />
www.wicona.at
<strong>architektur</strong> FACHMAGAZIN<br />
86<br />
Produkt News<br />
Schwimmender Hafen<br />
Das Kreuzfahrtterminal in Hongkong wurde um einen 9.300 m² großen Anbau<br />
erweitert und modernisiert. Der optisch an einen Schiffsbug angelehnte Bau, vom<br />
Architekten Sir Norman Foster entworfen, ist eine schwimmende Konstruktion<br />
und zieht sich wie eine Landzunge auf das Wasser.<br />
Die Form des Gebäudes sollte einerseits an<br />
die einfahrenden Schiffe erinnern. Gleichzeitig<br />
bietet die Architektur eine Antwort<br />
auf das tropische Klima vor Ort. Die breiten<br />
freitragenden Terrassen, die drei Seiten des<br />
Terminals umlaufen, und die zusätzlich geneigte<br />
Balustrade, die wie eine Jalousie fungiert,<br />
beschatten die jeweils untere Ebene.<br />
Die Fassade des vier Etagen umfassenden<br />
Neubaus besteht komplett aus großflächigen<br />
Fenstern und schafft maximale Transparenz<br />
für großzügige Ausblicke. Jeweils<br />
ein Schiebefenster und ein festes Glaselement<br />
wechseln sich ab, sodass der Anbau<br />
aus insgesamt hundert Glasscheiben besteht.<br />
Umgesetzt wurde die Innen-Außenbeziehung<br />
durch großflächige Schiebefenster<br />
mit schmalen Profilen.<br />
Da sich aufgrund der schwimmenden Konstruktion<br />
der Boden des Gebäudes bewegt<br />
und es zudem aufgrund der exponierten<br />
Lage hohen Windlasten ausgesetzt ist,<br />
musste ein individuell auf die Verhältnisse<br />
zugeschnittenes Schiebefenster entwickelt<br />
werden. Damit beauftragte der Bauherr<br />
Harbour City Estates Limited das international<br />
agierende Unternehmen Solarlux.<br />
Die Forschung und Entwicklungsabteilung<br />
des Herstellers beschäftigte sich rund ein<br />
halbes Jahr mit dem Auftrag, das Schiebefenster<br />
cero so zu optimieren, dass es den<br />
statischen Anforderungen für dieses außergewöhnliche<br />
Bauvorhaben gerecht wird.<br />
Mehrere Stahleinschübe, neue Profile und<br />
ein zusätzlicher Laufwagen unter den Fensterpfosten<br />
ermöglichten es, die großflächigen<br />
Schiebeelemente von bis zu 4,60 m<br />
Höhe und 2,40 m Breite auf die besonderen<br />
örtlichen Gegebenheiten abzustimmen.<br />
Alle cero Elemente halten Windlasten bis<br />
3.500 Pascal stand – das entspricht in etwa<br />
einer Windgeschwindigkeit von 270 km/h.<br />
Somit ist das Schiebefenster optimal für<br />
den Einsatz im Ocean Terminal in Hongkong<br />
geeignet.<br />
SOLARLUX AUSTRIA GmbH<br />
T +43 (0)512 209 023<br />
info@solarlux.at<br />
www.solarlux.at
www.<strong>architektur</strong>-online.com<br />
87<br />
Produkt News<br />
Intelligentes Tageslichtmanagement<br />
Große Fensterflächen leiten möglichst viel natürliches Tageslicht in die Räume<br />
und smarte Gläser gewinnen dabei immer mehr an Bedeutung, da sie thermischen<br />
und visuellen Komfort mit hohen Energieeinsparungspotenzialen<br />
verbinden. Und auch die Gesundheits<strong>architektur</strong> hat die Vorteile dieser Glastechnologie<br />
erkannt: Licht und Dunkelheit, Lichtintensität und Lichtfarbe sind<br />
wesentliche Trigger für Körperfunktionen wie Hormonbildung, Herzkreislauftätigkeit<br />
oder auch den Gemütszustand.<br />
Jüngstes Referenzobjekt dafür ist ein großflächiges,<br />
smartes Skylight in der Altenpflegeeinrichtung<br />
Avondzon im belgischen<br />
Erpe-Mere. Realisiert mit dem schaltbaren<br />
Halio® Glassystem dient es in vielerlei Hinsicht<br />
als verbindendes und gesundheitsförderndes<br />
Element. Insgesamt 132 Fenster<br />
bilden in der Altenpflegeeinrichtung ein<br />
Glasdach, das auf einer Fläche von 304 m 2<br />
den alten, im Jahr 1978 errichteten Trakt, mit<br />
dem im Jahr 2019 fertiggestellten Neubau<br />
verbindet. 73 moderne, großzügige Zimmer<br />
öffnen sich zu einem lichtdurchfluteten Gemeinschaftsbereich<br />
unter der Verglasung.<br />
Bei starker Sonneneinstrahlung können die<br />
Halio Glaseinheiten – separat oder in Gruppen<br />
– in weniger als drei Minuten komplett<br />
verdunkelt werden. Im getönten Zustand<br />
blocken sie 95 % des Energieeintrags sowie<br />
98 % des Lichts.<br />
Ergänzt wird das Halio System im Avondzon<br />
durch eine cloudbasierte Regelung, die<br />
in jedes gängige Gebäudeautomationssystem<br />
integrierbar ist. Halio Cloud passt Tönungsgrad<br />
dank spezieller Algorithmen an<br />
die individuellen Bedürfnisse an, wobei individuelle<br />
Parameter wie Gebäudenutzung,<br />
Lage und Ausrichtung der Fassaden sowie<br />
Wetterbedingungen in die Berechnungen<br />
einfließen. Jedes Glaspanel wird über einen<br />
eigenen Regler kontrolliert und die Steuerung<br />
durch den Endnutzer erfolgt über intuitive<br />
und drahtlos vernetzte Schnittstellen.<br />
Das dynamische Halio Glas mit smarter Tönung<br />
dunkelt unmerklich nach. Damit sorgt<br />
es zu jeder Zeit für möglichst hohen Tageslichteinfall,<br />
nimmt dem Sonnenlicht jedoch<br />
die unangenehme Blendwirkung bei einem<br />
absoluten thermischen Komfort. Mit einem<br />
Farbwiedergabeindex von 97 ist das elektrochrome<br />
Halio Glas komplett farbneutral<br />
und zeigt im getönten Zustand weder Blaustich<br />
noch Raster oder sprunghafte Verläufe.<br />
Mit Ug-Werten bis zu 0,6 W / (m²K) zeigt<br />
sich Halio Glas beim Management von<br />
Wärmegewinnen und der Reduzierung des<br />
Kühlbedarfs höchst effizient und trägt damit<br />
wesentlich zum Erreichen von BREEAM,<br />
LEED und WELL Zertifizierungen bei.<br />
Halio International<br />
Robert Jagger<br />
M +49 (0)173 568 5529<br />
robert.jagger@halioglass.com<br />
www.halioglass.eu/de
<strong>architektur</strong> FACHMAGAZIN<br />
88<br />
Produkt News<br />
Ein System, viele Werte<br />
Das neue Schüco Türsystem AD UP (Aluminium Door Universal Platform) vereint<br />
Stabilität im Kern und hohe Wärmedämmung in einem System. Neben den<br />
klassischen Charakteristiken einer Aluminiumtür und dem modernen und hochwertigen<br />
Design bietet die Systemplattform auch die technischen Voraussetzungen,<br />
um intelligente Schüco Technik aus den Bereichen Türkommunikation und<br />
Zutrittskontrolle einfach zu integrieren.<br />
Der Profilaufbau ohne Schäume unterstützt<br />
die verdeckte Kabelführung und ermöglicht<br />
eine passgenaue Einbindung der Technik.<br />
Mit flügelüberdeckenden Türfüllungen (einoder<br />
beidseitige Aufsatzfüllungen), verdeckt<br />
liegenden Türbändern und verschiedenen<br />
Flügelvarianten bietet das System auch optische<br />
Gestaltungsfreiheit und kombiniert<br />
hochwertiges Türdesign mit individuellen<br />
Ausstattungsmerkmalen. Zudem reduzieren<br />
die bautiefenübergreifenden Beschlagsteile<br />
die Anzahl der benötigten Bauelemente und<br />
der symmetrische Profilaufbau, die verdeckt<br />
liegende Elementbefestigung und die integrierte<br />
Abstützung für Rahmendübel bieten<br />
hohe Montagesicherheit. Eine effiziente, saubere<br />
und schnelle Fertigung von Haus- und<br />
Eingangstüren gelingt durch neue Flügelvarianten<br />
mit mechanischem Befestigungsprinzip.<br />
Die Aufsatzfüllungen (ein- und beidseitig)<br />
werden hierbei nicht mehr geklebt,<br />
sondern mit dem Flügelprofil verschraubt.<br />
Ob als stilvolle Haustür oder hoch frequentierte<br />
Objekttür – eine stabile Konstruktion<br />
mit einem 5-Kammer-Aluminium-Profilaufbau<br />
bietet Funktionssicherheit und erfüllt<br />
die aktuellen Anforderungen an Energieeffizienz.<br />
Ohne zusätzliche Schäume in der<br />
Stegverbundzone erreicht das Türsystem<br />
AD UP höchste Systemleistungseigenschaften<br />
in der Bautiefe 75 mm. Gleichzeitig<br />
ermöglicht das modulare Dichtungs- und<br />
Dämmsystem eine maßgeschneiderte Anpassung<br />
an die individuellen Dichtigkeitsund<br />
Energieeffizienzanforderungen.<br />
ALUKÖNIGSTAHL GmbH<br />
T +43 (0)1 98130-0<br />
office@alukoenigstahl.com<br />
www.alukoenigstahl.com
www.<strong>architektur</strong>-online.com<br />
Mehr Freiheit im Labordesign<br />
In Laboren, Krankenhäusern, Reinräumen<br />
und in der Lebensmittelindustrie: Wo die Anforderungen<br />
an Sauberkeit und Hygiene am<br />
höchsten sind, ist Max Compact Resistance 2<br />
von FunderMax die richtige Wahl. Die Laborplatte<br />
zeichnet sich durch chemische Beständigkeit<br />
sowie hohen mechanischen Widerstand<br />
aus – und ermöglicht mit einer Vielzahl<br />
an Dekoren mehr Gestaltungsfreiheit.<br />
Für die hochbeständige Laborplatte stehen<br />
insgesamt 13 ansprechende Dekore zur<br />
Auswahl, darunter der neue Uni-Farbton<br />
Vulkangrau. In Verbindung mit den erstklassigen<br />
Eigenschaften bietet Max Compact<br />
Resistance2 somit noch mehr Freiheit bei<br />
der Gestaltung und schafft in extrem beanspruchten<br />
Bereichen eine dauerhaft attraktive<br />
Arbeitsumgebung.<br />
FunderMax GmbH<br />
T +43 (0)5/9494-0<br />
www.fundermax.at<br />
office@fundermax.at<br />
89<br />
Produkt News<br />
Max Compact Resistance 2<br />
Dekor 2182 RE Vulkangrau<br />
Auf Zuverlässigkeit bauen.<br />
Mit dem Schöck Isokorb®.<br />
Ob frei auskragender oder gestützter Balkon, ob Attika oder Brüstung. Der Schöck Isokorb®<br />
bietet optimale Wärmedämmleistung ohne Einschränkung der Statik und der Gestaltungsfreiheit.<br />
Verlassen Sie sich auf die bewährte Spitzenqualität von Schöck.<br />
Schöck Bauteile Ges.m.b.H | Thaliastraße 85/2/4 | 1160 Wien | Tel.: 01 7865760 | www.schoeck.at
<strong>architektur</strong> FACHMAGAZIN<br />
90<br />
Produkt News<br />
© Guido Erbring Photography, Köln<br />
Akustikdecke vom Star-Designer<br />
Die kubischen Akustikelemente „Corpus“, vom Star-Architekt Hadi Teherani für<br />
OWA entworfen, wurden bereits mehrfach mit internationalen Designpreisen<br />
ausgezeichnet. Die quadratischen und rechteckigen Deckenelemente sorgen nun<br />
auch in vier Betriebsrestaurants von Beckhoff Automation GmbH & Co. KG, einem<br />
Hersteller von Automatisierungstechnik, für effektvolle Lichtakzente und eine<br />
angenehme Raumakustik.<br />
Für die Gestaltung der Gasträume der Betriebsgastronomie<br />
an den vier Beckhoff-Standorten zeichnet<br />
das Architekturbüro Kitzig Interior Design verantwortlich.<br />
Die Deckenkonstruktionen hat der Bauherr<br />
in Zusammenarbeit mit der Odenwald Faserplattenwerk<br />
GmbH (OWA), dem Innen<strong>architektur</strong>büro Kitzig<br />
sowie dem Architekturbüro Heitmann geplant und<br />
realisiert. Nach Auslotung verschiedener Varianten<br />
entschied man sich wegen der interessanten Gestaltungsmöglichkeiten<br />
für das System „Corpus“ aus der<br />
OWAconsult collection. Das modulare Baukastensystem<br />
aus zehn unterschiedlich dimensionierten, rechteckigen<br />
und quadratischen Akustikelementen mit feinen,<br />
weißen, vlieskaschierten Oberflächen wurde mit<br />
insgesamt neun Designpreisen ausgezeichnet.<br />
In einem komplexen Planungsprozess wurden die<br />
verschiedenen Corpus-Größen in Abhängigkeit des<br />
erforderlichen Sprinklerrasters, der gewünschten<br />
Beleuchtung sowie den Lüftungsauslässen abgestimmt.<br />
So war es mithilfe eines Vermessungsbüros<br />
möglich, die Sprinklerköpfe in die Corpus-Elemente<br />
zu integrieren. Aus akustischen Gründen, und um einen<br />
fließenden Übergang zwischen Decke und Wand<br />
zu schaffen, wurden die Corpus-Elemente auch als<br />
Wandabsorber angebracht. Neben dem Deckenkonzept<br />
mit Segeln hat der Bauherr auch ein modernes<br />
Lichtdesign in Auftrag gegeben. Der zur Unternehmensgruppe<br />
gehörende Elektrofachhandel Beckhoff<br />
Technik und Design hat das Lichtkonzept geplant<br />
und umgesetzt. Neben den ausgefallenen tropfenförmigen<br />
Lampen, erzeugen auch die dimmbaren Corpus<br />
LED-Leuchten, die kaum von den Akustikelementen<br />
zu unterscheiden sind, ein angenehmes Licht in<br />
der Betriebsgastronomie.<br />
Odenwald Faserplattenwerk GmbH<br />
T +49 (0)9373 201-0<br />
info@owa.de<br />
www.owa-ceilings.com
www.<strong>architektur</strong>-online.com<br />
91<br />
Produkt News<br />
Magnetisches Schließsystem<br />
für Ganzglastüren<br />
Die magnetische Schließung KEEP CLOSED für Ganzglastüren von SIMONSWERK<br />
ist in ihrer Ausführung und in ihren Eigenschaften eine wirkliche Alternative zu<br />
herkömmlichen Schließsystemen. Sie lässt einen filigranen, minimalistischen Einsatz<br />
von Glastüren im Innenraum zu – ohne störende Elemente wie Türdrücker und<br />
Schlosskasten. Damit wird ein reduziertes, minimalistisches Design der gesamten<br />
Tür ermöglicht – für harmonische, gradlinige und flächenbündige Raumkonzepte.<br />
Das neue Schließsystem besteht aus einem<br />
Schließmagneten, einer Magnetplatte sowie<br />
abgestimmten Griffvarianten und ist im<br />
geschlossenen Zustand kaum sichtbar. Der<br />
Schließmagnet KCM 50 in der Zarge arbeitet<br />
kontakt-, geräusch- und stromlos. Die<br />
Magnetplatte KCM 50/G wird ohne jegliche<br />
Glasbohrung an der Hauptschließkante fixiert,<br />
und nur eine schmale Ansichtskante<br />
der Platte ist sichtbar.<br />
Die Anzahl und die individuelle Einstellung<br />
der Schließmagnete bestimmen den<br />
Kraftaufwand zum Öffnen bzw. die Zugkraft<br />
beim Schließen. Alternativ können<br />
Schließmagnet und Magnetplatte auch im<br />
oberen, horizontalen Bereich der Tür montiert<br />
werden – dadurch entziehen sich die<br />
funktionalen Schließelemente fast komplett<br />
dem Blick des Betrachters. So können bei<br />
Bedarf bei überhohen Türen mehrere Magnete<br />
eingesetzt werden, die Haltekraft entsprechend<br />
individuell eingestellt und die<br />
Tür sicher in ihrer geschlossenen Position<br />
gehalten werden.<br />
Die Griffvarianten KCH 1700 und 1200 (neu)<br />
sind schlicht in ihrer Form, hochwertig in ihrer<br />
Ausführung und vielfältig in der Farbauswahl.<br />
Sie werden vertikal und dauerhaft auf<br />
die Tür aufgebracht. Die Fixierung erfolgt<br />
einfach und stabil mithilfe einer Positionierungsschablone:<br />
Bei Ganzglastüren mithilfe<br />
des bereits am Griff aufgebrachten Klebestreifens,<br />
sodass auch hier keine Glasbearbeitung<br />
erforderlich ist.<br />
Ergänzt wird das Angebot durch die neue<br />
innovative Lösung KC Lock System, die<br />
optimal für den Einsatz an Glastüren ausgerichtet<br />
ist. Die Schließung kann von einer<br />
Türseite aus erfolgen – und zwar ohne<br />
Schlossriegel, Falle, Drücker oder andere<br />
sichtbare Beschlagteile. Ein in der Griffinnenseite<br />
integriertes Rädchen löst den Verschlussmechanismus<br />
aus.<br />
KC Lock, bestehend aus dem Schließmagneten<br />
KCM 25 Lock, der Magnetplatte KCM<br />
25/G und dem optisch angepassten Griff<br />
KCH 1701 Lock funktioniert vollkommen<br />
stromlos. Der Schließzustand ist beidseitig<br />
erkennbar und bietet zudem die Möglichkeit<br />
einer Notentriegelung.<br />
SIMONSWERK GmbH<br />
T +49 (0)5242 413-0<br />
info@simonswerk.de<br />
www.simonswerk.com
<strong>architektur</strong> FACHMAGAZIN<br />
92<br />
Produkt News<br />
Minimale Höhe bei<br />
maximaler Dämmung<br />
Die Vorschriften zur Gebäudehöhe zentimetergenau einzuhalten und dennoch<br />
hochklassig zu dämmen ist oft eine große Herausforderung. Besonders bei<br />
Beschränkung von Gebäudehöhen ist der Spagat zwischen der Ausschöpfung<br />
möglicher Wohnflächen und der Einhaltung gesetzlicher Bestimmungen oft nicht<br />
leicht zu schaffen. Speziell für diese Herausforderungen stellt das Austrotherm<br />
Gefälledach Premium eine neue High-End-Lösung für die Wärmedämmung von<br />
Gefälledächern dar, das bei minimaler Aufbauhöhe ausgezeichnete Dämmwirkung<br />
gewährleistet.<br />
Der größte Anteil an Wärmeverlusten eines Gebäudes<br />
erfolgt über die Dachflächen. Deshalb ist gerade hier<br />
die bestmögliche Wärmedämmung besonders wichtig.<br />
Eine Komponente des Austrotherm Gefälledach<br />
Premium ist das Austrotherm Resolution® Flachdach<br />
mit seiner hervorragenden Wärmeleitfähigkeit von λD<br />
= 0,022 W/(mK). Kombiniert wird es mit dem grauen<br />
Austrotherm EPS® W30-PLUS, das eine hochdruckbelastbare<br />
oberste Dämmschicht mit Gefälle ausbildet.<br />
Durch den Einsatz der schlanken Austrotherm Resolution®<br />
erhält das Dach eine niedrigere Dämmstoffdicke<br />
und zugleich ein ausgezeichnetes Dämmniveau. Reduzierte<br />
Dämmstoffdicken wiederum bringen weitere<br />
Vorteile mit sich: Sie haben entscheidenden Einfluss<br />
auf die Höhe der Attika sowie auf Anschlüsse, Lichtkuppeln<br />
und Rohrdurchführungen. Eine geringe Aufbauhöhe<br />
führt daher gleich in mehrfacher Hinsicht zu<br />
Kostenersparnis.<br />
Eine Stoßüberdeckung bildet den Aufbau des Austrotherm<br />
Gefälledach Premium. Durch diese Art der Verlegung<br />
werden Wärmebrücken wirkungsvoll vermieden.<br />
Die Gefälleausbildung, entsprechend der jeweils<br />
gültigen Norm, sorgt für eine zuverlässige Entwässerung<br />
der Dachfläche. Ein weiterer Vorteil ist auch das<br />
geringe Gewicht des Dämmsystems, denn es ermöglicht<br />
eine einfache Verlegung. Dazu stellt Austrotherm<br />
einen detaillierten Verlegeplan bereit. So erfordert die<br />
Verarbeitung weniger Manpower – auch das spart<br />
Zeit, und damit Kosten.<br />
Austrotherm GmbH<br />
T +43 (0)2633 401-0<br />
info@austrotherm.at<br />
www.austrotherm.at
www.<strong>architektur</strong>-online.com<br />
93<br />
Produkt News<br />
© PREFA | Croce & Wir<br />
Spannungsfeld zwischen Alt und Neu<br />
Mit den Parkapartments Belvedere trägt der italienische Stararchitekt Renzo Piano,<br />
der das Centre Pompidou, das New York Times Building und Londons Wolkenkratzer<br />
„The Shard“ entworfen hat, nun auch erstmals zur Baugeschichte Wiens bei. Die<br />
Belvedere-Apartments stehen im Stadtentwicklungsgebiet – zwischen dem neuen<br />
Hauptbahnhof, dem Schloss Belvedere, den massiven Backsteinbauten des ehemaligen<br />
Militärgebäudes Arsenal und dem Erholungsgebiet Schweizergarten.<br />
Die ersten Ideen und Entwürfe des Architekten für die<br />
Belvedere-Apartments stammen aus dem Jahr 2008.<br />
„Unser Anspruch war nicht, ein Architekten-Feuerwerk<br />
zu entfachen. Wir wollten die Umgebung miteinbeziehen,<br />
viel Licht und interessante Ausblicke<br />
bieten, die innerstädtische Fläche gut ausnutzen<br />
und damit einen kleinen Baustein zur Baugeschichte<br />
der Stadt beitragen oder diese fortsetzen“, erläutert<br />
Thorsten Sahlmann, der seit 20 Jahren Architekt bei<br />
Renzo Piano Building Workshop ist und verantwortlich<br />
für die Umsetzung der Belvedere-Apartments war.<br />
In diesem Spannungsfeld zwischen Alt und Neu wollten<br />
Piano und sein Team keine „große Wand“ errichten,<br />
sondern „Durchblicke schaffen“. Und somit entstand<br />
dieser Aufbruch in Blöcke, die heute die fünf Wohnund<br />
Hoteltürme bilden. Die raumhohen Fenster und<br />
die ausgetüftelten Winkel ermöglichen den Bezug zur<br />
Stadt und die Einbindung des Schweizergartens. Die<br />
außergewöhnliche Säulenkonstruktion des Gebäudes<br />
integriert sich ebenso in den Standort, denn sie spiegelt<br />
als Säulenwald das Motiv der Baumstämme in der<br />
unmittelbaren Umgebung wider. Diese Säulen heben<br />
dabei die Gebäude weit über das Straßenniveau.<br />
Geprägt werden die Parkapartments Belvedere auch<br />
durch die spezielle Fassadengestaltung aus einer<br />
Kombination aus Glas, Keramikelementen und Prefa<br />
Aluminium. Die Keramik steht dabei für das Spannungsfeld<br />
zwischen Neu und Alt und die Profilwellen<br />
aus Aluminium geben den eleganten Touch und sind<br />
gleichermaßen ästhetisch und funktionell. Bei der<br />
Farbgebung der Fassade, die im Laufe des Tages je<br />
nach Sonnenlicht ihre Farbe wechselt, wurde auf Silbermetallic<br />
gesetzt, da Weiß als dominante Farbe von<br />
den Architekten in der Reflexion als zu stark eingeschätzt<br />
wurde. Um den wohnlichen Charakter des Objekts<br />
zu unterstreichen, verfügt jedes Gebäude über<br />
einen eigenen Glaspavillon „als Empfangsgeste“.<br />
PREFA Aluminiumprodukte GmbH<br />
T +43 2762 502 0<br />
office.at@prefa.com<br />
www.prefa.at
<strong>architektur</strong> FACHMAGAZIN<br />
94<br />
Produkt News<br />
Fotos: Schöck/Franz Pflügl<br />
Kilometerweise gut gedämmt<br />
Im rasant wachsenden Viertel rund um den neuen Wiener Hauptbahnhof entsteht mit<br />
BEL & MAIN Vienna derzeit ein in vielerlei Hinsicht ganz und gar außergewöhnliches<br />
Mixed-Use-Projekt. Das entstehende Gebäudeensemble ist das Ergebnis eines geladenen<br />
Architekturwettbewerbs und Gutachterverfahrens mit fünf Teilnehmern – die<br />
Bautafel liest sich wie das „Who is Who“ der heimischen Bauszene: Delugan Meissl Associated<br />
Architects (DMAA) und Coop Himmelb(l)au für die Architektur, Architektur<br />
Consult, die für die Detail- und Ausführungsplanung verantwortlich zeichnen, Leyrer +<br />
Graf für die Bauausführung und die SIGNA als Projektentwickler.<br />
Vier knapp 60 Meter hohe Gebäude mit bis zu 18 Stockwerken<br />
wachsen auf der Großbaustelle in den Himmel.<br />
Auf dem 12.000 Quadratmeter großen Areal entstehen<br />
bis Ende des Jahres rund 450 Wohnungen, ein Büroturm<br />
und ein Hotel sowie Einzelhandelsflächen in der<br />
Erdgeschosszone. Die Häuser werden überwiegend<br />
in Stahlbetonbauweise mit Ortbeton errichtet. „Über<br />
47.000 Kubikmeter Beton, ca. sieben Tonnen Bewehrung,<br />
über 100.000 Quadratmeter Wand- und rund<br />
95.000 Quadratmeter Deckenschalung werden dabei<br />
verbaut“, erklärt Franz Schierer, Polier beim ausführenden<br />
Bauunternehmen Leyrer + Graf.<br />
Wärmebrückenminimierte Konstruktion<br />
Nahezu jede der rund 450 Wohnungen verfügt über<br />
einen privaten Freibereich in Form einer Loggia oder<br />
eines Balkons. Für den wärmebrückenminimierten<br />
Verbund mit den Geschossdecken sorgen insgesamt<br />
fast drei Kilometer an verschiedenen Typen des<br />
Schöck Isokorb Modell T, mit dem Balkontiefen bis<br />
knapp unter drei Metern realisierbar sind. Mit einem<br />
Dämmstoffkern von 80 mm Stärke sichert der Isokorb<br />
die thermische Trennung von Balkon bzw. Loggia und<br />
Gebäude und schafft damit höchsten Wohnkomfort.<br />
Aufgrund der gebogenen Fassaden wurden Isokorb<br />
Typen mit einer Länge von einem Meter oder kürzer<br />
eingebaut. „So lassen sich große Rundungen einfach<br />
in mehrere gerade Segmente aufteilen – ohne sichtbare<br />
Kanten im Bereich der Fassade“, erklärt Jernej<br />
Standeker, Produktmanager bei Schöck.<br />
Im Straßentrakt wurden alle Isokorb Typen mit eingeschalt,<br />
mit der Deckenbewehrung verknüpft und<br />
in einem Zug mit den Zwischendecken vergossen. So<br />
wachsen die beiden straßenseitigen Türme im Zweiwochentakt<br />
um jeweils ein Geschoss in die Höhe. Die<br />
zurückspringenden und auskragenden Balkone des<br />
Hofsolitärs werden dahingegen im Fertigteilwerk der<br />
Franz Oberndorfer GmbH & Co KG inklusive den eingelegten<br />
Isokorb Typen vergossen und als fixfertige<br />
Bauelemente auf die Baustelle gebracht und per Kran<br />
in die einzelnen Geschosse versetzt.<br />
Schöck Bauteile<br />
Ges.m.b.H.<br />
T +43 (0)1 786 5760<br />
office@schoeck.at<br />
www.schoeck.at
www.<strong>architektur</strong>-online.com<br />
95<br />
Produkt News<br />
FÜR JEDE<br />
ANWENDUNG EINE<br />
SUPER WAHL.<br />
www.lafarge.at<br />
Natürlich und<br />
nachhaltig<br />
Durch eine Vielzahl an Maßnahmen optimierte der österreichische<br />
Ziegelhersteller Wienerberger seine CO 2 -Bilanz und kann<br />
nun Häuslbauern, Architekten und Verarbeitern den ersten,<br />
vom TÜV NORD Austria zertifizierten, klimapositiven Ziegel<br />
Österreichs anbieten: Den Porotherm 38 W.i EFH Plan, der perfekt<br />
für sämtliche Anforderungen beim Bau von Einfamilienhäusern<br />
geeignet ist. Damit hat Wienerberger in seiner kontinuierlichen<br />
Bestrebung zur Reduktion von Energieverbrauch und<br />
CO 2 -Emissionen neue Maßstäbe für die Baubranche gesetzt.<br />
Die werksseitig verfüllte Mineralwolle des klimapositiven Ziegels<br />
ist nicht brennbar, wasserabweisend, schädlingsresistent,<br />
dampfdurchlässig und schimmelt nicht – der Ziegel schafft somit<br />
ein rundum wohngesundes und natürliches Raumklima mit<br />
herausragenden Wärmedämmwerten und spart bis zu 25 % der<br />
Heizkosten. Die Lebensdauer von Ziegeln beträgt generell über<br />
100 Jahre. Daher leisten sie einen nachhaltigen Beitrag zum Klimawandel<br />
und haben einen positiven CO 2 -Fußabdruck.<br />
Wienerberger AG<br />
T +43 (0)1 60192-0<br />
office@wienerberger.com<br />
www.wienerberger.at<br />
© Wienerberger Österreich GmbH / Andreas Hafenscher<br />
JETZT Lafarge APP<br />
RICHTIG BETONIEREN<br />
auf Ihr Handy laden!<br />
Entscheidend für jeden Bau ist ein solides Fundament.<br />
Unsere Zemente sind regional und ökologisch. Und natürlich<br />
haben wir für jede Anwendung den richtigen Zement.<br />
Lafarge – Fundament<br />
der Zukunft.
<strong>architektur</strong> FACHMAGAZIN<br />
96<br />
Produkt News<br />
Fotos: Rieder Group, Ditz Fejer<br />
Nachhaltige Betonfassade mit Tiefgang<br />
Funktionalität vor Kreativität? Nicht bei der Gestaltung der Gebäudehülle für den neuen<br />
Komplex der Johan Skytteskolan Grundschule in Stockholm. Sowohl die architektonische<br />
Ambition, die künstlerische Gestaltungskraft als auch der hohe technische<br />
Anspruch, wie er bei einem Schulbau immer eine tragende Rolle spielt, werden bei<br />
dem modernen Gebäude in der schwedischen Hauptstadt befriedigt.<br />
Die Fassade mit concrete skin Glasfaserbeton-Elementen<br />
in Naturtönen, als kreative Stülpschalung<br />
ausgeführt, schafft es alle Anliegen auf unaufgeregte<br />
Art und Weise zu kombinieren. Die Architektin Anna<br />
Curtius und die Künstlerin Maria Friberg gaben der<br />
Fassade des neuen Gebäudes im Stockholmer Ortsteil<br />
Älvsjö eine besondere Ausdruckskraft. Neben der<br />
originellen Stülpschalung mit concrete skin Paneelen<br />
von Rieder schmückt außerdem ein riesengroßes<br />
Kunstwerk die Schulfassade.<br />
Mit der Fassade aus 13 mm dünnen Elemente aus<br />
Glasfaserbeton entspricht die Gebäudehülle den hohen<br />
Anforderungen in Sachen Brandschutz, Beständigkeit<br />
und niedrigem Wartungsaufwand für Schulen.<br />
Durch die erwiesene Ballwurfsicherheit sind die<br />
Paneele aus Glasfaserbeton auch für Fassaden an<br />
Sportplätzen und Pausenhöfen geeignet.<br />
Inspiriert durch die warmen, ruhigen Farbtöne aus<br />
dem mediterranen Raum, entstanden die Farbtöne<br />
der aktuellen pietra-Kollektion. Die sandigen Nuancen<br />
der Fassade der Grundschule in Stockholm wurden an<br />
die außergewöhnliche Optik von Natursteinen angelehnt<br />
und orientieren sich am ursprünglichen Charme<br />
der Natur.<br />
Erhältlich sind die Paneele in vielen Farben, Texturen<br />
und Oberflächenausprägungen. Zudem bieten die<br />
unterschiedlichsten Formate zahlreiche Möglichkeiten<br />
für den kreativen Umgang mit Farbe, Struktur<br />
und Form. Durch ihre Verformbarkeit lassen sich die<br />
Platten auch geschmeidig über Ecken und Kanten<br />
führen. Die Fassadenbekleidung concrete skin ist als<br />
vorgehängte hinterlüftete Fassade konzipiert und für<br />
nahezu jede Gebäudeart einsetzbar.<br />
Rieder Sales GmbH<br />
T +43 (0)6542 690-844<br />
office@rieder.cc<br />
www.rieder.cc
www.<strong>architektur</strong>-online.com<br />
Produkt News<br />
grenzen<br />
los<br />
planen.<br />
Individuelle Steine nach Ihren Ideen.<br />
5 x schneller für<br />
alle Dämmdicken<br />
2005 präsentierte Baumit erstmals den Baumit KlebeAnker<br />
als Alternative zur herkömmlichen Verdübelung von Dämmplatten<br />
an der Fassade. Seither hat er eine europaweite Erfolgsgeschichte<br />
hingelegt. Es gibt mittlerweile „Spezialisten“<br />
für jeden Einsatz, Baumit KlebeAnker X1 ist das jüngste Mitglied<br />
der Familie.<br />
Baumit KlebeAnker X1 verbindet die bewährten Baumit KlebeAnker<br />
Vorteile mit höchster Schnelligkeit und Effizienz im<br />
Arbeitsfortschritt sowie Kraftersparnis beim Setzen. Zeitaufwändiges<br />
und kräftezehrendes Bohren gehört - dank innovativer<br />
Setztechnik in Kooperation mit Hilti - der Vergangenheit<br />
an. Als Systembestandteil von Baumit open air Klimaschutz-<br />
Fassade oder Baumit WDVS ECO ist der Baumit KlebeAnker<br />
X1 die perfekte Ergänzung für den Neubau aus Beton.<br />
Bedingt durch die einfache Handhabung und Kraftersparnis<br />
ist die Verarbeitung bis zu 5 x schneller als konventionelle<br />
Verdübelung. Der U-Wert verbessert sich bei Verwendung des<br />
Baumit KlebeAnkers gegenüber einer konventionellen Verdübelung<br />
um bis zu 10 %. Das liegt daran, dass die Dämmplatten<br />
nicht durchbohrt, sondern verklebt und Wärmebrücken<br />
nachhaltig vermieden werden.<br />
Baumit GmbH<br />
T +43 (0)501 888-0<br />
www.baumit.com<br />
© Markus Kaiser, Graz<br />
PARTNER FÜR OBJEKTGESTALTER<br />
Mit dem umfassenden Standardsortiment und individuellen<br />
Sonderproduktionen bei Farben und Formaten eröffnen Friedl<br />
Steinwerke neue Möglichkeiten in der Gestaltung von Plätzen und<br />
Wegen. Wir stehen für Beratung und Bemusterung gerne bereit:<br />
anfrage@steinwerke.at<br />
www.steinwerke.at
<strong>architektur</strong> FACHMAGAZIN<br />
98<br />
Produkt News<br />
Fotos: Matthias Weissengruber<br />
Zeitlos schöne Holz-Oberflächen<br />
Der neu gebaute Bildungscampus Bütze in Wolfurt in Vorarlberg fasst Schule und Kindergarten<br />
zusammen und ist ein wegweisendes Vorzeigemodell – in Ästhetik, Funktionalität<br />
und Nachhaltigkeit. Der architektonisch ansprechende und moderne Holzbau<br />
besticht durch seine exklusive vorvergraute Außenhaut, erzeugt mit einer High-End-<br />
Lasur aus der DANSKE-Linie „Natürlich inspiriert“.<br />
Der Holzbau, ausgeführt mit sägerauer<br />
Nordischer Fichte, ist ein Skelettbau mit<br />
hinterlüfteter vorgehängter Holzfassade.<br />
Die im Schindel-Prinzip nach unten überlappenden<br />
Fassaden-Teile verhindern den<br />
Wassereintritt in die Fassade.<br />
Für die Planung und Gestaltung zuständig<br />
zeichnet das Architekten-Büro Andres<br />
Schenker, Michael Salvi und Thomas Weber,<br />
das gemeinsam mit dem ausführenden<br />
Holzbauer Dobler aus Röthis entschied, die<br />
außen liegenden Holzteile mit einer Holzlasur<br />
aus der Danske-Reihe zu beschichten.<br />
Das Produkt mit dem Namen Greywood<br />
sorgt für eine gleichmäßige Vorvergrauung<br />
des Holzes. Als Farbton wurde „Forrest 01“<br />
gewählt, ein warmer Grauton mit natürlicher<br />
Anmutung, der speziell für die Verwendung<br />
auf Fichtenholz abgestimmt ist.<br />
Danske Greywood bietet nicht nur gestalterisch<br />
viele Möglichkeiten. Die transparent<br />
pigmentierte, diffusionsoffene Mittelschichtlasur<br />
schützt gegen Licht- und<br />
Witterungseinflüsse und nimmt die natürliche<br />
Vergrauung des Holzes vorweg. Mit<br />
dem High-End-Produkt aus dem Hause<br />
Synthesa erfährt das Gebäude seine delikat-unaufdringliche<br />
Erscheinung, die sich<br />
wie selbstverständlich in die ländliche<br />
Umgebung des Rheintales einfügt. Der natürlich<br />
wirkende Farbton erweckt den Eindruck,<br />
als wäre die Fassade seit Jahren Bestand<br />
des Ortsbildes. Insgesamt wurden bei<br />
diesem Projekt 3000 m² Holz mit der Lasur<br />
aus Perg beschichtet.<br />
Synthesa Chemie Gesellschaft m. b. H.<br />
T +43 (0)7262 560-0<br />
office@synthesa.at<br />
www.synthesa.at
www.<strong>architektur</strong>-online.com<br />
Systemübergreifendes<br />
BIM-Plugin<br />
Ab sofort steht ein neues systemübergreifendes<br />
BIM-Plugin für Rigips, ISOVER und WEBER zum Download<br />
bereit. Über 3.000 bauphysikalische geprüfte Lösungen<br />
sind für die Planungssoftware ArchiCAD und<br />
Revit verfügbar. Planer und Architekten bekommen<br />
Zugriff auf noch benutzerfreundlichere Bauteillösungen<br />
für Dach, Fassade, Innenausbau, Keller und Bodenplatte.<br />
Mit dem neuen Assistenten können die gewünschten<br />
Lösungen mit einer intelligenten Suchfunktion noch<br />
rascher heruntergeladen und direkt im grafischen Gebäudeplan<br />
verwendet werden. Zusätzlich praktisch ist,<br />
dass danach unverzüglich alle Informationen zu Materialien,<br />
Qualitäten, Flächen, bauphysikalischen Leistungswerten<br />
(Schall, Brand, U-Wert) etc. bereitstehen.<br />
Zudem kann auch auf weitere Informationen wie<br />
Ausschreibungstexte, Produktdetails etc. zugegriffen<br />
werden. Die Update-Funktion des neuen BIM-Plugin<br />
bietet einen zusätzlichen Service: Sie verhindert, dass<br />
Planer und Architekten mit veralteten Daten arbeiten.<br />
99<br />
Bei Änderungen der geprüften Systemlösungen werden<br />
die Nutzer über das integrierte Kommunikationscenter<br />
informiert. Eine automatische Aktualisierung in<br />
bestehende Pläne erfolgt selbstverständlich nicht.<br />
Mit der App „BIMx“ (auch erhältlich im Google Playstore)<br />
lädt Saint-Gobain zu einem virtuellen Rundgang<br />
durch ein BIM-Haus ein! Download auch unter:<br />
https://bim-plugin.saint-gobain-services.de<br />
Produkt News<br />
Andreas Jäger<br />
Klimaexperte<br />
Klimaschutz<br />
made in Austria.<br />
Schützt viele<br />
Generationen.<br />
Dass sich ein traditionelles<br />
Familienunternehmen für die Zukunft<br />
interessiert, liegt in der Natur der<br />
Sache: Wie es den Kindern unserer<br />
Kinder einmal gehen wird, liegt uns<br />
eben am Herzen. Deshalb sorgen wir<br />
mit unseren innovativen Dämmstoffen<br />
schon heute für ein gutes Klima – und<br />
auch morgen.<br />
austrotherm.com<br />
Gutes Klima. Gutes Leben.
<strong>architektur</strong> FACHMAGAZIN<br />
100<br />
Produkt News<br />
Mit BIM und digitalem Zwilling<br />
geplant und umgesetzt<br />
Als Weltmarktführer bei Schiebedach-Kinematiken und elektromechanischen Türschlossern<br />
betreibt die Firma Pollmann mehrerer Produktionswerke. Das „Jüngste“<br />
steht in Vitis und wurde softwareunterstützt aus der Taufe gehoben.<br />
Das 1888 von Franz Pollmann als Handwerksbetrieb<br />
für feinmechanische Geräte und<br />
Uhren gegründete Traditionsunternehmen<br />
ist heute weltweit aktiv. Der Kernkompetenzbereich<br />
des Waldviertler Unternehmens<br />
mit Hauptsitz in Karlstein und Produktionsstandorten<br />
in Österreich, in Tschechien,<br />
in China und in den USA liegt heute bei<br />
hochkomplexen Mechatronik-Bauteilen für<br />
die Automobilindustrie. Basierend auf dem<br />
Wachstum des mittlerweile in vierter Generation<br />
geführten Familienunternehmens<br />
entstand in den Jahren 2018/2019 in rund 25<br />
Kilometer Entfernung vom Headquarter in<br />
Karlstein in Vitis ein zusätzliches Werk, für<br />
dessen Planung die Auftraggeber besondere<br />
Anforderungen stellten: „Mit Pollmann<br />
2.0 gehen wir schnurstracks in Richtung Industrie<br />
4.0. Deshalb forderten wir von den<br />
ausführenden Firmen ein Setup, das dem<br />
neuesten Stand der Technik entspricht. Eine<br />
maximal effiziente innere Logistik und eine<br />
modulartige Erweiterbarkeit des Gebäudes<br />
waren dabei Grundbedingung“, beschreibt<br />
Robert Pollmann die hohen Ansprüche der<br />
Eigentümer-Familie bei diesem Grüne-Wiese-Projekt.<br />
Unter der Federführung von<br />
Peneder, STIWA und Beckhoff entstand<br />
deshalb bereits während der Planungspha-<br />
se ein digitales Gebäudemodell, das mit den<br />
wichtigsten zu erwartenden realen Kennzahlen<br />
gefüttert wurde. Dadurch gab es das<br />
Endergebnis bereits beim Spatenstich „live“<br />
zu erkunden: Ein Blick durch eine 3D-Brille<br />
machte das BIM-Geplante begreifbar und<br />
gestattete den Bauherren einen realen Ausblick<br />
auf die Zukunft.<br />
Effizientes Zusammenspiel<br />
der Projektbeteiligten<br />
„Da Pollmann mit diesem Werk laut eigenen<br />
Angaben schnurstracks in Richtung Industrie<br />
4.0 marschieren wollte, zeigten sich<br />
unsere Auftraggeber extrem offen für BIM –<br />
eine virtuelle Planungsmethode, bei der die<br />
jeweiligen Teilmodelle der unterschiedlichen<br />
Fachdisziplinen, z. B. Architektur, Logistik,<br />
Haus- und Elektrotechnik, Automation und<br />
Facility Management, in einem zentralen<br />
digitalen 3D-Modell zusammengeführt werden“,<br />
beschreibt DI Harald Setka, Architekt<br />
bei der Peneder Bau-Elemente GmbH den<br />
Planungsansatz der neuen Fertigungsstätte<br />
des Waldviertler Automobilzulieferers.<br />
Und auch DI Thomas Führer, MSc, Leiter<br />
des Geschäftsbereichs Gebäudeautomation<br />
bei der STIWA Holding GmbH, weiß aus Erfahrung<br />
um die Vorteile einer umfassenden<br />
digital unterstützten Planung: „Als Maschinenbauer<br />
und Softwareunternehmen sind<br />
wir es gewohnt, das Produktionsumfeld zu<br />
optimieren. Dabei stellten wir fest, dass die<br />
vorherrschenden Umgebungsbedingungen<br />
einen starken Einfluss auf die Gesamtanlageneffektivität<br />
haben: Wie viel Platz steht<br />
rund um die Maschine zur Verfügung? Welche<br />
klimatischen Bedingungen herrschen in<br />
einer Produktionshalle vor? Wie ist es um<br />
den internen Materialfluss und die Wege<br />
der Mitarbeiter bestellt? Alle diese Dinge<br />
gilt es demnach bei der Planung eines – wie<br />
wir es nennen – Smart Industrial Buildings<br />
genauso zu beachten wie die benötigten<br />
Energieflüsse“. Gemeinsam mit seinem<br />
Kooperationspartner, der Firma Peneder,<br />
wurden in Planungsworkshops die wahren<br />
Erfordernisse der Auftraggeber – sprich die<br />
aktuellen und zukünftigen Anforderungen<br />
der Produktion und Betriebsabläufe an das<br />
Gebäude – eruiert. Diese Phase, in der alles,<br />
von der äußeren architektonischen Hülle bis<br />
zum darin enthaltenen automatisierungstechnischen<br />
Kern, softwareunterstützt geplant<br />
wird, sei laut Führer bei einem guten<br />
Teamplay, wie es bei Pollmann der Fall war,<br />
sogar in acht Wochen zu schaffen.
www.<strong>architektur</strong>-online.com<br />
101<br />
Produkt News<br />
Als Ausgangspunkt standen insgesamt<br />
65.000 m² Grundfläche für das neue Werk<br />
zur Verfügung. Ein weiterer Fixpunkt war der<br />
Fertigstellungstermin. Nachdem Pollmann<br />
nur dann expandiert, wenn ein konkreter<br />
Kundenauftrag dahintersteckt, schwebte<br />
von Anfang an eine besonders sportliche<br />
Vorgabe im Raum: Das Werk musste maximal<br />
zehn Monate nach dem ersten Spatenstich<br />
in den Vollbetrieb gehen und auch<br />
für die Zukunft gerüstet sein. Im Moment<br />
werden 9.400 m² für die Produktion, für<br />
ein Hochregallager mit derzeit 5.500 Paletten-Stellplätzen,<br />
für Büros, Technik- und Sozialräume<br />
genutzt. Der in der Planungsphase<br />
erarbeitete Masterplan wurde allerdings<br />
so ausgelegt, dass sich dieses Werk sehr<br />
schnell und einfach auf insgesamt bis zu<br />
fünf Hallen ausdehnen lässt. Da alle Versorgungsleitungen<br />
sowie Personen- und Warenströme<br />
in einer zentralen Logistikachse<br />
zusammenlaufen, reicht es, diese Magistrale<br />
im Bedarfsfall entsprechend zu verlängern,<br />
um die nächste Ausbaustufe einzuleiten.<br />
Digitaler Zwilling<br />
Die Smart-Industrial-Building-Spezialisten<br />
erzeugten für das Projekt in Vitis aber nicht<br />
nur ein dreidimensionales Modell des neuen<br />
Gebäudes, sondern darüber hinaus auch<br />
noch einen digitalen Zwilling, über den sich<br />
Proportionen, Materialien, Licht, Formen<br />
und Farben genauso wie die zu erwartenden<br />
Produktions- und Betriebsabläufe auf<br />
ihre Stimmigkeit austesten ließen. Denn<br />
virtuell geplant, ist bei der Ausführung<br />
und beim Betrieb eines Gebäudes viel gewonnen,<br />
wie auch Christian Pillwein von<br />
Beckhoff bestätigt. „Viele Bauherren wissen<br />
nicht, was mit dem Einsatz moderner<br />
Technologien heutzutage in einem ‚Smart<br />
Industrial Building‘ schon alles möglich ist.<br />
Dass es beispielsweise eine erhebliche Reduktion<br />
der Energiekosten mit sich bringt,<br />
wenn auf einen geschlossenen Regelkreis<br />
zwischen Produktion, Logistik und Gebäudetechnik<br />
gesetzt wird“, erläutert der Leiter<br />
der Gebäude- und Infrastrukturautomations-Sparte<br />
bei Beckhoff Automation.<br />
Dementsprechend wurde beim neuen Werk<br />
von Pollmann eine intelligente Verknüpfung<br />
der Fertigung mit der Gebäude- und Energieversorgung<br />
realisiert. Diese stellt zum<br />
Beispiel sicher, dass lediglich jene Luftmenge<br />
in die Halle eingeblasen wird, die<br />
aufgrund der momentan aktiven Maschinen<br />
tatsächlich notwendig ist. Selbst vorbildlich<br />
agierende Betriebe weisen nämlich, durch<br />
Maschinenumrüstungen oder Servicearbeiten,<br />
bei ihren Produktionsanlagen eine<br />
Gesamtanlageneffizienz von maximal 75 %<br />
auf. Und diese Differenz von 25 %, die nicht<br />
die volle Leistung benötigt, birgt enormes<br />
Energiesparpotenzial, die sich mit einer bedarfsorientierten<br />
Regelung der Gebäudeautomation<br />
sehr gut heben lässt. Eine derartige<br />
Lösung amortisiert sich nach Meinung<br />
der Experten zusätzlich auch sehr schnell,<br />
da sämtliche Feinjustierungen und Anpassungen<br />
über die Software erfolgen können.<br />
Hardware-seitig läuft das gesamte Regelungsgeschehen<br />
bei Pollmann über Beckhoff-Komponenten:<br />
Als Leitstand-Server<br />
ist ein Schaltschrank PC der Reihe C6900<br />
im Einsatz und die HKL-Zentrale, die Lüftung<br />
sowie die Raumautomation werden<br />
über fünf hutschienenmontierbare Embedded-PCs<br />
der Serie CX5000 gesteuert.<br />
Nachhaltiges Energiekonzept<br />
Für einen nachhaltigen Umgang mit Energie<br />
wird in Vitis durch unterschiedlichste<br />
Maßnahmen gesorgt: Durch die konsequente<br />
Nord-Süd-Ausrichtung des Gebäudes<br />
werden die solaren Einträge und damit<br />
der Energiebedarf zum Kühlen gering gehalten.<br />
Die Abwärme der Spritzgussanlagen<br />
wird am gesamten Standort zur Raumtemperierung<br />
genutzt, wobei die Abwärme aus<br />
der Antriebskühlung direkt und jene der<br />
Werkzeugkühlung indirekt über Kältemaschinen<br />
zu einem geringeren Verbrauch<br />
beiträgt. Aus den Kältemaschinen selbst<br />
wird ebenfalls Wärme rückgewonnen – genauso<br />
wie aus den Kompressoren. Und last<br />
but not least gewährleisten ausgeklügelte<br />
Regelungsalgorithmen eine effiziente, bedarfsgerechte<br />
Lüftung des gesamten Gebäudekomplexes.<br />
Beckhoff Automation GmbH<br />
T +43 (0)5552 68813-0<br />
info@beckhoff.at<br />
www.beckhoff.at
<strong>architektur</strong> FACHMAGAZIN<br />
102<br />
edv<br />
Gebäudeautomation:<br />
Home, Smart Home<br />
Das smarte Haus verspricht mehr Komfort, Sicherheit und weniger Energieverbrauch.<br />
Bei der Beratung, Planung, Systemauswahl und Montage<br />
sollte man aber einiges beachten.<br />
Text: Marian Behaneck<br />
Haus mit IQ: Smarte Haustüren, Tore, Fenster oder Rollläden steigern den Komfort und<br />
die Sicherheit für die Bewohner. © Somfy<br />
Viele Gründe sprechen für Smart Home –<br />
die Automation und Vernetzung der Haus-,<br />
Geräte- und Unterhaltungstechnik: Die<br />
gestiegenen Sicherheitsbedürfnisse, die<br />
zunehmende Alterung der Gesellschaft<br />
und die Notwendigkeit, Energie einzusparen<br />
– für all das verspricht die intelligente<br />
Gebäudesteuerung passende Lösungen:<br />
Smarte Schließsysteme von Haustüren, Toren<br />
oder Fenstern steigern die Sicherheit<br />
der Bewohner. Rollladensteuerungen nehmen<br />
älteren oder behinderten Bewohnern<br />
das anstrengende Öffnen und Schließen<br />
ab. Sensorgesteuerte Fensterlüftungen<br />
und Rollläden unterstützen das Heizenergie-Sparen.<br />
Wie funktioniert Smart Home?<br />
Um Bauherren individuell beraten und das<br />
passende System auswählen zu können,<br />
sollte man einige „Basics“ kennen: Smart<br />
Home basiert auf einem vernetzten Zusammenspiel<br />
aus Sensoren, Aktoren, einem Datenübertragungssystem<br />
und einer zentralen<br />
Steuerung. Sensoren (Temperaturfühler,<br />
Bewegungsmelder etc.) geben per Datenleitung<br />
oder Funk digitale Signale direkt oder<br />
über eine Steuerzentrale an Aktoren (Antriebe,<br />
Schalter etc.) weiter. Daraufhin wird die<br />
programmierte Aktion (Lampe dimmen, Heizung<br />
drosseln, Sonnenschutz herunterfahren)<br />
ausgeführt. Die Aktionen können zeit-,<br />
temperatur-, wind-, regen-, anwesenheits-,<br />
App- oder sprachgesteuert erfolgen. Sensoren<br />
und Aktoren können neu programmiert<br />
oder zugeordnet werden, sodass die Gebäudesteuerung<br />
flexibel an neue Anforderungen<br />
angepasst werden kann. Schnittstellen (sogenannte<br />
Gateways) sorgen über entsprechende<br />
Protokolle dafür, dass die einzelnen<br />
Ebenen und Geräte eines Smart-Home-Systems<br />
miteinander kommunizieren können,<br />
auch wenn sie von unterschiedlichen Herstellern<br />
stammen. Die Übertragung dieser<br />
Informationen und Daten erfolgt per Kabel,<br />
Funk, das Stromnetz oder kombiniert über<br />
entsprechende Bussysteme. Aktuell erhältliche<br />
Hausautomationssysteme lassen sich<br />
in offene und geschlossene Systeme unterteilen.<br />
Offene Systeme bieten eine große<br />
Geräteauswahl, ermöglichen Kombinationen<br />
unterschiedlicher Produkte und sind damit<br />
weniger von einem Hersteller abhängig. Allerdings<br />
können Inkompatibilitäten auftreten.<br />
Nutzer geschlossener Systeme können<br />
zwar zwischen perfekt aufeinander abgestimmten<br />
Geräten wählen, allerdings nur<br />
eines Herstellers. Bei Störungen müssen sie<br />
sich dafür nicht mit mehreren Ansprechpartnern<br />
auseinandersetzen.<br />
Kabel oder Funk?<br />
Kabelgebundene Bussysteme übertragen<br />
Signale über spezielle Bus-Kabel, die in der<br />
Regel unter Putz verlegt werden und deshalb<br />
Schlitz- und Stemmarbeiten voraussetzen.<br />
Das ist bei Neubauten in der Ausbauphase<br />
kein Problem, bei Altbauten nur dann,<br />
wenn sie grundsaniert und ohnehin in den<br />
Rohbauzustand versetzt werden. Zu den<br />
genormten, herstellerunabhängigen kabelgebundenen<br />
Bussystemen (Binary Unit System)<br />
gehören der KNX-, LON- oder der BACnet-Standard.<br />
Kabelgebundene Bussysteme
www.<strong>architektur</strong>-online.com<br />
103<br />
edv<br />
Auf dem Markt erhältliche Lösungen können viele Haustechnik-Elemente miteinander vernetzen und damit deren Zusammenspiel optimieren.<br />
© Somfy<br />
sollten bereits in einer früheren Projektphase<br />
geplant werden, da die Größe der Steigzone,<br />
des Wohnungs- bzw. Geschossverteilers,<br />
die Dimensionen der Leerrohre, die<br />
Anzahl und Art der Anschlusspunkte und<br />
die Anzahl und Typen der Kommunikationskabel<br />
bestimmt werden müssen. Die Kunst<br />
besteht darin, alles vorausschauend so festzulegen<br />
und möglichst geschickt im Haus zu<br />
verteilten, dass eine flexible Nutzung über<br />
viele Jahre möglich ist. Funksysteme sind<br />
einfacher installierbar, preiswerter, flexibler<br />
und in der Altbaumodernisierung optimal,<br />
weil Schlitz- und Stemmarbeiten entfallen.<br />
Zu den wichtigsten Funk-Standards zählen<br />
Bluetooth, EnOcean, WLAN, ZigBee oder<br />
Z-Wave, die sich vor allem in der Reichweite<br />
(ca. 10 bis 100 Meter) unterscheiden. Auch<br />
auf das aktuelle Marktangebot an passenden<br />
Systemkomponenten und Geräten, auf<br />
die Möglichkeit, bestehende Deckenlampen<br />
etc. einzubinden und die Kosten sollte man<br />
achten. Nachteilig nahezu bei allen Funksystemen<br />
ist, dass irgendwann die Batterien<br />
gewechselt werden müssen. Lediglich batterielose<br />
Systeme des Herstellers EnOcean<br />
sind praktisch wartungsfrei. Eine weitere<br />
Nachrüst-Alternative ist die Powerline- oder<br />
Powernet-Technik, die zur Signalübertragung<br />
das vorhandene Stromnetz nutzt. Allerdings<br />
sind die dafür notwendigen Bauteile<br />
und Komponenten teuer und das Stromnetz<br />
sollte nicht zu alt und marode sein. Darüber<br />
hinaus kann es von Außen durch Dimmer,<br />
Mehrfachsteckdosen, Elektrogeräte etc. zu<br />
Störeinflüssen kommen. Wichtige Powerline-Standards<br />
sind DigitalStrom oder LCN.<br />
Lokal oder global?<br />
Je nachdem, wie Steuerungs- und Sensordaten<br />
verarbeitet und gespeichert werden,<br />
unterscheidet man zwischen lokalen und<br />
cloudbasierten Smart-Home-Systemen. Weil<br />
letztere die Daten zunächst online an einen<br />
externen Server senden, dort verarbeiten<br />
und zurück an den lokalen Aktor senden, haben<br />
sie eine Sicherheitsschwachstelle. Was<br />
dabei nämlich mit den Daten passiert, ent-
<strong>architektur</strong> FACHMAGAZIN<br />
104<br />
edv<br />
Auch die Steuerung smarter Bauteile lässt sich individuell konfigurieren.<br />
© GEZE<br />
Das komplexe Zusammenspiel aller Bauteile, etwa einer smarten Haustür,<br />
setzt Know-how bei der Planung und Montage voraus. © GEZE<br />
zieht sich jeder Kontrolle. Schlimmstenfalls<br />
können das Nutzerverhalten der Bewohner<br />
ausgespäht und für Manipulationen genutzt<br />
werden. Funktioniert das cloudbasierte<br />
Smart-Home-System nur mit Internetverbindung,<br />
können zudem eigene Verbindungsprobleme<br />
oder technische Störungen beim<br />
Internetprovider Smart-Home-Funktionen<br />
beeinträchtigen oder ganz lahmlegen. Deshalb<br />
sollte eine App-Steuerung oder die<br />
Ausführung programmierter Funktionen<br />
auch offline möglich sein. Prinzipiell sicherer<br />
in Bezug auf die Daten- und Ausfallsicherheit<br />
sind lokale Insel-Systeme, bei denen die<br />
Sensordaten ausschließlich im hauseigenen<br />
Server oder Steuergerät gespeichert und<br />
verarbeitet werden. Das ist zwar mit einigen<br />
Funktions- und Komforteinbußen verbunden<br />
(kein Fernzugriff, keine Push-Nachrichten,<br />
kein Sprachassistent). Dafür sind lokale Systeme<br />
sicher vor Hackerangriffen und funktionieren<br />
in vollem Umfang auch offline.<br />
Kosten und Nutzen<br />
Die Mehrkosten gegenüber konventioneller<br />
Installation sind abhängig von der verwendeten<br />
Technik und den Ansprüchen.<br />
Bussysteme kosten etwa 30 Prozent mehr,<br />
je nach eingesetzter Technik und Ausbaustufe.<br />
Einstiegsangebote auf Basis von<br />
Funkstandards beginnen bei mehreren hundert<br />
Euro, wobei es sinnvoll ist, zunächst<br />
eine Grundausstattung auf Basis eines offenen<br />
Systems zu wählen, die bei Bedarf erweitert<br />
werden kann. Eine Vollverkabelung<br />
eines durchschnittlichen Mehrfamilienhauses<br />
mit Licht-, Heizungs- und Verschattungssteuerung<br />
kostet ab etwa 5.000 Euro<br />
pro Wohneinheit. Bei der Konzeption und<br />
Auswahl von Technik und Produkten sollte<br />
man neben den technischen Möglichkeiten<br />
und den Mehrkosten für smarte Endgeräte<br />
auch auf die Praxistauglichkeit, Unempfindlichkeit<br />
der Anlage gegenüber Störsignalen,<br />
die Wartungshäufigkeit und vor allem die Sicherheit<br />
(s.o.) achten. Bedenken sollte man<br />
bei Kosten-Nutzenrechnungen auch, dass<br />
Smart Home zwar das Energiesparen unterstützt,<br />
selbst aber auch Strom kostet. Jedes<br />
funkgesteuerte Systembauteil (Steckdose,<br />
Lampe, Heizkörperventil etc.), jedes smarte<br />
Gerät im Standby-Modus braucht eine<br />
Batterie oder bedient sich aus dem Netz,<br />
was den Energieeinspar-Effekt mindert. Aktuellen<br />
Studien zufolge wird der Trend zur<br />
Heimautomatisierung insgesamt sogar für<br />
einen Anstieg des Stromverbrauchs sorgen.<br />
Danach wird sich der Verbrauch von Energie<br />
und Ressourcen mit der zunehmenden<br />
Verbreitung vernetzter Geräte im Haushalt<br />
deutlich erhöhen – nicht nur aufgrund der<br />
Geräte-Herstellungsprozesse, sondern auch<br />
durch deren laufenden Betrieb.<br />
Beispiel: Smarte Fenster<br />
Zahlreiche smarte Lösungen gibt es bereits<br />
im Bereich Fenster und Fassade: So vernetzt<br />
beispielsweise die Systemplattform<br />
Building Skin Control (BSC) von Schüco<br />
Gebäude-Fassadenelemente miteinander<br />
und ermöglicht durch offene Schnittstellen<br />
eine Anbindung an standardisierte Gebäudeleitsysteme<br />
wie KNX oder BACnet. Darüber<br />
hinaus kann BSC an die Schüco Cloud<br />
angebunden werden. So kann der Fenster-/<br />
Fassadenbauer per Fernzugriff den Status<br />
von Wartungsintervallen oder Ereignissen<br />
abrufen und auf Kundenanfragen reagieren.<br />
Per Fernzugriff oder App lassen sich Einstellungen<br />
und Konfigurationen elementübergreifend<br />
und individuell vornehmen –<br />
etwa eine automatische Raumlüftung oder<br />
Nachtauskühlung. Eine sprachgesteuerte<br />
Smarte Fenster als persönliche Assistenten,<br />
mit denen die Bewohner interagieren können.<br />
© Oknoplast
www.<strong>architektur</strong>-online.com<br />
105<br />
edv<br />
Bedienung der Elemente verspricht mehr<br />
Komfort. In eine andere Richtung zielt das<br />
Smart Window von Drutex ab. Die Studie für<br />
ein interaktives Fenster soll eine Präsentation<br />
von Multimediainhalten und neue funktionelle<br />
Gebrauchsmöglichkeiten des Fensters<br />
ermöglichen: Fernsehen, Filme streamen,<br />
im Internet surfen, E-Mails checken. Smart<br />
Window besteht aus einem interaktiven<br />
Fenster sowie einer Steuereinheit, die über<br />
Benutzerschnittstellen für die Kontrolle und<br />
Interaktion mit dem Nutzer verantwortlich<br />
ist. Das Fenster ist mit einem energieeffizienten<br />
Prozessor ausgestattet und besitzt<br />
ebenfalls Schnittstellen zur drahtlosen Kommunikation<br />
(WIFI, Bluetooth, Bluetooth Low<br />
Energy). An das Fenster kann ein USB-Stick<br />
oder eine externe Festplatte mit Multimediadateien,<br />
eine Tastatur und Maus angeschlossen<br />
werden. Mitbewerber Oknoplast offeriert<br />
ein ähnliches Konzept. Über das im Fenster<br />
integrierte Touch-Panel kann man im Internet<br />
surfen oder in Full-HD-Qualität einen<br />
Film anschauen. Das Smart Window soll ein<br />
Tablet oder Notebook ersetzen können und<br />
auch als Sonnenschutz dienen. Schaltet man<br />
die Smart Window-Funktion ab, funktioniert<br />
es wie ein normales Fenster. Das Fenster<br />
der Zukunft wird kein isoliertes Bauteil mehr<br />
sein, sondern Teil einer vernetzten Gebäudehülle,<br />
die flexibel auf Wetter- und Umweltbedingungen<br />
reagiert und mit der Umgebung<br />
interagiert. Zu den bisherigen Funktionen<br />
Belichtung und Belüftung, Wärme- und<br />
Schalldämmung sowie Einbruchschutz kommen<br />
smarte Funktionen hinzu: Lüftung, Beleuchtung,<br />
Sichtschutz, Verschattung und<br />
Kühlung, aber auch Information und Entertainment.<br />
Was sich davon am Markt durchsetzen<br />
wird, bleibt allerdings abzuwarten.<br />
Chancen und Herausforderungen<br />
Es muss nicht immer gleich Smart Home<br />
sein. Häufig reicht auch schon ein Zeitschalter,<br />
ein Temperatur-, Regen- oder Windsensor.<br />
Sollen aber möglichst viele Haustechnik-Komponenten<br />
miteinander vernetzt<br />
werden, sind Gebäudeautomationssysteme<br />
gefordert. Die smarte Technik muss aber<br />
störunempfindlich und manipulationssicher<br />
sein sowie aktuelle Sicherheitsstandards<br />
erfüllen. Experten warnen immer<br />
wieder vor Risiken, die von unzureichend<br />
verschlüsselten, veralteten Funkprotokollen<br />
ausgehen und teilweise noch immer in<br />
neue Systeme verbaut werden. Problematisch<br />
ist auch die in jedem smarten Gerät<br />
integrierte Betriebssoftware (Firmware),<br />
die selten oder überhaupt nicht aktualisiert<br />
wird und dadurch zunehmend anfälliger für<br />
Schadsoftware und Hackerangriffe wird.<br />
Zudem lassen sich mechanische oder elektronische<br />
Manipulationen beispielsweise bei<br />
Das sollten Planer beachten<br />
- Kabelgebundene Bussysteme bevorzugen, da sie störunempfindlich, einfacher und<br />
kostengünstiger im Betrieb sind.<br />
- Bei funkbasierenden Systemen auf Reichweite, Störsicherheit und Wartungszyklen<br />
(Batterieverbrauch) achten.<br />
- Da Aktoren viel Energie benötigen, müssen unmittelbar an smarten Bauelementen<br />
stets Elektroanschlüsse vorhanden sein.<br />
- Eine 24-V-Spannungsversorgung ermöglicht eine einfache Montage auch ohne Elektrofachkraft<br />
und minimiert Leitungsquerschnitte.<br />
- Elektronische Bauteile stets so einbauen, dass sie vor Feuchtigkeit, extremer Temperatur<br />
oder mechanischer Belastung geschützt sind.<br />
- Anlagensicherheit beachten: verschlüsselte Funkprotokolle, aktuelle Sicherheitsstandards,<br />
sichere Webzugänge und ‐übertragungen etc.<br />
- Frühzeitig mit dem Elektrofachplaner, Hersteller und Handwerker Details wie Leitungsführung,<br />
Übergabepunkte etc. abstimmen.<br />
- Mit anderen Gewerken zusammenarbeiten, um Licht, Heizung, Kühlung und Lüftung<br />
in das Smart-Home-Konzept einzubinden.<br />
Weitere Infos/Quellen<br />
www.baunetzwissen.de<br />
www.gebaeudedigital.de<br />
www.intelligenteswohnen.com<br />
www.smarthomes.de<br />
www.wikipedia.at<br />
Keyless-Haustürsystemen nicht ausschließen,<br />
was zum Teil auch an unzureichenden<br />
Sicherheitsstandards liegt. Dennoch sollten<br />
Planer die Chancen des wachsenden Smart<br />
Home-Markts erkennen und nutzen. Die<br />
Themen Komfort und Sicherheit werden<br />
aufgrund des demografischen Wandels und<br />
des zunehmenden Sicherheitsbedürfnisses<br />
vor allem älterer Bevölkerungskreise immer<br />
wichtiger. Komfort und Sicherheit steigern<br />
zudem den Marktwert von Immobilien.<br />
Allerdings sollte man bei der Auswahl bewährte,<br />
einfach zu installierende und bedienbare<br />
Systeme von namhaften Anbietern<br />
favorisieren und wichtige Grundregeln bei<br />
der Planung und Realisierung beachten<br />
(siehe Infokasten).<br />
Rubrik „Elektro“<br />
B2B Gebäudetechnik-Magazin<br />
Initiative Intelligentes Wohnen<br />
B2C Gebäudetechnik-Magazin<br />
Suche: „Raum-/Gebäudeautomation“ etc.
www.<strong>architektur</strong>-online.com<br />
106<br />
edv<br />
Sanierung unter BIM-Einsatz<br />
BIM im Bestand ist noch immer die Ausnahme. Dabei kann die Methode hier ebenso<br />
sinnvoll sein, wie bei einem Neubau. hks I architekten zeigen mit dem Erfurter<br />
Heizwerk, dass sich BIM und denkmalschutzgerechte Sanierung keineswegs ausschließen.<br />
Im Gegenteil: Mit einer stringenten, digitalen Durchgängigkeit im Planungsprozess<br />
ist der Nutzen für alle bereits im Entwurf gegeben.<br />
Das Digitalaufmaß des Erfurter Heizwerks entstand als<br />
3D-Punktwolke. Sie ist Basis für die BIM-Planung in Archicad.<br />
In diesem Fall modellierten hks den Bestand komplett<br />
nach – ein großer Aufwand, aber wichtig in diesem Projekt.<br />
Auf den Abbildungen zu sehen ist die Überlagerung<br />
von neuer Planung und Punktwolke des Bestandes.<br />
©hks I architekten<br />
Seit Mitte der 1990er Jahre entsteht im<br />
Brühl ein neuer Erfurter Stadtteil, der neben<br />
Neubauten für Wohnen, Büro und Gewerbe<br />
mit der „Zentralheize“ ein eigenes kulturelles<br />
Zentrum erhalten wird. Die geschäftsführenden<br />
Partner von hks|architekten gehören<br />
zur Bauherrengemeinschaft; bis Ende<br />
<strong>2020</strong> soll das Projekt abgeschlossen sein.<br />
Die projektleitenden Architekten setzen<br />
dabei auf Software- und plattformübergreifendes<br />
Open BIM und 3D-Modellierung –<br />
schon ab dem Digitalaufmaß, das die Basis<br />
für ihr 3D-Modell ist. In der Planung arbeiten<br />
die Architekten mit Archicad. Die BIM-Planungssoftware<br />
ist Grundlage für die Koordinierung<br />
aller eingebundenen Fachplaner<br />
und bündelt dank verschiedener Schnittstellen<br />
wichtige Funktionen im Projekt.<br />
Der Nutzen der modellorientierten Arbeitsweise<br />
ist nicht immer allein in Zeit zu messen,<br />
stellen die planenden Architekten von<br />
hks I architekten heraus. Wesentlich sind<br />
andere Vorteile. Sie heben vor allem eine<br />
durchgängige, digitale Prozesskette hervor,<br />
die eine geringere Fehlerquote bedingt und<br />
damit im fortschreitenden Projekt die Kosten<br />
durch Baufehler minimieren hilft.<br />
Für die umfassende Planung, von der ersten Modellierung bis zur Ausführungs- und Detailplanung,<br />
setzen hks auf Archicad. Beim Erfurter Heizwerk planten sie konsequent in 3D und Open<br />
BIM, schon ab dem Aufmaß.<br />
GRAPHISOFT Deutschland GmbH<br />
Vertrieb Österreich<br />
mail@graphisoft.at<br />
www.archicad.at<br />
© Alex Brunner
Ihre<br />
Spende<br />
wirkt!<br />
Foto: T. Ertl<br />
20 Euro =<br />
1 Monat Suppe<br />
Wir > Ich<br />
Spenden Sie noch heute auf caritas.at oder<br />
jetzt QR Code scannen.<br />
Mit Unterstützung von
A-BENCH<br />
Kunden gewinnen.<br />
Schon im Wartebereich.<br />
www.selmer.at<br />
Exklusiver Partner der Brunner Group für Österreich