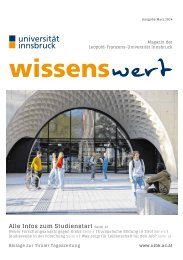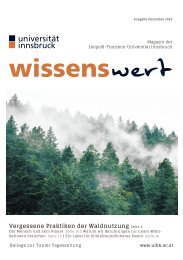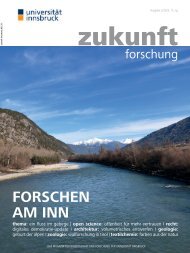Zukunft Forschung 01/2022
Das Forschungsmagazin der Universität Innsbruck
Das Forschungsmagazin der Universität Innsbruck
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
KURZMELDUNGEN<br />
AKTIONSPLAN FÜR<br />
ARTENREICHEN INN<br />
Ende April wurde an der Universität<br />
Innsbruck ein umfassender Aktionsplan<br />
zum Schutz des Inn vorgestellt.<br />
„Der Aktionsplan ist das erste ganzheitliche<br />
Artenschutzkonzept für den<br />
gesamten Flussverlauf – von seiner<br />
Quelle in der Schweiz bis zur Mündung<br />
in Passau“, erklärt Leopold Füreder<br />
vom Institut für Ökologie. Der Aktionsplan<br />
entstand unter Federführung<br />
seines <strong>Forschung</strong>steams und in Kooperation<br />
mit WWF, Land Tirol und den<br />
Verbund-Kraftwerken. Der historische<br />
Zustand des Inn wurde von den Expert*innen<br />
mit seinem aktuellen Zustand<br />
verglichen. Es zeigt sich, dass die<br />
intensive Nutzung des Talraums und<br />
der Wasserkraft dazu geführt hat, dass<br />
heute nur mehr acht Prozent des Flusslaufs<br />
naturnah sind. So sind auch viele<br />
typische Pflanzen- und Tierarten, die in<br />
anderen Flusssystemen bereits ausgestorben<br />
sind, wie Äsche, Flussuferläufer,<br />
Deutsche Tamariske und Zwergrohrkolben<br />
(im Bild) heute selten und<br />
ihr Fortbestand am Inn ist bedroht. Um<br />
diesen Trend zu stoppen, wurde im<br />
Rahmen des Projekts INNsieme ein<br />
positives Leitbild für den Inn entwickelt.<br />
„Durch die Fortsetzung der<br />
Schutzmaßnahmen, Renaturierung von<br />
intakten Abschnitten und der Reduktion<br />
der Belastung – vor allem der Wasserkraftnutzung<br />
– soll die Artenfülle<br />
wieder an den Inn zurückkehren. Das<br />
neue Leitbild für einen lebendigen Inn<br />
berücksichtigt dabei regionsspezifische,<br />
flusstypische Besonderheiten, vielfältige<br />
Rahmenbedingungen und bestehende<br />
Nutzungen,“ erklärt Leopold Füreder.<br />
ALPINE<br />
NACHHALTIGKEIT<br />
Uni Innsbruck und DAV untersuchten Bewirtschaftung<br />
alpiner Stützpunkte.<br />
DAS TASCHACHHAUS ist eine saisonal bewirtschaftete Alpenvereinshütte.<br />
ÖKOSYSTEME WÄHREND DER EISZEIT<br />
Mit dem Projekt ANAH wurden<br />
erstmals die Zusammenhänge<br />
verschiedener Faktoren der Bewirtschaftung<br />
alpiner Stützpunkte im bayerischen<br />
und im Tiroler Alpenraum wissenschaftlich<br />
nach Aspekten der Nachhaltigkeit<br />
im Spannungsfeld zwischen Bergsport<br />
und Naturraum untersucht. ANAH<br />
wurde als integratives Nachhaltigkeitskonzept,<br />
das Gebäudeinfrastruktur, Hüttenbetrieb<br />
und Bergsportler*innen unter<br />
ökologischer, ökonomischer und sozialer<br />
Dimension untersucht, durchgeführt. Die<br />
Ergebnisse werden ab Mitte <strong>2022</strong> in Form<br />
eines Leitfadens insbesondere Alpenvereinshütten<br />
– aber auch anderen Gastronomie-<br />
und Herbergsbetrieben – Anreize,<br />
Ideen und Handlungsempfehlungen für<br />
einen nachhaltigeren Betrieb geben. Durch<br />
ANAH konnte ein klares Bild gewonnen<br />
werden, wo und wie künftige Maßnahmen<br />
ansetzen müssen, wie Jutta Kister,<br />
ANAH-Projektleiterin am Institut für Geographie<br />
der Universität Innsbruck, erklärt:<br />
„Wichtige Erkenntnisse aus den Erhebungen<br />
auf den ausgewählten Hütten sind<br />
einerseits, dass das erarbeitete Set an Indikatoren<br />
vor Ort anwendbar ist, und andererseits,<br />
zu sehen, an welchen Themenfeldern<br />
auf den Hütten bereits intensiv<br />
gearbeitet wird und welche Themen noch<br />
zu wenig berücksichtigt werden.“<br />
Der Wechsel zwischen kalten und warmen Phasen<br />
in der jüngsten Eiszeit führte zu wiederholten Vergletscherungen,<br />
massiven Vegetationsverschiebungen<br />
und großflächigen Veränderungen der Verbreitungsgebiete<br />
vieler Arten. Noch vor rund 20. 000 Jahren, im<br />
letzteiszeitlichen Maximum, war ein Großteil Europas von Steppe bedeckt. Die während der<br />
Eiszeit dominanten Arten und die Vegetation finden sich noch heute in den extrazonalen europäischen<br />
Steppen, wie z. B. in der Pannonischen Tiefebene oder im Südtiroler Vinschgau. Das<br />
Wissen über diese Ökosysteme stammt bisher von paläoökologischen und klimatischen Daten.<br />
Nun haben Forscher*innen erstmals große Mengen genetischer Daten zur Modellierung von<br />
Populationsschwankungen in europäischen Steppen während der Eiszeit verwendet. Dafür hat<br />
das Team nicht mit Modellorganismen, sondern mit fünf für Steppen typischen Pflanzen- und<br />
Insektenarten gearbeitet, die sie in eurasischen Steppengebieten gesammelt haben. Teile des<br />
Genoms dieser Proben wurden an den Instituten für Ökologie und für Botanik an der Uni Innsbruck<br />
sequenziert und analysiert. „Bei allen Arten konnten wir übereinstimmende Reaktionen in<br />
Form von Populationsexpansionen in der Kaltphase und Kontraktionen in der Warmphase feststellen,<br />
aber auch artspezifische Effekte“, erklärt Peter Schönswetter vom Institut für Botanik.<br />
22 zukunft forschung <strong>01</strong>/22<br />
Fotos: Yvonne Lesewa, Felix Lassacher, Andreas Hilpold