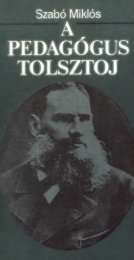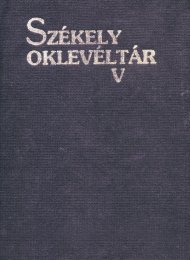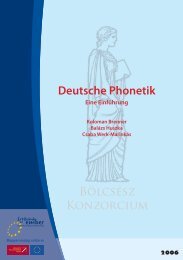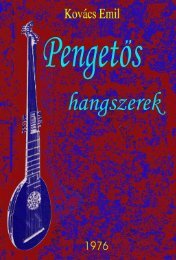Beitrag - MEK
Beitrag - MEK
Beitrag - MEK
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Gottfried von Straßburg und Ovid 39<br />
Auch ohne weitere Belege dürfte erkennbar sein, daß Gottfried ‘seinen’ Ovid eifrig<br />
studiert und ihn ausgiebig benutzt hat. 19<br />
Aber das ist nur die eine Seite! Neben der Affirmation muß nämlich auch die Distanzierung<br />
konstatiert werden, die kritische Auseinandersetzung mit Ovid im Tristan.<br />
Ein Blick auf den Roman-Prolog macht das deutlich: Nachdem Gottfried in einem<br />
strophischen Prologteil (1-44) das Verhältnis von Kunst und Kunstkritik erörtert und<br />
sich dabei sehr geschickt die Aufmerksamkeit und das Wohlwollen seines Publikums<br />
gesichert hat, 20 spricht er im nachfolgenden paargereimten Prologteil (45ff.) vom<br />
Thema und von der Intention seines Romans. Insgesamt reicht dieser Prologteil bis<br />
Vers 242. Etwa in der Mitte (125-130) wird das Romanthema angegeben: Gottfried<br />
kündigt eine Erzählung an von edelen senedæren (von edlen sehnsuchtsvoll Liebenden),<br />
von Tristan und Isolde nämlich, die in ihrem Leben reine sene (die wahre Sehnsucht<br />
Liebender) bezeugt haben. Vor und nach dieser Themenangabe stehen Aussagen<br />
über die Intention des Werks; es soll erfreuen und belehren, bessern und damit<br />
die doppelte Aufgabe erfüllen, die schon Horaz in seiner Ars poetica (333f.) der<br />
Dichtung zugewiesen hatte, das delectare und das prodesse. Vom prodesse (vom<br />
Nutzen, nämlich dem Belehren und Bessern) ist nach Vers 130, nach der Ankündigung<br />
des Themas, die Rede, von der delectatio vor der Themenansage; und nur die<br />
Erörterungen über die erwartbare erfreuende Wirkung des Romans interessieren uns<br />
im Zusammenhang mit Gottfrieds Abgrenzung seiner Position gegenüber der Ovids:<br />
Er habe die Mühe des Dichtens auf sich genommen (sagt Gottfried in den Versen<br />
45ff.) der werlt ze liebe und edelen herzen zeiner hage, um die Welt (die Menschen)<br />
zu erfreuen und um edlen Herzen Vergnügen zu bereiten.<br />
Die werlt, für die er schreibe und in der auch er beheimatet sei (so fährt er fort), sei<br />
nicht die Welt der Vielen, seien nicht die Menschen, die nur die Freude und Leichtlebigkeit<br />
suchen, sondern diejenigen, die bereit und fähig seien, zugleich Freude und<br />
Leid, Leben und Tod anzunehmen, die paradoxale Einheit der Gegensätze zu ertragen.<br />
Das seien die edelen herzen und (was die Liebe betrifft) die edelen senedære, die<br />
auch in der Liebe Freude und Leid, Leben und Tod bejahen könnten – so wie es die<br />
Protagonisten des Romans (Tristan und Isolde) beispielhaft vorgelebt hätten (48-130).<br />
Romanpersonen, Autor und ideales Publikum sollen als edle Herzen, als edle sehnsuchtsvoll<br />
Liebende in einer Gesinnungsgemeinschaft zusammengeschlossen sein.<br />
Den so qualifizierten Menschen (dieser werlt), sagt Gottfried, habe er seine unmüezekeit<br />
(das Werk seiner Mühe, seine Dichtung also) ze kurzewîle (zum vergnüglichen<br />
Zeitvertreib) vorgelegt, um ihre swære (ihren Kummer, ihr Leid) zu lindern und ihre<br />
nôt (ihren peinvollen Gemütszustand) erträglicher zu machen (71-76).<br />
19 Die Liste der Ovid-Reminiszenzen im Tristan ließe sich natürlich verlängern. Hinweisen will ich nur noch auf<br />
MCDONALDS interessanten Versuch, die Marke-Gestalt weitgehend als Konkretisierung des Ehemann-Typus in<br />
Ovids Amores zu verstehen: MCDONALD, WILLIAM C.: King Mark: Gottfried’s version of the Ovidian husbandfigure?<br />
– In: Forum for Modern Language Studies 14 (1978), S. 255-269.<br />
20 Vgl. EIFLER, GÜNTER: Publikumsbeeinflussung im strophischen Prolog zum ‘Tristan’ Gottfrieds von Straßburg.<br />
– In: BELLMANN, GÜNTER; EIFLER, GÜNTER; KLEIBER, WOLFGANG (Hg.): Festschrift für Karl Bischoff zum 70.<br />
Geburtstag. Köln; Wien, 1975, S. 357-389; ferner HAUG, WALTER: Literaturtheorie im deutschen Mittelalter.<br />
Von den Anfängen bis zum Ende des 13. Jahrhunderts. 2., überarb. u. erw. Aufl. Darmstadt, 1992, S. 201-209.











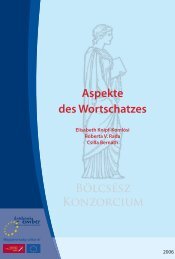
![Szamosháti szótár [A-F] - MEK](https://img.yumpu.com/20708392/1/164x260/szamoshati-szotar-a-f-mek.jpg?quality=85)