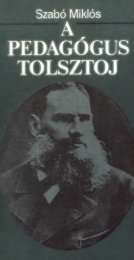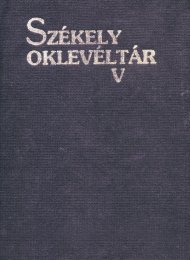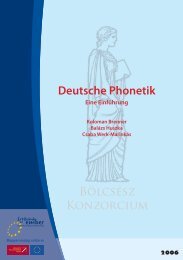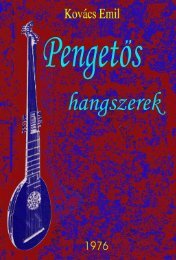Beitrag - MEK
Beitrag - MEK
Beitrag - MEK
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Horazens Hymnus auf Bacchus 31<br />
docentem); dieser ist also sein Schüler. Der Schluß zeigt den Lehrer als Überwinder<br />
des Hades, der seine Mutter dem Tod entreißt und ihm selbst entkommt. Genau das<br />
ist der Punkt, in dem sich der Schüler den Lehrer zum Vorbild nimmt.“ 17<br />
Lefèvre schreibt zuvor auch wie folgt: Im allgemeinen waren Apollo und Bacchus die<br />
„Gottheiten der Dichter. Horaz lag die apollonische Klarheit, nicht die dionysische<br />
Begeisterung. So sind seine beiden Bacchus-Oden ambivalenten Charakters. [...] Die<br />
zweite Bacchus-Ode, 2, 19, hat leicht ironische Züge.“ 18 Dieser ambivalente Charakter<br />
der Ode wird auch von V. Pöschl19 und H. P Syndicus betont. V. Pöschl schreibt:<br />
„Die beiden ersten Strophen stellen einen gewaltigen Konstrast dar. Dem friedlichidyllischen<br />
Bild des Gottes, der seinen Nymphen und Satyrn Lieder vorsingt, steht die<br />
zweite Strophe gegenüber, die die Erschütterung schildert, die die Epiphanie des<br />
Gottes im Dichter hervorruft. Damit ist ein Grundmotiv der Ode angedeutet: das doppelte<br />
Gesicht des Gottes, der der Gott des Gesanges, des Spieles, der Freude und<br />
zugleich der furchtbar zerstörende Gott ist, dessen Thyrsusstab der Dichter fürchtet.“<br />
Syndikus bemerkt dazu: „Die Schlußstrophe aber, in der Dionysos die Monstren der<br />
Unterwelt so zu besänftigen weiß, wie es sonst nur Orpheus und der Zauber des<br />
Gesanges konnten, lehrt klar, wohin Horaz auch bei dieser, gewiß in einer doppelten<br />
Beleuchtung gesehenen Gottheit die Hauptbetonung legen wollte.“ 20 Nach D. West<br />
sind die erste und die letzte Strophe grotesk, ironisch und respektlos, aber die zweite<br />
Strophe ist ernst zu nehmen. 21<br />
In den letzten Jahrzehnten wurde auch eine allegorische Interpretation vorgeschlagen.<br />
Viktor Pöschl hat in einer Anmerkung angedeutet, daß Dionysos der Gott des<br />
Antonius gewesen sei und daß man vermuten dürfe, er sollte hier als griechischer Gott<br />
für die römische Welt wiedergewonnen werden. 22 Laut S. Koster muß die Übernahme<br />
des Dionysos in ihrer politischen Tragweite besonders hervorgehoben werden. Er<br />
schreibt wie folgt: „Wie stark die Propaganda eingewirkt hat, wird besonders durch<br />
die Ode 2, 19 deutlich. In ihr ist der Mythos nur noch Chiffre für die Realität. Dies<br />
zeigt sich daran, daß Horatius in einem neuen Mythologem schon die Gleichsetzung<br />
von Augustus und Bacchus voraussetzt.“ 23 Horaz erlebt, wie Augustus Lieder einstudiert<br />
bzw. den Dichtern ihr Thema vorschreibt. Nach dieser Interpretation ist<br />
Ariadne Livia, Cerberus ist Cleopatra, die trilinguis war, weil sie die drei Sprachen<br />
Ägyptens sprach, und so weiter.<br />
3. Meiner Meinung nach kann man diesen Bacchus-Hymnus nur im Lichte der<br />
horazischen Literaturkritik richtig interpretieren, da sein Hauptthema eindeutig die<br />
18<br />
LEFÈVRE: Horaz, S. 217.<br />
19<br />
PÖSCHL: Die Dionysosode, S. 222.<br />
20<br />
SYNDIKUS: Die Lyrik, S. 479.<br />
21<br />
WEST, DAVID: Horace, Odes II. Vatis Amici. Oxford: Clarendon, 1998, S. 140.<br />
22<br />
PÖSCHL: Die Dionysosode, S. 210, Anm. 6.<br />
23<br />
KOSTER, SEVERIN: Quo me Bacche rapis? (Hor. carm. 3, 25 und 2, 19). – In: KOSTER, S. (Hg.): Horaz-Studien.<br />
Erlangen, 1994, S. 51-70, hier S. 62.<br />
24<br />
PÖSCHL: Die Dionysosode, S. 229.











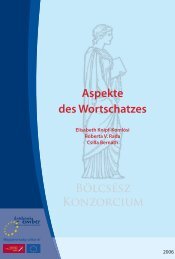
![Szamosháti szótár [A-F] - MEK](https://img.yumpu.com/20708392/1/164x260/szamoshati-szotar-a-f-mek.jpg?quality=85)