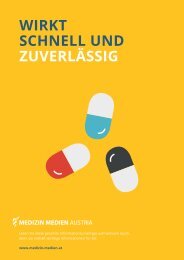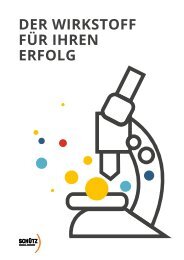CliniCum neuropsy 04/2023
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Foto: SnapVault/stock.adobe.com<br />
me zur Psychosefrüherkennung die gewünschten Effekte<br />
zeigen, beantwortet OÄ Assoc. Prof. Priv.-Doz. Dr. Katrin<br />
Skala von der Universitätsklinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie,<br />
Wien, eindeutig mit ja: „Das weiß man sowohl<br />
aus der klinischen Erfahrung als auch aus diversen Langzeitstudien.<br />
Je früher und besser interveniert wird, desto<br />
besser sind die prognostischen Faktoren. Da geht es nicht<br />
so sehr um die direkte Symptomebene, sondern um den<br />
weiteren Lebensverlauf. Wenn ich bei einer frühen psychotischen<br />
Episode, etwa mit 15 Jahren, für vier Monate<br />
aus dem Leben draußen bin, dann ist das Risiko, dass ich<br />
die Schule abbrechen werde, weitaus höher, als wenn ich<br />
relativ zügig Begleitung, Behandlung und Versorgung finde,<br />
die dann auch darauf achtet, dass ich wieder in das<br />
Schulsetting zurückkomme.“<br />
Skala sieht hier nicht nur auf individueller, sondern auch<br />
auf gesellschaftlicher Ebene einen großen Benefit: „Ich erinnere<br />
mich an viele Geschichten, nicht unbedingt bei Psychosen,<br />
aber zum Beispiel bei Traumafolgestörungen, wo<br />
uns das Jugendgericht angerufen und gesagt hat: 13¾ Jahre,<br />
demnächst eine Gefängniskarriere vor sich. Und nach<br />
vielen Jahren intensivster 2:1-Betreuung haben diese Personen<br />
dann irgendwann die Kurve gekriegt. Da ist das Delta,<br />
auch das finanzielle, unendlich groß: zwischen einem<br />
guten Lebensweg, vielleicht sogar am ersten Arbeitsmarkt,<br />
wie bei einigen dieser Kinder, und dem Pendeln zwischen<br />
Psychiatrie und Gefängnis für die nächsten 60 Jahre.“<br />
„Wenn ich nur das Versorgungssystem in die Kosten-Nutzen-Rechnung<br />
hineinnehme, dann wird es sicher teuer“,<br />
ergänzt Schrank. „Aber wenn ich den gesamtgesellschaftlichen<br />
Nutzen betrachte, den Gewinn an Qualität in der<br />
Gesellschaft, an Frieden, den Zusammenhalt usw. miteinbeziehe,<br />
der sicher auch monetär zu beziffern wäre, dann<br />
würde die Rechnung anders ausschauen.“<br />
Hinschauen und Hilfe aktiv anbieten<br />
Ein Problem in der Versorgung ist auch, dass vorhandene<br />
Hilfsangebote oft nicht ankommen. Entweder, weil Kinder<br />
und Jugendliche nichts von den jeweiligen Angeboten<br />
wissen, oder weil einfach weggeschaut oder eine psychische<br />
Erkrankung nicht ernst genommen wird. „Selbst<br />
wenn Schüler:innen merken: ,Ok, mit mir ist etwas falsch‘,<br />
kommt es im familiären Umfeld oft dazu, dass das nicht<br />
ernst genommen wird. Oder es wird sogar abgelehnt, dass<br />
diese Person Hilfe bekommt“, berichtet Frisch. „Und hier<br />
eben nicht wegzuschauen, sondern aktiv auf die Betroffenen<br />
zuzugehen, Hilfe anzubieten, ist enorm wichtig. Weil<br />
sich durch die Stigmatisierung viele einfach nicht trauen,<br />
aktiv Hilfe in Anspruch zu nehmen.“<br />
Je früher und besser interveniert<br />
wird, desto besser ist die Prognose.<br />
„Auf der anderen Seite berichten Lehrer:innen zunehmend<br />
von Jugendlichen, die in der Psychiatrie waren und<br />
dann ohne Scheu ihre Diagnose vor sich hertragen, etwa:<br />
,Ich bin die Borderlinerin‘“, kommentiert Prof. Dr. Thomas<br />
Bock, Professor für Klinische Psychologie und Sozialpsychiatrie,<br />
Hamburg, aus dem Auditorium. „TikTok ist<br />
eine Art Früherkennung, die uns alle überholt. Und an<br />
dieser Stelle müssen wir kritisch werden mit den Diagnosen<br />
und diese Art von Zuordnung hinterfragen.“<br />
Ansprechen und Stigmatisierung durchbrechen<br />
Soll man also überhaupt Diagnosen vergeben? Diese Frage<br />
kommt ebenfalls aus dem Publikum – verbunden mit<br />
der Sorge, Kindern einen Stempel aufzudrücken und damit<br />
die Stigmatisierung zu verstärken. „Seit ich 15 war,<br />
habe ich verschiedene Hilfsangebote in Anspruch genommen,<br />
aber keine Diagnose bekommen“, meldet sich eine<br />
weitere Person aus dem Publikum zu Wort. „Durch soziale<br />
Medien habe ich herausgefunden, was Autismus ist, dass<br />
das auf mich zutrifft, und habe mich diagnostizieren lassen.<br />
Viele sagen: Warum brauchen wir diese Labels? Aber<br />
erst durch das Label Autismus konnte ich die richtigen<br />
Angebote in Anspruch nehmen. Wenn jemand also stolz<br />
die Diagnose ,Ich bin Borderliner‘ vor sich herträgt, dann<br />
hat das vielleicht damit zu tun, dass er damit weiß, was er<br />
hat und wie er damit umgehen kann.“<br />
Eine weitere Person aus dem Publikum plädiert für den<br />
offenen Umgang mit Diagnosen: „Zu sagen, man will Kindern<br />
den Stempel nicht aufdrücken, verstärkt eigentlich<br />
nur die Stigmata! Denn wenn man nicht drüber spricht,<br />
dann ändert man auch nichts.“<br />
Für Schrank hat das Diagnose-vor-sich-Hertragen auch<br />
mit Autonomie und Identitätsfindung zu tun. Sie berichtet<br />
von einer Studie, die ihre Arbeitsgruppe zur Publikation<br />
eingereicht hat: „Menschen zwischen 15 und 25 Jahren,<br />
die mehr Netflix-Serien geschaut haben, in denen Menschen<br />
mit Autismusspektrumstörungen mit positiver Valenz<br />
dargestellt wurden, haben sich selbst signifikant häufiger<br />
als dem Autismusspektrum zugehörig eingeordnet.<br />
Vieles prasselt auf uns ein und es geht um die Suche: Wer<br />
bin ich? Und dann kann ich mal diese Diagnose haben<br />
und mal jene. Wichtig ist, dass die Fluidität gewahrt wird,<br />
also, dass ich vielleicht heuer die Borderlinerin bin und<br />
nächstes Jahr vielleicht ADHS habe. Dass man die Identität<br />
noch ausprobieren darf!“<br />
4 / 23<br />
CC<br />
<strong>neuropsy</strong><br />
27