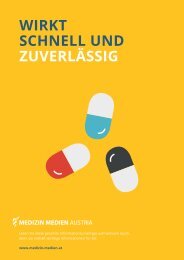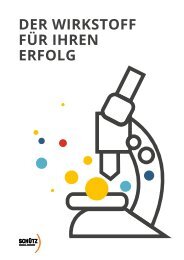CliniCum neuropsy 04/2023
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Von den drei „Blickrichtungen“ der ZOS – Abstinenz, Reduktion<br />
(weniger und seltener, Punktabstinenz) oder<br />
Schadensminderung (gleiche Konsummenge, aber weniger<br />
schädliche Konsumart) – ist Körkel zufolge die Abstinenz<br />
eine zwar „wertvolle Lebens- und Behandlungsoption“.<br />
Allerdings: Die Inanspruchnahme ist gering, die<br />
Abbruchquoten sind beachtlich.<br />
Benefit auch durch geringe Reduktion<br />
Als „Hammerergebnis“ bezeichnet Körkel, dass mehr unbehandelte<br />
Abhängige eine Drogen- oder Alkoholabhängigkeit<br />
durch Reduktion als durch Abstinenz überwinden,<br />
wie „Natural change“-Studien 2<br />
zeigen. Mehr noch: Die<br />
Reduktion ist Abhängigen nicht nur möglich, sondern sie<br />
bringt auch einen Benefit: 3<br />
Jede 20g-Alkoholreduktion<br />
(=0,5l Bier, 0,2l Wein/Sekt, drei Schnäpse à 2cl) täglich gehe<br />
„linear“ einher mit positiven Entwicklungen im sozialen<br />
Bereich.<br />
Und das auch noch nach drei Jahren sowie analog bei Kokainabhängigen,<br />
fährt Körkel fort. Eine Reduktion verbessere<br />
die psychische und physische Gesundheit, die Lebensqualität<br />
und reduziere Ängste, Depressionen und Drogenkonsum.<br />
Ein beträchtlicher Teil (ca. 10–30%) der Tabak-,<br />
Alkohol- und Drogenabhängigen wechsle während oder<br />
nach einer Reduktionsbehandlung zur Abstinenz.<br />
Bei der Reduktion können drei miteinander kombinierbare<br />
Wege zur Unterstützung angeboten werden: verhaltenstherapeutische<br />
Behandlungen zum (selbst-)kontrollierten<br />
Konsum (Wochenpläne, Programme zum kontrollierten<br />
Trinken, Tagebücher, Einzel- oder Gruppenbehandlungen<br />
etc.), pharmakologische Behandlungen sowie Selbsthilfegruppen.<br />
Reduktion als „Brücke zur Abstinenz“<br />
„Reduktion ist für viele die Brücke zur Abstinenz“, betont<br />
Körkel, „nach dem Motto: Jetzt habe ich einen abstinenten<br />
Tag geschafft, das ging ja viel besser, als ich dachte.“ Die<br />
„Self-efficacy“ – die Selbstwirksamkeitserwartung – wachse<br />
step by step. Wenn jemand in die „Schiene der Veränderung“<br />
gebracht werde, traue er sich plötzlich zu, ganz<br />
aufzuhören.<br />
Körkel zitiert dazu Daten aus der KISS-Studie. Demnach<br />
reduziert das Programm den Drogenkonsum um 30 Prozent<br />
(durch Urinkontrollen bestätigt), steigert die drogenfreien<br />
Tage um 20 Prozent, senkt die Konsumausgaben um<br />
250 Euro/Monat, reduziert die Abhängigkeitsdiagnosen<br />
um 30 Prozent, reduziert stationäre Entzugsbehandlungen<br />
um 50 Prozent, senkt Beschaffungskriminalität und<br />
Prostitution und führt bei einem Teil zur Abstinenz (z.B.<br />
bei 28 Prozent der Benzo-Konsumenten und -Konsumentinnen).<br />
Auch das dritte Behandlungsziel, die Schadensminderung,<br />
bringe Erfolge. So sei die Schädlichkeit der E-Zigarette um<br />
ein Vielfaches geringer als die der Tabakzigarette. Zudem:<br />
„Wenn jemand auf die E-Zigarette umsteigt, dann ist das<br />
häufig ein Anstoß, die Tabakzigaretten erheblich zu reduzieren<br />
oder zum Rauchstopp überzugehen“, sagt Körkel.<br />
Ärztlichen „Rechthaberreflex“ in Schach halten<br />
Die Basis für ZOS ist laut Körkel, eine zieloffene innere<br />
Haltung einzunehmen: „Die Haltung, mit der ich jemandem<br />
begegne, ist das A und O.“ Erst dann folge die Abklärung<br />
der konsumierten Substanzen/Verhaltenssüchte,<br />
zweitens die Abklärung der Zielvorstellungen für jede dieser<br />
Substanzen/Verhaltenssucht und drittens das Vorhalten<br />
konkreter Behandlungsangebote, sei es in Richtung<br />
Abstinenz, Reduktion oder Schadensminderung.<br />
Hilfreich für alle drei Schritte ist das „Motivational Interviewing“<br />
4 , die motivierende Gesprächsführung. „Die<br />
Suchtbehandlung ist wie ein Wiener Walzer“, bringt Körkel<br />
einen Vergleich. Die zieloffene Haltung, mit der alles anfange,<br />
bedeute:<br />
• „Ich bin auf kein Änderungsziel (z.B. Abstinenz)<br />
festgelegt.“<br />
• „Ich traue suchtbelasteten Menschen zu, die für sie<br />
richtigen Entscheidungen treffen zu können.“<br />
• „Ich achte die Autonomie meines Gegenübers –<br />
bezüglich Ziel und Behandlungsweg.“<br />
• „Ich halte meinen Rechthaberreflex in Schach.“<br />
Wenn die eigene Haltung geklärt ist, geht es in die Arbeit<br />
mit dem Patienten bzw. der Patientin. Als Hilfsmittel zur<br />
systematischen Konsumabklärung empfiehlt Körkel einen<br />
Kartensatz, auf dem die Substanzen (Alkohol, Schlafmittel,<br />
Kaffee, Energydrinks, Cannabis, Kokain, Opiate etc.)<br />
und Verhaltenssüchte (Internet, Kaufsucht, Glücksspiel<br />
etc.) dargestellt sind.<br />
Kasuistik: Substitutionspatient Michael<br />
Körkel bringt das Beispiel des 43-jährigen Substitutionspatienten<br />
Michael, der sechs Karten ausgewählt hat: Substitutionsmittel<br />
(Methadon tägliche Vergabe, „gut eingestellt“),<br />
Alkohol (1l Wein täglich, manchmal bis zu 2l plus<br />
0,2l Jägermeister), Tabak (30–35 Zigaretten täglich, mehrere<br />
erfolglose Aufhörversuche), Cannabis (ca. 2 Joints pro<br />
Woche), Opiate (alle 3–4 Wochen 1x „Straßenheroin“ i.v.)<br />
und Beruhigungsmittel (ca. 1x im Monat 3–5 Benzos,<br />
„wenn es mir besonders beschissen geht“).<br />
4/23 CC<br />
<strong>neuropsy</strong><br />
31