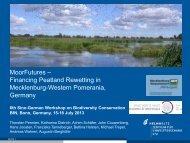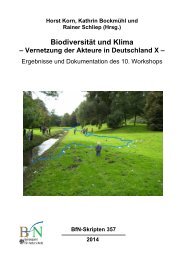Astrid Kowatsch, Ulrich Hampicke, Lenelis Kruse- Graumann und
Astrid Kowatsch, Ulrich Hampicke, Lenelis Kruse- Graumann und
Astrid Kowatsch, Ulrich Hampicke, Lenelis Kruse- Graumann und
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
F&E Indikatoren für ein integratives Monitoring in Deutschen GSG Endbericht<br />
schen Umsetzung der Indikatoren. Diese können nicht unbedingt in gleicher Weise<br />
auf alle Länder <strong>und</strong> schon gar nicht auf alle GSG übertragen werden.<br />
4.4 Zielhierarchien des Monitorings<br />
Ziele von Großschutzgebieten können auf verschiedenen Ebenen der Konkretisierung<br />
definiert werden. Alle deutschen Nationalparke beispielsweise fühlen sich dem<br />
„Leitziel“ „Natur Natur sein lassen“ verpflichtet. Dieses Leitziel lässt sich ausgesprochen<br />
schlecht für Monitoringziele operationalisieren. Zentrale Fragen bleiben unbeantwortet<br />
z.B.:<br />
� Welche Natur ist angestrebt (Beachte: Natürliche <strong>und</strong> anthropogene Klimaveränderungen<br />
lassen keinen stabilen, eindeutig beschreibbaren Endzustand erwarten)?<br />
� Bis wann soll dieser Zustand erreicht werden?<br />
� Welche unterstützenden Managementmaßnahmen sind hierfür erforderlich?<br />
Dennoch lassen sich schädliche Einflüsse auf die natürliche Dynamik, wie der Zerschneidungsgrad<br />
von Habitaten, der Klimawandel <strong>und</strong> andere anthropogene Einflüsse,<br />
wie z.B. Nährstoff- <strong>und</strong> Säureeintrag, eingeführte Arten oder Effekte aus der insulären<br />
Lage von GSG ausmachen. Solche Faktoren können bis zu einem gewissen<br />
Grad überwacht <strong>und</strong> durch geeignete Maßnahmen reguliert werden.<br />
Unter diesem Leitziel verbergen sich zwei signifikant unterschiedliche Gr<strong>und</strong>motivationen:<br />
1. Wiederherstellung eines (weitgehend theoretisch entwickelten) Zustands eines<br />
natürlichen Ökosystems<br />
2. Ausschluss aller beeinflussbaren, menschlichen Eingriffe mit dem Ziel, Ökosystemen<br />
<strong>und</strong> Arten (unter persistierenden anderen menschlichen Beeinflussungen)<br />
eine Selbstregulation mit Hilfe naturimmanenter Prozesse zu<br />
ermöglichen.<br />
In seit langem <strong>und</strong> stark vom Menschen überformten Landschaften wie den mitteleuropäischen<br />
entstehen gr<strong>und</strong>sätzliche Probleme “Natur“ eindeutig zu definieren. Insbesondere<br />
sind die ständigen Klimaschwankungen <strong>und</strong> Einwanderungsprozesse<br />
während der zurückliegenden 18.000 Jahre zu beachten, ebenso die Tatsache, dass<br />
es vom Menschen unberührte (ahemerobe) Ökoysteme nicht mehr gibt, <strong>und</strong> dass<br />
selbst die meisten heute oligohemeroben Ökosysteme in der Geschichte schwereren<br />
menschlichen Eingriffen unterlagen. Es fehlen also rezente Referenzzustände für<br />
das, was als „Natur“ bezeichnet werden könnte. Als Referenz kommen nur theoretische<br />
Modelle in Frage (z.B. die potentielle natürliche Vegetation). Die Rahmenannahmen<br />
des jeweiligen Modells entscheiden über konkrete Schutz- <strong>und</strong> Managementmaßnahmen.<br />
Naturschutz in Mitteleuropa ist nicht der protektive Schutz des<br />
23