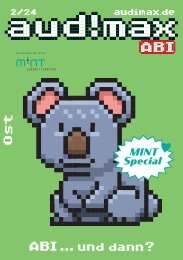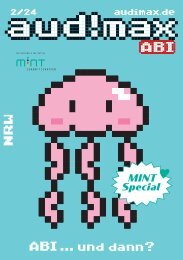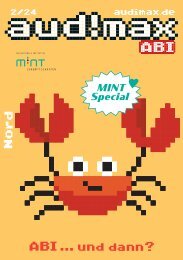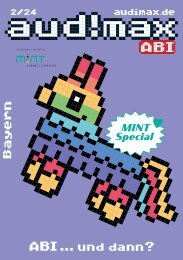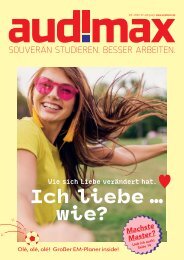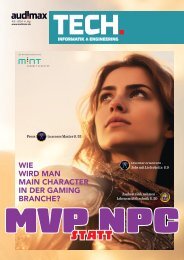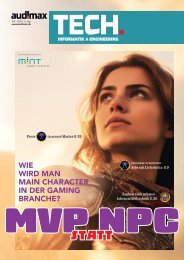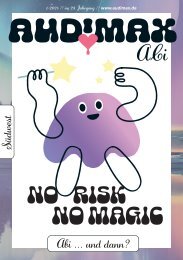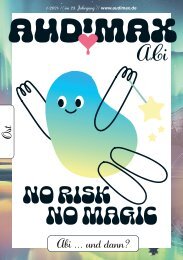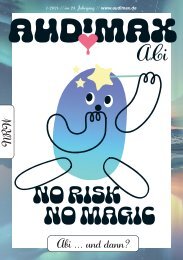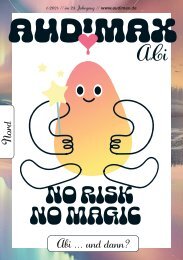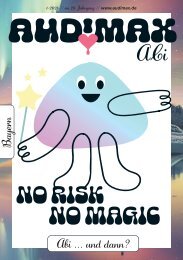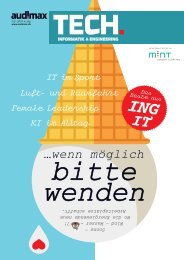audimax campus 02/03 2024
Good vibes only? Wir gehen der „Toxic Positivity“ auf die Spur +++ Stefanie Stahl im Interview +++ Assessment’s Creed? Wie du das Assessement Center überstehst +++ Food time! Komm mit auf eine Reise durch Deutschlands Mensen! +++ Female Leadership! Was tun, damit Frauen an die Spitze kommen +++ Reggae-Sänger Patrice beweist „Mut zur Lücke"
Good vibes only? Wir gehen der „Toxic Positivity“ auf die Spur +++ Stefanie Stahl im Interview +++ Assessment’s Creed? Wie du das Assessement Center überstehst +++ Food time! Komm mit auf eine Reise durch Deutschlands Mensen! +++ Female Leadership! Was tun, damit Frauen an die Spitze kommen +++ Reggae-Sänger Patrice beweist „Mut zur Lücke"
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
EMOTIONS<br />
#GoodVibesOnly?<br />
Wie toxisch ist die Toxic Positivity? Ein Gespräch mit<br />
Psychologin und Bestsellerautorin Stefanie Stahl.<br />
Interview: Lydia Borsboom // Illustration: freepik.com // Foto: Stefanie Stahl<br />
Frau Stahl, was verstehen Sie unter toxischer<br />
Positivität?<br />
Es gibt Menschen, die nicht bereit sind unangenehme Gefühle<br />
zu fühlen bzw. zuzulassen. Diese werden verdrängt<br />
oder verleugnet, selbst in ernsten und schwierigen Situationen.<br />
Eine Art zwanghafter Optimismus. In der Psychotherapie<br />
geht es um die Selbstreflexion und um die Förderung<br />
von (Krankheits-)Einsicht. In diesem Zusammenhang<br />
wird auch das Wort »Bagatellisierung« benutzt, was so viel<br />
bedeutet wie »Kleinreden, Verharmlosen oder Herunterspielen«<br />
von Problemen und bei toxisch positiven Menschen<br />
einen zentralen Aspekt darstellt.<br />
Wo liegt der Unterschied zum gesunden Optimismus?<br />
Ein gesunder Optimismus ist zwar auch eine Art Verzerrung<br />
in eine positive Richtung, jedoch lässt er weiterhin<br />
negative Gefühle zu. Wir können also optimistisch in die<br />
Zukunft blicken, obwohl wir gerade unglücklich sind. Wir<br />
müssen unangenehme Gefühle nicht sofort verdrängen<br />
oder eine aktuelle Situation schönreden. Die Toxic Positivity<br />
hingegen würde bereits die aktuelle Situation ins Positive<br />
verzerren und somit auch die Realität leugnen. Ein gesunder<br />
Optimismus ist also viel realitätsgebundener.<br />
Woran liegt der Reiz an der Toxic Positivity und warum<br />
ist sie nicht ungefährlich?<br />
Der Reiz besteht darin, dass ich vermeintlich erstmal glücklicher<br />
bin, weniger Probleme habe und oberflächlich betrachtet<br />
auch als optimistischer Mensch wahrgenommen<br />
und somit eher gemocht werde. Denn in unserer Gesellschaft<br />
ist positives Denken sehr angesehen. Aber natürlich<br />
ist das ein Trugschluss und auf die Dauer gefährlich für<br />
die eigene psychische Gesundheit: Unangenehme Gefühle<br />
werden unterdrückt und können folglich auch nicht<br />
verarbeitet werden. Dadurch bleiben diese Gefühle unterschwellig<br />
weiter bestehen und ich muss permanent dagegen<br />
ankämpfen. Die eigentlich angebrachten Gefühle werden<br />
nicht ausgelebt, wodurch auch die entsprechenden<br />
Verhaltensweisen wie Wutausbrüche, Weinen, Schreien<br />
und Trauern nicht zum Zug kommen, was wiederum zur<br />
Folge hat, dass frustrierte Bedürfnisse weiter frustriert<br />
bleiben. Das ist sehr belastend. Hinzu kommt der permanente<br />
Druck, glücklich sein zu müssen. Toxisch positive<br />
Menschen sind selten authentisch und werden auf Dauer<br />
auch so wahrgenommen. Vor allem wenn sie Leid bei anderen<br />
nicht (an)erkennen und Probleme verharmlosen. In<br />
der Folge kann sich bei toxisch positiven Menschen auch<br />
eine tiefe Depression entwickeln.<br />
Wo ist Toxische Positivität überall zu finden?<br />
Allgemein im Zeitgeist: Sprüche wie »Wenn das Leben dir<br />
Zitronen gibt, mach Limonade draus«, »Good vibes only«<br />
oder »Stell dich nicht so an« werden von manchen Menschen<br />
extrem verinnerlicht. Die sozialen und andere Medien<br />
sowie Werbung bieten fast ausschließlich glückliche<br />
Menschen, Erfolgsmomente, ein perfektes Leben und<br />
unendlich viele Tipps, wie man glücklicher, erfolgreicher,<br />
schöner wird. Das sorgt bei vielen Menschen<br />
für eine Tendenz zur Selbstoptimierung<br />
statt zur Selbstakzeptanz.<br />
In langjährigen<br />
Beziehungen, Familien- und<br />
anderen sozialen Strukturen<br />
kann toxische Positivität<br />
über das Kleinreden von<br />
Problemen und Schönreden<br />
von Grenzüberschreitungen<br />
zu einer negativen<br />
Prägung und in<br />
einem Verharren in schädlichen<br />
Beziehungen führen.<br />
Wodurch entsteht Toxic<br />
Positivity? Wie lässt sich<br />
das Phänomen psychologisch<br />
erklären?<br />
Bei einem mangelhaften Zugang zu<br />
den eigenen Gefühlen bzw. deren Verdrängung<br />
kann es dazu kommen, dass man sich die rosarote<br />
Brille aufsetzt. Fehlende Empathie kann abgesehen vom<br />
Einfluss durch den Zeitgeist und den immer mehr gut gelaunten<br />
Menschen in den sozialen Medien unter anderem<br />
durch folgende Faktoren erklärt werden: 1. Das generelle<br />
menschliche Grundbedürfnis nach Lustgewinn und Unlustvermeidung<br />
bzw. dem Streben nach Positivem und<br />
Vermeiden von Negativem (nach Grawe) 2. Lernerfahrungen<br />
im Umgang mit Familie und Umfeld. Wie wurde in meiner<br />
Familie mit unangenehmen Gefühlen und Problemen<br />
umgegangen?<br />
Wie sollte man stattdessen mit schweren Zeiten<br />
umgehen?<br />
Gefühle wahrnehmen und spüren, sie zulassen, annehmen,<br />
verarbeiten und regulieren. Ablegen von ungünstigen<br />
Glaubenssätzen. Hilfreich können hier auch Atemübungen<br />
und stärkende Selbstverbalisationen sein (»Ich darf meine<br />
Gefühle zeigen.«) Wenn möglich und nötig, Unterstützung<br />
suchen in Familie, Freundeskreis oder professionell durch<br />
Coaches oder Therapeuten. Bei anderen: aktives Zuhören,<br />
dabei nicht zu schnell Ratschläge, Aufmunterungssprüche<br />
oder Lösungsvorschläge bringen, sondern empathisch<br />
sein. Oder auch einfach mal fragen, was man dem Gegenüber<br />
jetzt Gutes tun könnte.<br />
Buchtipp<br />
Du willst mehr über Gefühle erfahren?<br />
»Wer wir sind« von Stefanie Stahl könnte dir<br />
faszinierende Einblicke in die Psyche des Menschen<br />
bieten. »Das Kind in dir muss Heimat finden«<br />
ist seit 2016 auf der Spiegel-Bestsellerliste.<br />
Dein Hochschulmagazin // <strong>audimax</strong> // 17