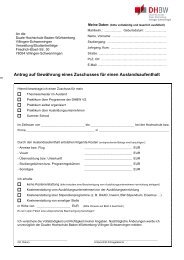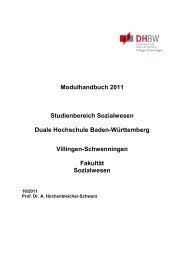Diskussionsbeiträge 11/2012 - DHBW Villingen-Schwenningen
Diskussionsbeiträge 11/2012 - DHBW Villingen-Schwenningen
Diskussionsbeiträge 11/2012 - DHBW Villingen-Schwenningen
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
1. Einleitung<br />
Duale Hochschule BW <strong>Villingen</strong>-<strong>Schwenningen</strong> - Diskussionsbeitrag <strong>11</strong>/<strong>2012</strong><br />
Immaterielle Vermögensgegenstände – und darunter auch selbst geschaffene<br />
immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens – spielen im heutigen<br />
Wirtschaftsleben unstrittig eine immer größere Rolle, was insbesondere dem in<br />
Deutschland schon weit fortgeschritten Wandel von der produktions- zur wissens-<br />
basierten Gesellschaft zuzuschreiben ist. 1 Umstritten ist allerdings, wie dieser Tat-<br />
sache in der Bilanzierung Rechnung getragen werden soll, denn die selbst ge-<br />
schaffenen immateriellen Vermögensgegenstände, die aufgrund ihrer unsicheren,<br />
schwer greifbaren Art - aber dennoch großen Bedeutung - auch schon als „Heili-<br />
ger Gral der Betriebswirtschaft“ bezeichnet wurden, werfen eine Unzahl von Fra-<br />
gen und Problemen hinsichtlich Abgrenzung und Aktivierbarkeit auf. 2<br />
Die grundlegenden Schwierigkeiten im Zusammenhang mit der Bilanzierung selbst<br />
geschaffener immaterieller Vermögensgegenstände sind indes altbekannt. Schon<br />
1979 bezeichnete Moxter die immateriellen Werte als „ewige Sorgenkinder des Bi-<br />
lanzrechts“. 3 Damit gibt er dem Dilemma Ausdruck, das sich bei der Bilanzierung<br />
originärer immaterieller Werte grundsätzlich ergibt und daher kontrovers diskutiert<br />
wird: einerseits stellen sie eine wichtige Informationsquelle zur Bestimmung des<br />
unternehmerischen Erfolgspotenzials dar. 4 Andererseits kann selbst geschaffenen<br />
immateriellen Gütern aber aufgrund ihrer Körperlosigkeit und der vielfach schwer<br />
zurechenbaren Herstellungskosten sowie aufgrund ihrer unsicheren zukünftigen<br />
Gewinnrealisierungsaussichten nur erschwert ein objektivierter Wert beigemessen<br />
werden. Weiterhin können sich auch große Schwierigkeiten bei der Suche nach<br />
einem aktiven Markt zur Identifikation von Marktpreisen ergeben.<br />
Dennoch muss von den unterschiedlichen Rechtssystemen eine adäquate Lösung<br />
für die bilanzielle Behandlung der originären immateriellen Vermögensgegenstän-<br />
de gefunden werden. Dies macht es erforderlich, spezifische Definitionen im<br />
Rahmen der relevanten bilanztheoretischen Zielsetzungen festzulegen, anhand<br />
derer über die Behandlung der originären Immaterialgüter entschieden werden<br />
kann. Wenn man die stark voneinander abweichenden Lösungen betrachtet, die in<br />
1 Vgl. Weinand/Wolz, F&E im Mittelstand, KoR 2010, S. 134.<br />
2 Vgl. Rieg, Heiliger Gral der BWL?, BC 2006, S. 82.<br />
3 Vgl. Moxter, Immaterielle Anlagewerte, BB 1979, S. <strong>11</strong>02.<br />
4 Vgl. Velte/Sepetauz, Ansatzwahlrecht Immaterielle, BC 2010, S. 349.<br />
1