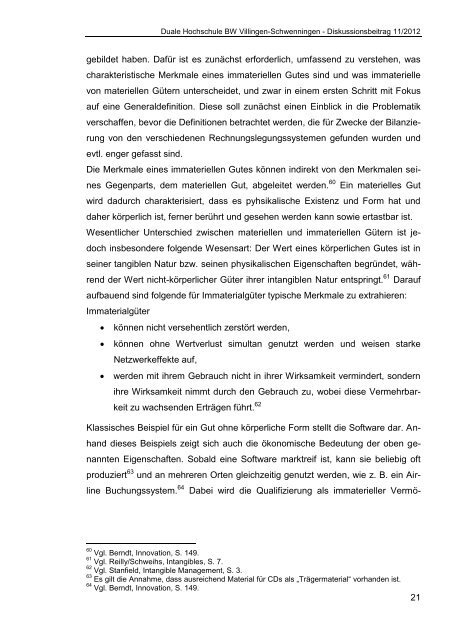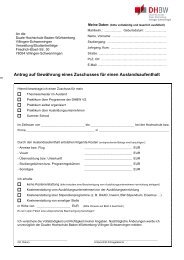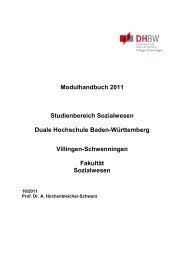Diskussionsbeiträge 11/2012 - DHBW Villingen-Schwenningen
Diskussionsbeiträge 11/2012 - DHBW Villingen-Schwenningen
Diskussionsbeiträge 11/2012 - DHBW Villingen-Schwenningen
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Duale Hochschule BW <strong>Villingen</strong>-<strong>Schwenningen</strong> - Diskussionsbeitrag <strong>11</strong>/<strong>2012</strong><br />
gebildet haben. Dafür ist es zunächst erforderlich, umfassend zu verstehen, was<br />
charakteristische Merkmale eines immateriellen Gutes sind und was immaterielle<br />
von materiellen Gütern unterscheidet, und zwar in einem ersten Schritt mit Fokus<br />
auf eine Generaldefinition. Diese soll zunächst einen Einblick in die Problematik<br />
verschaffen, bevor die Definitionen betrachtet werden, die für Zwecke der Bilanzie-<br />
rung von den verschiedenen Rechnungslegungssystemen gefunden wurden und<br />
evtl. enger gefasst sind.<br />
Die Merkmale eines immateriellen Gutes können indirekt von den Merkmalen sei-<br />
nes Gegenparts, dem materiellen Gut, abgeleitet werden. 60 Ein materielles Gut<br />
wird dadurch charakterisiert, dass es pyhsikalische Existenz und Form hat und<br />
daher körperlich ist, ferner berührt und gesehen werden kann sowie ertastbar ist.<br />
Wesentlicher Unterschied zwischen materiellen und immateriellen Gütern ist je-<br />
doch insbesondere folgende Wesensart: Der Wert eines körperlichen Gutes ist in<br />
seiner tangiblen Natur bzw. seinen physikalischen Eigenschaften begründet, wäh-<br />
rend der Wert nicht-körperlicher Güter ihrer intangiblen Natur entspringt. 61 Darauf<br />
aufbauend sind folgende für Immaterialgüter typische Merkmale zu extrahieren:<br />
Immaterialgüter<br />
� können nicht versehentlich zerstört werden,<br />
� können ohne Wertverlust simultan genutzt werden und weisen starke<br />
Netzwerkeffekte auf,<br />
� werden mit ihrem Gebrauch nicht in ihrer Wirksamkeit vermindert, sondern<br />
ihre Wirksamkeit nimmt durch den Gebrauch zu, wobei diese Vermehrbar-<br />
keit zu wachsenden Erträgen führt. 62<br />
Klassisches Beispiel für ein Gut ohne körperliche Form stellt die Software dar. An-<br />
hand dieses Beispiels zeigt sich auch die ökonomische Bedeutung der oben ge-<br />
nannten Eigenschaften. Sobald eine Software marktreif ist, kann sie beliebig oft<br />
produziert 63 und an mehreren Orten gleichzeitig genutzt werden, wie z. B. ein Air-<br />
line Buchungssystem. 64 Dabei wird die Qualifizierung als immaterieller Vermö-<br />
60 Vgl. Berndt, Innovation, S. 149.<br />
61 Vgl. Reilly/Schweihs, Intangibles, S. 7.<br />
62 Vgl. Stanfield, Intangible Management, S. 3.<br />
63 Es gilt die Annahme, dass ausreichend Material für CDs als „Trägermaterial“ vorhanden ist.<br />
64 Vgl. Berndt, Innovation, S. 149.<br />
21