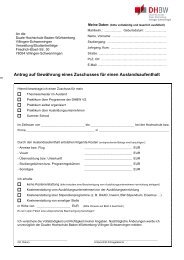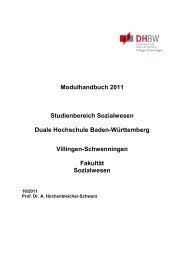Diskussionsbeiträge 11/2012 - DHBW Villingen-Schwenningen
Diskussionsbeiträge 11/2012 - DHBW Villingen-Schwenningen
Diskussionsbeiträge 11/2012 - DHBW Villingen-Schwenningen
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Duale Hochschule BW <strong>Villingen</strong>-<strong>Schwenningen</strong> - Diskussionsbeitrag <strong>11</strong>/<strong>2012</strong><br />
Gem. § 247 Abs. 2 HGB gehören zum Anlagevermögen sämtliche Vermögensge-<br />
genstände, deren Bestimmung es ist, dem Geschäftsbetrieb dauerhaft zu die-<br />
nen. <strong>11</strong>4 Somit wird bei der Gliederung der Bilanz auf die Zweckbestimmung von<br />
Vermögensgegenständen abgestellt: Generell zählen zu den Vermögensgegen-<br />
ständen des Anlagevermögens Gebrauchsgüter, die mehrmals genutzt werden,<br />
während Verbrauchsgüter durch Einmalnutzung gekennzeichnet sind und zum<br />
Umlaufvermögen gehören. <strong>11</strong>5 In Ermangelung einer Legaldefinition für das Um-<br />
laufvermögen kann daher nur per Ausschlussverfahren eine Konkretisierung die-<br />
ses Begriffs erreicht werden: Das Umlaufvermögen umfasst daher sämtliche Ver-<br />
mögensgegen-stände, welche dem Geschäftsbetrieb weder dauerhaft dienen,<br />
noch einen Rechnungsabgrenzungsposten darstellen. <strong>11</strong>6<br />
Das Aktivierungswahlrecht des § 248 Abs. 2 HGB findet lediglich Anwendung auf<br />
immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, während für solche<br />
des Umlaufvermögens unverändert eine aus dem Vollständigkeitsgebot des § 246<br />
Abs. 1 HGB resultierende Aktivierungspflicht besteht. Die Frage, welche Norm<br />
einschlägig ist und ob ein immaterieller Vermögensgegenstand dem Anlage- oder<br />
Umlaufvermögen zuzuordnen ist, richtet sich lt. BFH-Urteil vom 20.09.1995 da-<br />
nach, unter welchen vertraglichen Bedingungen der Vermögensgegenstand ent-<br />
standen ist. Verpflichtet sich bspw. ein Filmproduzent dazu, einen Film zu entwi-<br />
ckeln und dem Auftraggeber sämtliche Schutzrechte an dem auftragsgemäß ent-<br />
wickelten Filmwerk endgültig zu überlassen, stellt dies eine Auftragsproduktion<br />
dar. Dabei ist ferner zwischen echter und unechter Auftragsproduktion zu unter-<br />
scheiden. Beruhen die Urheberrechte auf eigenen unternehmerischen Entschei-<br />
dungen des Filmproduzenten i. R. d. vertraglichen Vereinbarungen mit dem Auf-<br />
traggeber, liegt echte Auftragsproduktion vor. Die Schutzrechte sind in der Person<br />
des Filmproduzenten als Hersteller entstanden und bei ihm als Umlaufvermögen<br />
zu bilanzieren, da sie einen Vermögensgegenstand darstellen und nicht darauf<br />
ausgelegt sind, dauerhaft dem Geschäftsbetrieb zu dienen. Bei der unechten Auf-<br />
tragsproduktion trägt der Auftraggeber das Herstellungsrisiko und wird somit zum<br />
Hersteller, der Filmproduzent fungiert als bloßer Dienstleister und es entsteht bei<br />
ihm kein selbst geschaffener immaterieller Vermögensgegenstand. <strong>11</strong>7<br />
<strong>11</strong>4 Vgl. Laubach/Kraus/Bornhofen, HGB-Modernisierung durch das BilMoG, DB 2009, S. 21.<br />
<strong>11</strong>5 Vgl. Kahle/Dahlke, in: v. Wysocki/Schulze-Osterloh, HDJ, Abt. II/2, Rn. 1.<br />
<strong>11</strong>6 Vgl. Ellrott, in: Budde et al., Beck’scher Bilanzkommentar, § 247 Rn. 350ff.<br />
<strong>11</strong>7 Vgl. BFH v. 20.09.1995, BStBl II 1997, 320.<br />
35