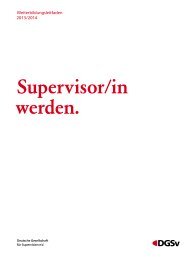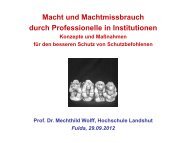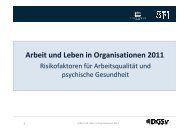Internationale Institutionen und nichtstaatliche Akteure
Internationale Institutionen und nichtstaatliche Akteure
Internationale Institutionen und nichtstaatliche Akteure
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Globale öffentliche Güter implizieren Konsuminterdependenz.<br />
Aber sie implizieren<br />
auch Politikinterdependenz: Sollten sich die<br />
Menschen in einem Land, beispielsweise in<br />
Deutschland, für eine dezidierte Reduktion<br />
von Treibhausgasen aussprechen, um der Erderwärmung<br />
entgegenzuwirken, dann könnten<br />
sie dieses Ziel nur erreichen, wenn alle anderen<br />
Staaten, vornehmlich die Hauptemittenten,<br />
sich ebenfalls zu einer solchen Reduktion<br />
der Gase verpflichten würden. Ähnliches<br />
gilt für viele andere globale Herausforderungen<br />
wie die Sicherheit der internationalen Zivilluftfahrt<br />
oder den internationalen Bankensektor:<br />
So ist es nur von begrenztem Nutzen,<br />
Bankenrisiken in lediglich einigen wenigen<br />
Ländern zu kontrollieren <strong>und</strong> nicht in allen<br />
relevanten Märkten, da beispielsweise ein<br />
Verbot von Leerverkäufen in einem Land zu<br />
einem Anstieg von Leerverkäufen in einem<br />
anderen Land führen kann.<br />
Globale öffentliche Güter verlangen oft<br />
nach einem multilateralen Politikansatz, oder<br />
anders formuliert, einer Harmonisierung nationaler<br />
Politikmaßnahmen. Dies bedarf internationaler<br />
Abkommen, welche den nationalen<br />
Interessen der einzelnen Staaten gerecht<br />
werden. Da die „Institution Staat“ auf internationaler<br />
Ebene kein vollwertiges Äquivalent<br />
besitzt, muss sich internationale Kooperation<br />
weitgehend auf freiwilliger Basis<br />
vollziehen <strong>und</strong> dementsprechend auch die Interessen<br />
aller betroffenen Staaten berücksichtigen.<br />
Kooperation muss aus Sicht der jeweiligen<br />
Nationalstaaten Sinn ergeben <strong>und</strong> sich<br />
lohnen. Aber an eben dieser Einsicht – dass<br />
internationale Kooperation Sinn ergibt <strong>und</strong><br />
mittlerweile unumgänglich ist – hapert es<br />
eben oft noch.<br />
Bisherige Politikantwort:<br />
Wandel unter dem Druck von Krisen<br />
Die Tatsache, dass viele Probleme <strong>und</strong> Herausforderungen<br />
heute globaler Art sind <strong>und</strong><br />
mithin nach effektiver multilateraler Kooperation<br />
verlangen, ist nicht unbemerkt geblieben.<br />
Selbst Vertreter der stärksten Weltmacht<br />
USA, wie Präsident Barack Obama, erkennen<br />
dieses Faktum der Politikinterdependenz an.<br />
Die Suche nach neuen Politikansätzen hat begonnen.<br />
Doch sie wird oft nur dann vorangetrieben,<br />
wenn sich eine akute Krisensituation<br />
ergibt, <strong>und</strong> sie wird rasch wieder vergessen,<br />
wenn die Kriseneffekte verebben – oder die<br />
nächste Krise ins politische <strong>und</strong> mediale<br />
Rampenlicht tritt.<br />
Da die meisten multilateralen Entscheidungen<br />
auch weiterhin unverbindlicher Art<br />
sind, gibt es etliche multilaterale Stellungnahmen<br />
zu den globalen Zielen, welche die<br />
internationale Gemeinschaft gerne erreichen<br />
würde – Frieden, Sicherheit, Nachhaltigkeit,<br />
Halbierung der globalen Armut bis 2015 <strong>und</strong><br />
vieles anderes. Aber die Umsetzung solcher<br />
Zielvorstellungen vollzieht sich nur zögernd.<br />
Nur ein Bruchteil der Ressourcen, die national<br />
<strong>und</strong> international zur Verfügung stehen<br />
müssten, wird tatsächlich bereitgestellt. Die<br />
Gelder für Entwicklungszusammenarbeit<br />
haben nicht einmal die Hälfte des angekündigten<br />
Niveaus von 0,7 Prozent des Bruttoinlandsproduktes<br />
der Geberländer erreicht<br />
<strong>und</strong> werden dies aufgr<strong>und</strong> der gegenwärtigen<br />
Finanz- <strong>und</strong> Wirtschaftskrise wohl auch<br />
nicht sehr bald tun. Das Auseinanderklaffen<br />
von multilateralen Politikzielen <strong>und</strong> tatsächlichem<br />
Handeln hat sich auch auf der Klimakonferenz<br />
in Kopenhagen Ende 2009 gezeigt.<br />
Aber solche Diskrepanzen tauchen nicht nur<br />
auf, wenn es um finanzielle Aspekte der internationalen<br />
Zusammenarbeit geht, sondern<br />
auch bei der Übernahme politischer Kosten,<br />
die sich zum Beispiel bei der Bekämpfung<br />
von Korruption, der Limitierung von Treibhausgasen<br />
oder der Erhebung einer Finanztransaktionssteuer<br />
ergeben könnten.<br />
Der Gr<strong>und</strong> dafür ist ein Verhalten, das in<br />
der Ökonomie als „Trittbrettfahren“ bezeichnet<br />
wird <strong>und</strong> häufig im Zusammenhang mit<br />
öffentlichen Gütern zu beobachten ist: Weil<br />
öffentliche Güter eben für alle da sind, neigen<br />
private <strong>Akteure</strong> dazu, anderen bei der Bereitstellung<br />
dieser Güter den Vortritt zu lassen,<br />
sprich, ihnen die Bezahlung zu überlassen,<br />
wohl wissend, dass, wenn das Gut zur Verfügung<br />
steht, es auch für sie da ist – kostenlos.<br />
Staaten verhalten sich wie Privatakteure:<br />
Auch sie unterliegen nur allzu oft, wie die<br />
heutige zunehmende Krisenhäufigkeit zeigt,<br />
der Versuchung des Trittbrettfahrens, des<br />
easy riding. Dabei spielen freilich auch andere<br />
Faktoren eine Rolle: Manche Staaten werden<br />
nicht die notwendigen Mittel oder Kapazitäten<br />
zur Bereitstellung des öffentlichen Gutes<br />
haben; in anderen Fällen kann mangelndes<br />
gegenseitiges Vertrauen dafür verantwortlich<br />
sein, dass alle warten, bis der jeweils an-<br />
APuZ 34–35/2010 35