Realisierbarkeit und Beurteilung ästhetischer Klangkonzepte bei ...
Realisierbarkeit und Beurteilung ästhetischer Klangkonzepte bei ...
Realisierbarkeit und Beurteilung ästhetischer Klangkonzepte bei ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
” Gehörgänge – Zur Ästhetik der musikalischen Aufführung <strong>und</strong> ihrer technischen Reproduktion“<br />
in ihrem Vorwort, worin sie bemerken, dass seit Einführung der Langspiel-<br />
”<br />
platte keine nennenswerte ästhetische Debatte stattgef<strong>und</strong>en hat“. 6 Dafür mag es neben<br />
der fehlenden eindeutigen Zuordnung zu einer Wissenschaft noch weitere Gründe geben.<br />
Zum einen muss man anmerken, dass <strong>bei</strong>m Tonträger oft ökonomische Interessen im<br />
Vordergr<strong>und</strong> stehen. Wenn sich eine Aufnahme nicht gut genug verkauft, rechnet sich<br />
der große personelle <strong>und</strong> technische Aufwand, der betrieben werden muss, nicht. Deshalb<br />
wird vor einer CD-Produktion vor allem über das Repertoire oder den Künstler diskutiert,<br />
da diese für die Vermarktung einen höheren Werbewert haben als der Klang. Nur<br />
<strong>bei</strong> sogenannten audiophilen Labels kann man mit Darstellungen des Klanges eine spezielle<br />
Gruppe von Käufern erreichen. Es ist anzunehmen, dass in der Allgemeinheit das<br />
Bewußtsein dafür fehlt, dass nicht allein der Inhalt den Erfolg einer Platte bestimmt,<br />
sondern auch, wie deren Inhalt transportiert wird. Dieses Phänomen beschreibt Gidi<br />
Boss (1994) [2] in seiner Untersuchung ” Das Medium ist die Botschaft“, in der er nachweist,<br />
dass die Aufnahme derselben Musik mit unterschiedlichen technischen Bedingungen<br />
sehr unterschiedliche Urteile hervorrufen kann. Hier<strong>bei</strong> ist besonders bemerkenswert,<br />
dass die Veränderung der reinen Aufnahmetechnik das musikalische Urteil über die Aufnahme<br />
signifikant verändert. Das Bewusstsein dafür, wie sehr der musikalische Inhalt<br />
einer Einspielung also durch die klangliche Einflussnahme des Tonmeisters verändert<br />
werden kann, findet <strong>bei</strong> der Vermarktung einer CD keine Beachtung.<br />
Daraus ist abzuleiten, dass eine Musikaufnahme nicht wie <strong>bei</strong>spielsweise die Fotografie<br />
oder der Film als Kunstform angesehen wird. Diese <strong>bei</strong>den haben ebenfalls die Abbildung<br />
von Wirklichkeit zum Inhalt, <strong>bei</strong> ihnen wird aber erwartet, dass sie, <strong>bei</strong>spielsweise<br />
durch die Wahl von Ausschnitten oder Manipulation, ein künstlerisches Endprodukt<br />
schaffen, was über die bloße Abbildung hinausgeht. Es ist dem Betrachter anscheinend<br />
bewusst, dass der Fotograf oder Regisseur durch seine Kreativität Einfluss auf das abgebildete<br />
Objekt nimmt. Bei einer Aufnahme hingegen herrscht oft der Anspruch, sie<br />
solle nur die Dokumentation eines musikalischen Ereignisses zum Inhalt haben <strong>und</strong> somit<br />
ein Klangereignis möglichst naturgetreu abbilden. Unter dieser Prämisse erübrigt<br />
sich eine klangästhetische Debatte. Denn wenn allein die Authentizität einer Aufnahme<br />
deren höchster Anspruch ist, bleibt kein Raum für weitere klangliche Einflussnahme.<br />
Außerdem <strong>bei</strong>nhaltet der Begriff ” Naturtreue“ eine Art idealisierte Vorstellung, nach der<br />
ein naturgetreuer Klang eine perfekte Balance der Instrumente, eine ideale, ungefärbte<br />
Klangfarbe <strong>und</strong> eine reine, menschliche Spielweise umfasst. Seinen Ursprung hat diese<br />
Vorstellung im romantischen Naturbegriff. Dieser <strong>bei</strong>nhaltet, dass die Natur alles umfasst,<br />
was nicht vom Menschen durchdrungen <strong>und</strong>, im Gegensatz zur vom Menschen<br />
geschaffenen Technik, von sich aus gut <strong>und</strong> rein ist. Zur Debatte der Naturtreue findet<br />
man einige Veröffentlichungen wie z. B. von Reinecke (1969) [24] <strong>und</strong> Rzehulka (1986)<br />
[25]. Beide beschreiben den Begriff ” Naturtreue“ eher in seinem historischen Zusammenhang<br />
<strong>und</strong> beleuchten ihn da<strong>bei</strong> durchaus kritisch.<br />
6 Fischer, Holland, Rzehulka, S. 7 (1986) [5], [12], [25]<br />
7


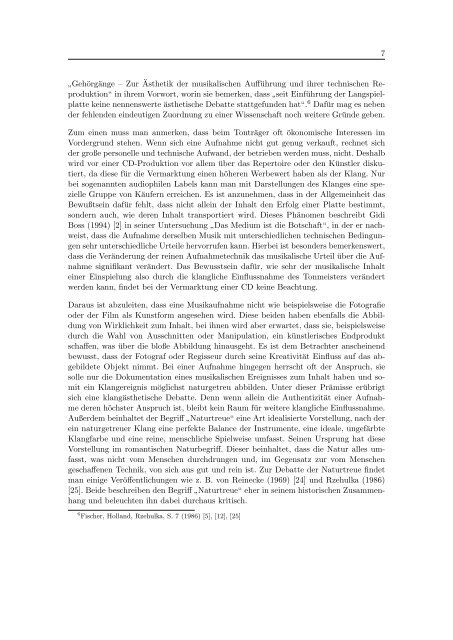
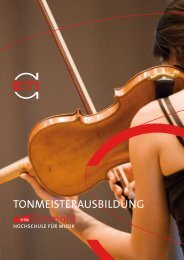







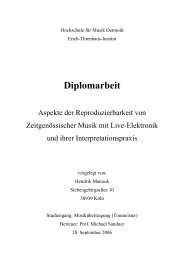
![[Teil 3] Hörversuch - Erich-Thienhaus-Institut - Hochschule für Musik ...](https://img.yumpu.com/7220535/1/184x260/teil-3-horversuch-erich-thienhaus-institut-hochschule-fur-musik-.jpg?quality=85)



