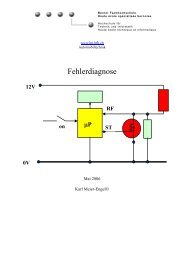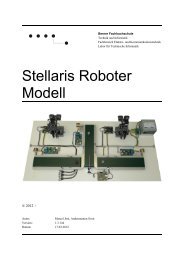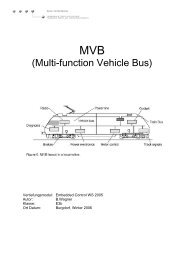Geometrische Optik
Geometrische Optik
Geometrische Optik
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
HTI Biel - Mikrotechnik <strong>Geometrische</strong> <strong>Optik</strong> - 6 / 27<br />
1.4. Optische Weglänge<br />
Gegeben sind die zwei Punkte P und Q im homogenen Medium mit dem<br />
Brechindex n. Die aufgewendete Zeit des Lichtes um von P zu Q zu gelangen<br />
misst:<br />
�___________________________________________________________<br />
1.5. Fermatsches Prinzip<br />
n: Brechindex [-]<br />
L: <strong>Geometrische</strong> Weglänge zwischen P und Q<br />
Das Licht breitet sich zwischen zwei Punkten (P-Q) auf dem Weg mit<br />
der kleinsten Laufzeit aus. In Wirklichkeit zählt nicht der geometrische<br />
Weg, sondern der optische Weg. Somit gilt: Ein Lichtstrahl folgt demjenigen<br />
Weg, der dem kürzesten optischen Weg entspricht.<br />
1.6. Umkehrprinzip des Lichtes<br />
Der Weg, der das Licht beschreitet um von P zu Q zu gelangen ist derselbe<br />
Weg, den ein Lichtstrahl benutzt um von Q zu B zu gelangen. In<br />
der geometrischen <strong>Optik</strong> hat das Vorzeichen des Richtungspfeils nur<br />
selten eine Bedeutung.<br />
1.7. Optische Abbildung<br />
1.7.1. Lochkamera<br />
Die Eigenschaften der geradlinigen Ausbreitung des Lichtes ist bei der<br />
Lochkamera sichtbar. Sie ist mit einer kleinen Öffnung S versehen, wo<br />
die Lichtstrahlen von den verschiedenen Punkten des Gegenstandes (A)<br />
durchtreten und auf der Rückwand E auftreffen (A'). So erhält man ein<br />
grobes Bild von einem Gegenstand der genügend leuchtet oder genügend<br />
beleuchtet wird. Nur einen Teil des Lichtbündels ausgehend von<br />
den verschiedenen Punkten des Gegenstandes tritt durch die Öffnung S und formt eine sichtbare Spur<br />
(Bild) auf der Rückwand E. Wie aus der Strahlengeometrie ersichtlich ist, sind die Bildpunkte grösser als<br />
S und überdecken sich gegenseitig. Je kleiner S gewählt wird, desto kleiner werden die Bildpunkte. Die<br />
Öffnung S kann aber nicht beliebig verkleinert werden, weil gleichzeitig die Lichtstärke auf der Rückwand<br />
abnimmt und das Problem der Diffraktion auftritt. Für gute und lichtstarke Abbildungen sind aber<br />
Linsen oder ganze "optische Systeme" erforderlich.<br />
© C. Meier / L. Müller, Dozenten für Physik BFH / HTI Biel [V 3.0]