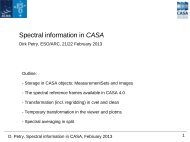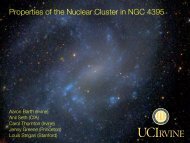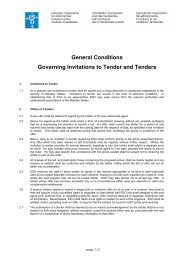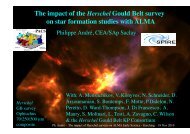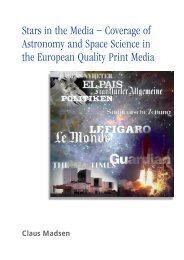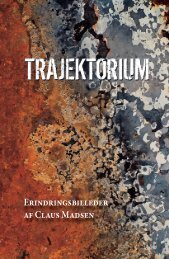Einführung in die Spektroskopie für Amateure - ESO
Einführung in die Spektroskopie für Amateure - ESO
Einführung in die Spektroskopie für Amateure - ESO
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
KAPITEL 5. OBJEKTE 41<br />
Die Spektren der PN<br />
Im Vergleich zu den bekannteren Absorptionsl<strong>in</strong>ienspektren von Sternen bestehen <strong>die</strong><br />
Objektivprismenspektren der PN aus kettenartig ane<strong>in</strong>andergereihten, monochromatischen<br />
Nebelbildern. Dabei wird das Licht nur bei wenigen Wellenlängen emittiert.<br />
Die Spektren der Hülle und des Zentralsterns s<strong>in</strong>d stets überlagert. Die <strong>in</strong>tensivsten<br />
Emissionen im sichtbaren Bereich liegen den Elementen H, He, O, Ne, aber auch<br />
C und N zugrunde. Im Vergleich zur sonstigen kosmischen Elementenhäufigkeit ist<br />
bei PN das He überproportional häufig [WZ77]. Neben L<strong>in</strong>ienemissionen s<strong>in</strong>d <strong>in</strong> den<br />
Nebelspektren auch kont<strong>in</strong>uierliche Lichtanteile sichtbar. Diese re-sultieren je nach<br />
Spektralbereich teilweise vom Zentralstern, aber auch aus frei-freien Übergängen (<br />
Bremsstrahlung ) bzw. frei-gebundenen Übergängen. Pr<strong>in</strong>zipiell kann <strong>die</strong> Anregung<br />
wie folgt beschrieben werden: Der sehr heiße Zentralstern sendet aufgrund se<strong>in</strong>er hohen<br />
Temperatur harte UV-Strahlung aus, welche <strong>die</strong> Hülle zum Leuchten anregt. Durch<br />
Rekomb<strong>in</strong>ations- und Fluoreszenzmechanismen wird <strong>die</strong>se kurzwellige Strahlung <strong>in</strong><br />
der Hülle <strong>in</strong> sichtbares Licht umgewandelt. Die Zuordnung der Emissionen <strong>in</strong> den PN<br />
zu den entsprechenden Elementen gestaltete sich anfangs problematisch, was nicht zuletzt<br />
dazu führte, daß <strong>für</strong> <strong>die</strong> sehr <strong>in</strong>tensiven grünen Sauerstoffl<strong>in</strong>ien bei ca. 5000 Å, deren<br />
Licht <strong>die</strong> Nebel <strong>in</strong> bestimmten Bereichen grün ersche<strong>in</strong>en läßt, zunächst e<strong>in</strong> neues<br />
chemisches Element, das „Nebulium“, postuliert wurde. Daher s<strong>in</strong>d <strong>die</strong>se L<strong>in</strong>ien heute<br />
oft noch als N1 und N2 bezeichnet, was jedoch nichts mit dem Element Stickstoff<br />
zu tun hat. Die richtige Zuordnung zum Element Sauerstoff wurde deshalb so spät erkannt,<br />
weil es sich hier, wie oft bei PN, um verbotene L<strong>in</strong>ien handelt. Diese L<strong>in</strong>ien<br />
treten wegen der sehr ger<strong>in</strong>gen übergangswahrsche<strong>in</strong>lichkeit unter irdischen Normalbed<strong>in</strong>gungennicht<br />
auf und gelten deshalb als verboten. Man erkennt sie an der Angabe<br />
<strong>in</strong> eckigen Klammern, z.B. [O III]. Als Anregungsmechanismus <strong>für</strong> <strong>die</strong>se L<strong>in</strong>ien<br />
wird <strong>in</strong> der Literatur hauptsächlich Elektronenstoß diskutiert [Wur51]. Die Anregung<br />
der verbotenen L<strong>in</strong>ien ist an sehr ger<strong>in</strong>ge Materiedichten gebunden, welche dem irdischen<br />
Hochvakuum entsprechen. Diese ger<strong>in</strong>ge Materiedichte ermöglicht e<strong>in</strong>e lange<br />
Verweildauer ( 1 - 10 s ) von Elektronen auf sogenannten metastabilen Energieniveaus,<br />
<strong>die</strong> sich energetisch knapp über dem Grundzustand bef<strong>in</strong>den. Die Verweildauer<br />
der Elektronen bei normalen übergängen liegt im Bereich von 10� 8 s. Die sehr hohe<br />
Intensität der verbotenen [O III] - L<strong>in</strong>ien wird zum e<strong>in</strong>en durch <strong>die</strong> große Ausdehnung<br />
der sie erzeugenden Regionen (50 - 80% der Nebelmasse), zum anderen aber<br />
auch durch <strong>die</strong> gleichzeitig relativ ger<strong>in</strong>ge Intensität der erlaubten L<strong>in</strong>ien verursacht<br />
[Wur51]. Die Anregung bzw. das Ersche<strong>in</strong>en der verbotenen L<strong>in</strong>ien <strong>in</strong> PN und anderen<br />
Gasnebeln, wie z.B. den H II-Gebieten, stellt e<strong>in</strong>e bemerkenswerte physikalische<br />
und chemische Besonderheit dar. Der <strong>für</strong> das Entstehen wichtiger L<strong>in</strong>ien und Kont<strong>in</strong>ua<br />
<strong>in</strong> PN verantwortliche Anregungsmechanismus wird aus e<strong>in</strong>er <strong>in</strong> [Kal94] dargestellten<br />
und hier leicht abgewandelten Darstellung Abb. 5.27 deutlich.<br />
Spektroskopisch betrachtet gibt es durchaus Geme<strong>in</strong>samkeiten zwischen den H<br />
II-Gebieten ( wie z.B. dem Orionnebel ) und den PN, obgleich erstere entwicklungsgeschichtlich<br />
der Sternentstehung, <strong>die</strong> PN jedoch e<strong>in</strong>er späteren Entwicklungsphase<br />
des Sterns zugeordnet werden. In beiden Fällen wird Gas durch heiße Sterne zum<br />
Leuchten angeregt. Da <strong>die</strong> Zentralsterntemperaturen der PN <strong>die</strong> der anregenden Sterne<br />
der H II-Gebiete noch übertreffen, kann man bei den PN höhere Anregungs- und<br />
Ionisierungszustände als <strong>in</strong> den H II-Gebieten erwarten.