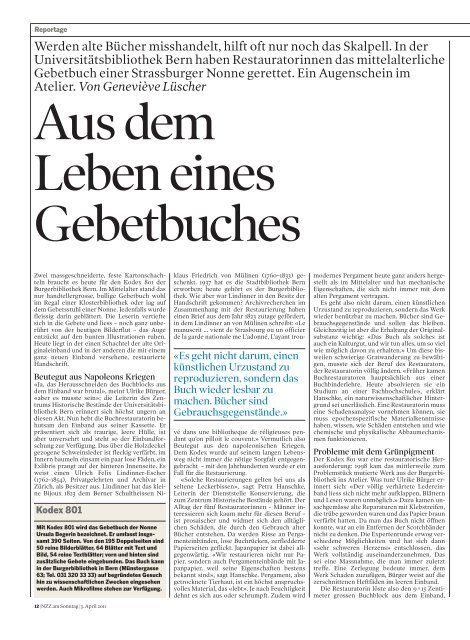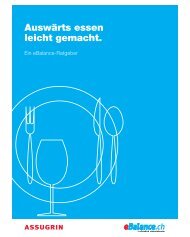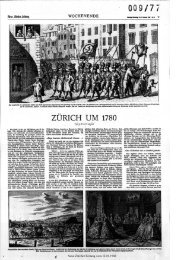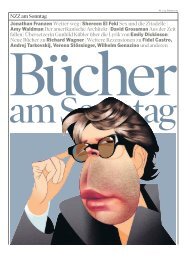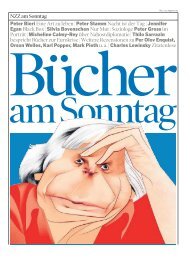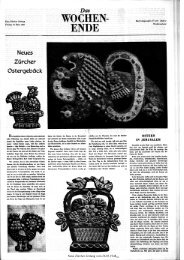Salman Rushdie Luka und das Lebensfeuer - Neue Zürcher Zeitung
Salman Rushdie Luka und das Lebensfeuer - Neue Zürcher Zeitung
Salman Rushdie Luka und das Lebensfeuer - Neue Zürcher Zeitung
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Reportage<br />
Werden alte Bücher misshandelt, hilft oft nur noch <strong>das</strong> Skalpell. In der<br />
Universitätsbibliothek Bern haben Restauratorinnen <strong>das</strong> mittelalterliche<br />
Gebetbuch einer Strassburger Nonne gerettet. Ein Augenschein im<br />
Atelier. Von Geneviève Lüscher<br />
Aus dem<br />
Leben eines<br />
Gebetbuches<br />
Zwei massgeschneiderte, feste Kartonschachteln<br />
braucht es heute für den Kodex 801 der<br />
Burgerbibliothek Bern. Im Mittelalter stand <strong>das</strong><br />
nur handtellergrosse, bullige Gebetbuch wohl<br />
im Regal einer Klosterbibliothek oder lag auf<br />
dem Gebetsstuhl einer Nonne. Jedenfalls wurde<br />
fleissig darin geblättert. Die Leserin vertiefte<br />
sich in die Gebete <strong>und</strong> liess – noch ganz unberührt<br />
von der heutigen Bilderflut – <strong>das</strong> Auge<br />
entzückt auf den bunten Illustrationen ruhen.<br />
Heute liegt in der einen Schachtel der alte Originaleinband<br />
<strong>und</strong> in der anderen die mit einem<br />
ganz neuen Einband versehene, restaurierte<br />
Handschrift.<br />
Beutegut aus Napoleons Kriegen<br />
«Ja, <strong>das</strong> Herausschneiden des Buchblocks aus<br />
dem Einband war brutal», meint Ulrike Bürger,<br />
«aber es musste sein»; die Leiterin des Zentrums<br />
Historische Bestände der Universitätsbibliothek<br />
Bern erinnert sich höchst ungern an<br />
diesen Akt. Nun hebt die Buchrestauratorin behutsam<br />
den Einband aus seiner Kassette. Er<br />
präsentiert sich als traurige, leere Hülle, ist<br />
aber unversehrt <strong>und</strong> steht so der Einbandforschung<br />
zur Verfügung. Das über die Holzdeckel<br />
gezogene Schweinsleder ist fleckig verfärbt, im<br />
Innern baumeln einsam ein paar lose Fäden, ein<br />
Exlibris prangt auf der hinteren Innenseite. Es<br />
weist einen Ulrich Felix LindinnerEscher<br />
(1762–1854), Privatgelehrten <strong>und</strong> Archivar in<br />
Zürich, als Besitzer aus. Lindinner hat <strong>das</strong> kleine<br />
Bijoux 1823 dem Berner Schultheissen Ni<br />
Kodex 801<br />
Mit Kodex 801 wird <strong>das</strong> Gebetbuch der Nonne<br />
Ursula Begerin bezeichnet. Er umfasst insgesamt<br />
390 Seiten. Von den 195 Doppelseiten sind<br />
50 reine Bilderblätter, 64 Blätter mit Text <strong>und</strong><br />
Bild, 54 reine Textblätter; vorn <strong>und</strong> hinten sind<br />
zusätzliche Gebete eingeb<strong>und</strong>en. Das Buch kann<br />
in der Burgerbibliothek in Bern (Münstergasse<br />
63; Tel. 031 320 33 33) auf begründetes Gesuch<br />
hin zu wissenschaftlichen Zwecken eingesehen<br />
werden. Auch Mikrofilme stehen zur Verfügung.<br />
12 ❘ NZZ am Sonntag ❘ 3. April 2011<br />
klaus Friedrich von Mülinen (1760–1833) geschenkt.<br />
1937 hat es die Stadtbibliothek Bern<br />
erworben; heute gehört es der Burgerbibliothek.<br />
Wie aber war Lindinner in den Besitz der<br />
Handschrift gekommen? Archivrecherchen im<br />
Zusammenhang mit der Restaurierung haben<br />
einen Brief aus dem Jahr 1823 zutage gefördert,<br />
in dem Lindinner an von Mülinen schreibt: «Le<br />
manuscrit ... vient de Strasbourg ou un officier<br />
de la garde nationale me L’adonné, L’ayant trou<br />
«Es geht nicht darum, einen<br />
künstlichen Urzustand zu<br />
reproduzieren, sondern <strong>das</strong><br />
Buch wieder lesbar zu<br />
machen. Bücher sind<br />
Gebrauchsgegenstände.»<br />
vé dans une bibliotheque de réligieuses pendant<br />
qu’on pilloit le couvent.» Vermutlich also<br />
Beutegut aus den napoleonischen Kriegen.<br />
Dem Kodex wurde auf seinem langen Lebensweg<br />
nicht immer die nötige Sorgfalt entgegengebracht<br />
– mit den Jahrh<strong>und</strong>erten wurde er ein<br />
Fall für die Restaurierung.<br />
«Solche Restaurierungen gelten bei uns als<br />
seltene Leckerbissen», sagt Petra Hanschke,<br />
Leiterin der Dienststelle Konservierung, die<br />
zum Zentrum Historische Bestände gehört. Der<br />
Alltag der fünf Restauratorinnen – Männer interessieren<br />
sich kaum mehr für diesen Beruf –<br />
ist prosaischer <strong>und</strong> widmet sich den alltäglichen<br />
Schäden, die durch den Gebrauch alter<br />
Bücher entstehen. Da werden Risse an Pergamenteinbänden,<br />
lose Buchrücken, zerfledderte<br />
Papierseiten geflickt. Japanpapier ist dabei allgegenwärtig.<br />
«Wir restaurieren nicht nur Papier,<br />
sondern auch Pergamenteinbände mit Japanpapier,<br />
weil seine Eigenschaften bestens<br />
bekannt sind», sagt Hanschke. Pergament, also<br />
getrocknete Tierhaut, ist ein höchst anspruchsvolles<br />
Material, <strong>das</strong> «lebt». Je nach Feuchtigkeit<br />
dehnt es sich aus oder schrumpft. Zudem wird<br />
modernes Pergament heute ganz anders hergestellt<br />
als im Mittelalter <strong>und</strong> hat mechanische<br />
Eigenschaften, die sich nicht immer mit dem<br />
alten Pergament vertragen.<br />
Es geht also nicht darum, einen künstlichen<br />
Urzustand zu reproduzieren, sondern <strong>das</strong> Werk<br />
wieder benützbar zu machen. Bücher sind Gebrauchsgegenstände<br />
<strong>und</strong> sollen <strong>das</strong> bleiben.<br />
Gleichzeitig ist aber die Erhaltung der Originalsubstanz<br />
wichtig: «Das Buch als solches ist<br />
auch ein Kulturgut, <strong>und</strong> wir tun alles, um so viel<br />
wie möglich davon zu erhalten.» Um diese bisweilen<br />
schwierige Gratwanderung zu bewältigen,<br />
musste sich der Beruf des Restaurators,<br />
der Restauratorin völlig ändern. «Früher kamen<br />
Buchrestauratoren hauptsächlich aus einer<br />
Buchbinderlehre. Heute absolvieren sie ein<br />
Studium an einer Fachhochschule», erklärt<br />
Hanschke, ein naturwissenschaftlicher Hintergr<strong>und</strong><br />
sei unerlässlich. Eine Restauratorin muss<br />
eine Schadensanalyse vornehmen können, sie<br />
muss epochenspezifische Materialkenntnisse<br />
haben, wissen, wie Schäden entstehen <strong>und</strong> wie<br />
chemische <strong>und</strong> physikalische Abbaumechanismen<br />
funktionieren.<br />
Probleme mit dem Grünpigment<br />
Der Kodex 801 war eine restauratorische Herausforderung:<br />
1998 kam <strong>das</strong> mittlerweile zum<br />
Problemstück mutierte Werk aus der Burgerbibliothek<br />
ins Atelier. Was tun? Ulrike Bürger erinnert<br />
sich: «Der völlig verhärtete Ledereinband<br />
liess sich nicht mehr aufklappen, Blättern<br />
<strong>und</strong> Lesen waren unmöglich.» Dazu kamen unsachgemässe<br />
alte Reparaturen mit Klebstreifen,<br />
die trübe geworden waren <strong>und</strong> <strong>das</strong> Papier braun<br />
verfärbt hatten. Da man <strong>das</strong> Buch nicht öffnen<br />
konnte, war an ein Entfernen der Scotchbänder<br />
nicht zu denken. Die Expertenr<strong>und</strong>e erwog verschiedene<br />
Möglichkeiten <strong>und</strong> hat sich dann<br />
«sehr schweren Herzens» entschlossen, <strong>das</strong><br />
Werk vollständig auseinanderzunehmen. Das<br />
sei eine Massnahme, die man immer zuletzt<br />
treffe. Eine Zerlegung bedeute immer, dem<br />
Werk Schaden zuzufügen, Bürger weist auf die<br />
zerschnittenen Heftfäden im leeren Einband.<br />
Die Restauratorin löste also den 9 × 15 Zentimeter<br />
grossen Buchblock aus dem Einband,