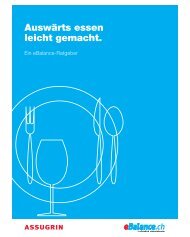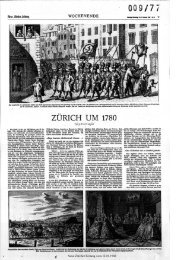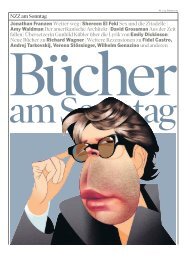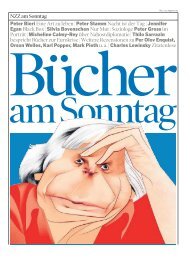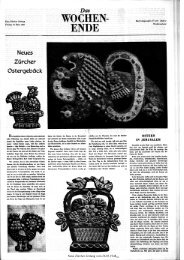Salman Rushdie Luka und das Lebensfeuer - Neue Zürcher Zeitung
Salman Rushdie Luka und das Lebensfeuer - Neue Zürcher Zeitung
Salman Rushdie Luka und das Lebensfeuer - Neue Zürcher Zeitung
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Reportage<br />
Japanpapier, Pinsel <strong>und</strong> Skalpell – Werkzeuge der Restauratorin.<br />
schnitt die Heftfäden auf, trennte die einzelnen<br />
Lagen <strong>und</strong> breitete die losen Papierseiten aus.<br />
Jetzt konnte sie jedes Blatt einzeln von den<br />
spröden Klebstreifen befreien, reinigen <strong>und</strong><br />
wenn nötig mit Japanpapier ergänzen. Einige<br />
Seiten, so zum Beispiel diejenige mit dem Bild<br />
«Maria Himmelfahrt», waren stark abgegriffen.<br />
Offenbar waren sie über Gebühr beansprucht<br />
worden. Bei anderen Heiligen, die anscheinend<br />
nicht so beliebt waren, strahlten die Farben<br />
noch wie neu.<br />
Nach den Scotchbändern war die grüne Malfarbe<br />
<strong>das</strong> zweitgrösste Problem. Unter dem<br />
Grün war <strong>das</strong> Papier hauchdünn geworden<br />
oder sogar weggebröselt. Es war aber nicht der<br />
gut bekannte <strong>und</strong> häufige Kupferfrass, sondern<br />
ein unbekanntes Phänomen. Mit kriminalistischen<br />
Methoden versuchten die Restauratorinnen<br />
herauszufinden, um welches Grünpigment<br />
es sich da handeln könnte. «Wir nahmen Kontakt<br />
auf mit Spezialisten in Bern, Zürich, Stuttgart,<br />
Wien, Brüssel – ohne Erfolg. Das Pigment<br />
war zu stark abgebaut, um es noch zu identifizieren.<br />
Immerhin haben wir eine neue Art von<br />
Grünschaden dokumentieren können, <strong>das</strong> ist<br />
wissenschaftlich interessant.»<br />
Buchbinder-Geheimnisse<br />
Parallel zur Restaurierung lief die sogenannte<br />
kodikologische Recherche, <strong>das</strong> heisst, Bürger<br />
suchte nach Spuren der Buchherstellung. Schon<br />
frühere Bearbeiter hatten nämlich erkannt, <strong>das</strong>s<br />
die Bilder älter sind als der Text. Sie stammen<br />
aus dem Ende des 14. Jahrh<strong>und</strong>erts, während<br />
die in deutscher Sprache verfassten Gebete<br />
h<strong>und</strong>ert Jahre jünger sind.<br />
Im Mittelalter musste der Buchbinder wissen,<br />
welche Doppelblätter er hintereinander zu<br />
binden hatte. Um die richtige Reihenfolge einzuhalten,<br />
versah er die Blätter im Falz mit winzigen<br />
Signaturen. Diese geben heute Hinweise<br />
auf die ursprüngliche Anzahl der Federzeichnungen,<br />
nämlich um 200. Die kodikologische<br />
Recherche zeigte, <strong>das</strong>s im 15. Jahrh<strong>und</strong>ert ein<br />
r<strong>und</strong> h<strong>und</strong>ertjähriger Bilderzyklus mit Gebeten<br />
versehen worden war: Leere Seiten wurden beschrieben,<br />
weitere Texte auf zusätzlichen Blät<br />
Das Energieproblem ist gelöst<br />
Wenn man <strong>das</strong>, was in diesem Buch steht,<br />
realisieren würde, könnte man die Atomkraftwerke<br />
abstellen.<br />
10CEXKoQ6AMAxF0S-ieW9dy0YlmVsQBD9D0Py_gmAQ15zc3sMEX2vbjrYHgWwTVWdH0Ewq_MUspaSAMieQCz2rkcnivwdYXaGDcp_XA5QNn45aAAAA<br />
Einsteins Irrtum, Pyramis-Verlag AG<br />
Harald Hahn, ISBN 3-9523013-0-2<br />
Vorzugspreis Fr.25.- statt 39.- bei Bestellung<br />
Fax: 056 621 05 76<br />
Mail: distribution@pyramis-verlag.ch<br />
14 ❘ NZZ am Sonntag ❘ 3. April 2011<br />
10CAsNsjY0MDAx1TU0NjY3MwAA6zBP1g8AAAA=<br />
tern eingefügt. Alles zusammen wurde dann<br />
wieder zu einem Buch geb<strong>und</strong>en. Aufgr<strong>und</strong><br />
fehlender Signaturen hat Bürger festgestellt,<br />
<strong>das</strong>s vor dem Binden um die 30 Bilder verlorengegangen<br />
sind. Auch wurden einige Seiten<br />
falsch placiert. «Das alles hätten wir ohne <strong>das</strong><br />
Auseinandernehmen nicht herausfinden können,<br />
es hatte also auch sein Gutes.»<br />
«Der Kodex ist einer der<br />
umfangreichsten Bilderzyklen<br />
des Spätmittelalters.<br />
Er ist ein wichtiges Zeugnis<br />
weiblicher Spiritualität.»<br />
Ulrike Bürger hat dann die gereinigten <strong>und</strong><br />
restaurierten Papierseiten zu einem Buchblock<br />
geb<strong>und</strong>en, dem sie einen komplett neuen Einband<br />
verpasst hat. Seine Holzdeckel sind mit<br />
hellem Ziegenleder überzogen. Sie nimmt den<br />
«neuen» Kodex 801 aus seiner Kassette, placiert<br />
ihn zwischen zwei Schaumstoffkeilen <strong>und</strong><br />
klappt ihn resolut auf. Es geht problemlos.<br />
Handschuhe trägt sie keine. «Nein, <strong>das</strong> wäre<br />
unsinnig. Gerade <strong>das</strong> Blättern in einer fragilen<br />
Papierhandschrift braucht Fingerspitzengefühl.»<br />
Auch die Journalistin darf die Seiten drehen.<br />
Wir bew<strong>und</strong>ern die elegante Schrift, die<br />
zarten, mit leuchtenden Farben ausgefüllten Federzeichnungen<br />
– eine wahre Augenweide!<br />
Was ist denn nun der Inhalt des Gebetbuches?<br />
Die Restauratorin verweist an den Spezialisten.<br />
Man habe die Gelegenheit benützt,<br />
um den Kodex wissenschaftlich aufzuarbeiten<br />
<strong>und</strong> die Ergebnisse 2012 im Urs Graf Verlag in<br />
Dietikon zu veröffentlichen.<br />
Der Germanist Nigel F. Palmer von der Universität<br />
Oxford hat zusammen mit dem Kunsthistoriker<br />
Jeffrey F. Hamburger, der an der Universität<br />
in Harvard lehrt, den Inhalt analysiert.<br />
Er ist begeistert: «Der Kodex 801 ist einer der<br />
umfangreichsten Bilderzyklen aus dem Spätmittelalter,<br />
die wir kennen. Wir sehen nicht nur<br />
die Genesis <strong>und</strong> gängige Bilder aus dem Leben<br />
Jesu, sondern viele in der mittelalterlichen<br />
Kunst sonst unbekannte Szenen, wie z. B. Johannes,<br />
der in der Gegenwart Mariens die<br />
Messe liest <strong>und</strong> ihr die Hostie überreicht; oder<br />
<strong>das</strong> Christkind, <strong>das</strong> sich auf den Schoss seiner<br />
Mutter legt <strong>und</strong> den Tod der unschuldigen Kinder<br />
beweint, deren Ermordung in der unteren<br />
Bildhälfte gezeigt wird.» Erstaunlich sei, <strong>das</strong>s<br />
der ursprüngliche Bilderzyklus, der um 1380/90<br />
in Strassburg entstand, r<strong>und</strong> 100 Jahre später<br />
mit Gebeten zu einer neuen Handschrift geb<strong>und</strong>en<br />
wurde. «Die Stimme, die in diesen privaten<br />
Selbstgekochter Weizenkleister, Leime <strong>und</strong> Ingredienzen für die Buchrestaurierung.<br />
Gebeten spricht, ist die einer Klosterfrau», sagt<br />
Palmer. Auch die letzte Besitzerin war eine<br />
Frau: Ursula Begerin, Nonne im Reuerinnen<br />
Kloster St. Magdalena in Strassburg, hat sich<br />
auf einer der letzten Buchseiten verewigt. Sie<br />
stammte aus einem Adelsgeschlecht in Strassburg<br />
<strong>und</strong> ist 1531 verstorben. Die Gebete sind<br />
laut Palmer literarisch höchst anspruchsvoll,<br />
elegant geschrieben <strong>und</strong> eigens zu den Bildern<br />
verfasst worden. Das gemeinsame Studium von<br />
Bild <strong>und</strong> Text diente einer speziellen Art der<br />
mittelalterlichen Meditation, die eine persönliche<br />
Beziehung zu Gott herzustellen suchte.<br />
Nonne als Auftraggeberin<br />
Wer die Gebete verfasst hat, ist nicht bekannt.<br />
Palmer vertritt die These, <strong>das</strong>s es ein Strassburger<br />
Kartäusermönch war. Bei der Auftraggeberin<br />
habe es sich wohl um eine Strassburger<br />
Klosterfrau gehandelt. «Vielleicht haben wir<br />
heute ganz falsche Vorstellungen von den Kontakten<br />
zwischen Mönchen <strong>und</strong> Nonnen in benachbarten<br />
Klöstern.» Dass es aber Ursula Begerin<br />
war, möchte er vorerst ausschliessen.<br />
Für Palmer ist nicht so wichtig, wer beim<br />
Malen oder Schreiben Pinsel oder Feder geführt<br />
hat, sondern wer den Auftrag erteilte.<br />
«Und diese Handschrift führt uns dezidiert in<br />
die Welt der Frauen. Der Kodex 801 ist ein<br />
wichtiges Zeugnis für weibliche Kultur <strong>und</strong><br />
Spiritualität im späten Mittelalter.» l<br />
Kodex 801: Lazarus in Abrahams Schoss (oben); unten bittet<br />
der Reiche im Höllenschl<strong>und</strong> um die Kühlung der Zunge.