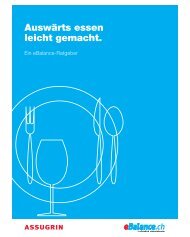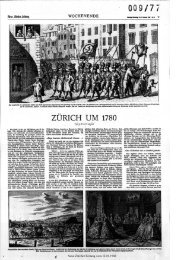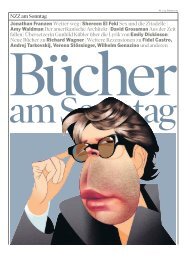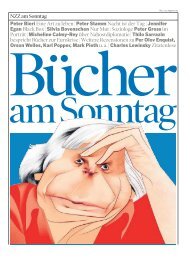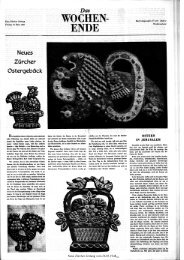Salman Rushdie Luka und das Lebensfeuer - Neue Zürcher Zeitung
Salman Rushdie Luka und das Lebensfeuer - Neue Zürcher Zeitung
Salman Rushdie Luka und das Lebensfeuer - Neue Zürcher Zeitung
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Sachbuch<br />
Musikgeschichte Zum 100. Todestag des Komponisten Gustav Mahler werden zwei lesenswerte<br />
Publikationen neu aufgelegt<br />
Mit abgebissenen Fingernägeln<br />
Gilbert Kaplan (Hrsg.): Das Mahler Album.<br />
Christian Brandstätter, Wien 2011.<br />
335 Seiten, Fr. 56.90.<br />
Kurt Blaukopf: Gustav Mahler oder Der<br />
Zeitgenosse der Zukunft. Braumüller,<br />
Wien 2011. 432 Seiten, Fr. 34.90.<br />
Von Corinne Holtz<br />
Der österreichische Komponist <strong>und</strong> Dirigent<br />
Gustav Mahler (1860–1911) ist spätestens<br />
seit Luchino Viscontis Film «Der<br />
Tod in Venedig» (1971) auch einem breiteren<br />
Publikum bekannt. Das Adagietto<br />
aus Mahlers Fünfter Sinfonie, <strong>das</strong> den<br />
So<strong>und</strong>track des Klassikers prägte, trat<br />
damals den Siegeszug in die Charts an.<br />
Die Rezeption von Mahlers Musik<br />
<strong>und</strong> seinem Hauptwerk (den zehn Sinfonien)<br />
ist faszinierend unterschiedlich:<br />
Während ihm einerseits Formlosigkeit,<br />
Gebrochenheit <strong>und</strong> Uneigentlichkeit<br />
(sprich «Kitsch») vorgeworfen wird, attestiert<br />
man ihm anderseits Modernität.<br />
Er montierte zum Beispiel Märsche <strong>und</strong><br />
Ländler in sinfonische Abläufe <strong>und</strong> entwickelte<br />
mit der Placierung von Fernorchestern<br />
einen zukunftsweisenden<br />
Raumklang. Für den Buchmarkt ist Mahlers<br />
Popularität ein Glücksfall <strong>und</strong> sein<br />
100. Todestag im Mai 2011 ein Anlass, die<br />
Aufmerksamkeit erneut zu nutzen. Eine<br />
Monografie <strong>und</strong> ein Fotoalbum sind neu<br />
herausgekommen.<br />
Angst vor dem Bild<br />
Wie macht sich Mahler vor der Kamera?<br />
Das «Mahler-Album» von Gilbert Kaplan<br />
(in zweiter überarbeiteter Fassung)<br />
liefert Antworten, ist es doch die definitive<br />
ikonografische Sammlung der überlieferten<br />
Fotografien. Mahler stand dem<br />
Bild kritisch gegenüber <strong>und</strong> hielt es mit<br />
Wagners Opern ähnlich wie Anton<br />
Bruckner: Musik braucht keine Bebilderung,<br />
<strong>das</strong> Hören beziehungsweise Lesen<br />
der Partitur ist Klang genug. Das könnte<br />
auch für ihn selbst gegolten haben: Mahler<br />
lässt sich offensichtlich ungern in<br />
Szene setzen. Auf keiner der Fotografien<br />
ein entspanntes Lachen – vielmehr<br />
spricht Ernst <strong>und</strong> Skepsis aus seinen<br />
Zügen. Als er vier oder fünf Jahre alt ist,<br />
setzt ein Fotograf den schüchternen<br />
Knaben ins Bild. Die linke Hand liegt auf<br />
einem Notenblatt, <strong>das</strong> fast halb so gross<br />
ist wie er, in der rechten Hand hält er<br />
einen Hut, was ihm einen Hauch des Erwachsenseins<br />
verleihen soll.<br />
Mahler hat überliefert, unter welch<br />
schmerzensreichen Bedingungen diese<br />
Fotografie entstanden ist: Er war überzeugt<br />
davon, <strong>das</strong>s ihn die Kamera einsaugen<br />
<strong>und</strong> dann für immer auf ein<br />
Stück schwarzen Pappkarton verbannen<br />
würde. Erst nachdem der Fotograf sich<br />
selbst abgelichtet <strong>und</strong> damit den Beweis<br />
erbracht hatte, <strong>das</strong>s die Kamera unge-<br />
20 ❘ NZZ am Sonntag ❘ 3. April 2011<br />
Der kleine Gustav<br />
Mahler posiert als<br />
Fünfjähriger 1865 mit<br />
einem Notenblatt.<br />
fährlich ist, willigte der kleine Gustav<br />
ein. Die Skepsis ist geblieben, zum Beispiel<br />
1905, als Mahler im Garten der<br />
Villa des Malers Carl Moll mit illustren<br />
Kollegen zu Tisch gesessen ist. Während<br />
der Regisseur Max Reinhardt <strong>und</strong><br />
der Komponist Hans Pfitzner genüsslich<br />
an ihren Zigarren ziehen <strong>und</strong> der<br />
Hausherr an einem Glas Wein nippt,<br />
steht Mahler abseits.<br />
Den sprechenden Bildern ist der berühmte<br />
Essay des Bühnenbildners Alfred<br />
Roller vorangestellt, der nach Mahlers<br />
Tod im Auftrag von dessen Frau<br />
Alma Mahler ein kleines Buch mit Fotografien<br />
<strong>und</strong> Zeichnungen herausgebracht<br />
hat. Der Arbeitskollege an der<br />
Wiener Hofoper ist ein ausgezeichneter<br />
Beobachter <strong>und</strong> Stilist, <strong>und</strong> sein Essay<br />
gehört zum Besten, was über den Menschen<br />
Gustav Mahler geschrieben worden<br />
ist. «Ich konnte diesen prachtvoll<br />
modellierten, braungebrannten Rücken<br />
nie ansehen, ohne an ein fites Rennpferd<br />
erinnert zu werden. Seine Hand war<br />
eine rechte Arbeiterhand, kurz <strong>und</strong><br />
breit, <strong>und</strong> die Finger ohne Verjüngung<br />
wie abgehackt endigend. Die Fingernägel<br />
– es muss leider gesagt werden –<br />
ÖSTERREICHISCHES THEATERMUSEUM / IMAGNO<br />
waren meist kurz abgebissen, oft bis<br />
aufs Blut.»<br />
Ähnlich ungeschminkt geht es in der<br />
wiederaufgelegten Biografie des Musiksoziologen<br />
Kurt Blaukopf zu, dem die<br />
Nachwelt die erste populärwissenschaftliche<br />
Mahler-Biografie von Rang<br />
verdankt. Der Autor erlag nicht der Versuchung,<br />
die zwischen Apologie <strong>und</strong> Polemik<br />
gespaltene Rezeption zu glätten.<br />
Vielmehr nahm er die damals noch<br />
kaum erschlossenen Quellen zum Anlass,<br />
1969 höchst anschaulich über<br />
Leben <strong>und</strong> Werk zu schreiben – so etwa<br />
über eines der frühen Engagements. Olmütz,<br />
im Winter 1883: Ein junger Kapellmeister<br />
reist aus Wien an, um <strong>das</strong><br />
Theater der mährischen Stadt aus der<br />
Krise zu führen.<br />
Couragierte Pionierleistung<br />
Abends findet man ihn im Gasthaus – er<br />
trinkt nur Wasser <strong>und</strong> isst vege tarisch.<br />
Kein W<strong>und</strong>er, <strong>das</strong>s der der Lebensreform<br />
zugeneigte «Nervenmensch» als närrischer<br />
Sonderling gilt. Allmählich gewöhnt<br />
man sich an die Eigenheiten des<br />
Dirigenten, der statt Mozart <strong>und</strong> Wagner<br />
«herunterzutaktieren» angeblich<br />
Bedeutungsloseres von Meyerbeer <strong>und</strong><br />
Verdi aufführt. Seine direkte «Art zu<br />
fordern, zu befehlen, war eine so dezidierte,<br />
<strong>das</strong>s es niemand wagte, ihm zu<br />
widersprechen», überlieferte ein Sänger,<br />
dem die Kunst am Herzen lag.<br />
Kurt Blaukopf war neben Lothar<br />
Knessl der einzige Musikpublizist in<br />
ganz Österreich, der nach 1945 gegen die<br />
anti semitisch geprägte Mahler-Rezeption<br />
(insbesondere auch des sehr einflussreichen<br />
Musikwissenschafters <strong>und</strong><br />
Ordinarius Erich Schenk) angetreten<br />
war <strong>und</strong> den Komponisten auf hohem<br />
Niveau verteidigte.<br />
Blaukopf schrieb den Gegenentwurf<br />
zu Adornos dialektischer Mahler-Monografie,<br />
indem er Leben <strong>und</strong> Werk positivistisch<br />
deutete. Ausserdem richtete<br />
er sich an ein breites Musikpublikum,<br />
<strong>das</strong> den schon vor dem Nationalsozialismus<br />
diffamierten Komponisten kaum<br />
kennen konnte.<br />
Blaukopfs Biografie gilt neben Adornos<br />
Monografie zu Recht als Standardwerk.<br />
Die Lektüre ist über weite Strecken<br />
erfrischend, auch wenn der Autor<br />
gelegentlich Kriegsmetaphern bemüht<br />
<strong>und</strong> <strong>das</strong> Thema Mahler <strong>und</strong> die Frauen<br />
heutigen Ansprüchen nicht genügt. Hingegen<br />
verzichtet er auf die Rolle des Hagiografen<br />
<strong>und</strong> bleibt bei aller Liebe zum<br />
Gegenstand der kritische Autor, der sich<br />
als Interpret seiner Quellen offenbart.<br />
So kommt Blaukopf etwa zum Schluss,<br />
<strong>das</strong>s sich Mahlers «Doppelcharakter»<br />
schon früh ausgeprägt hat <strong>und</strong> der verinnerlichte<br />
«Träumer» immer dann zum<br />
nüchternen «Taktiker» wurde, wenn es<br />
um die Kunst ging. ●