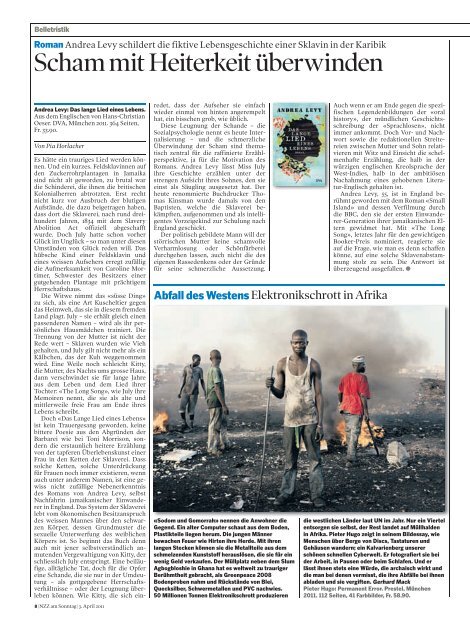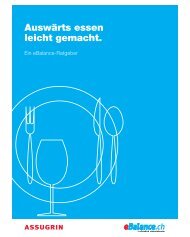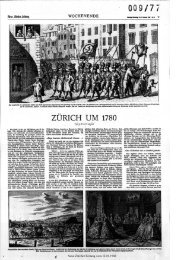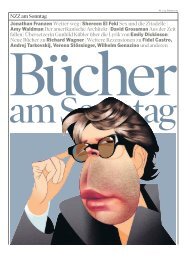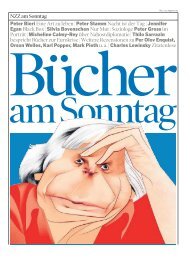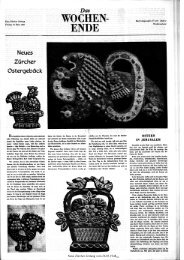Salman Rushdie Luka und das Lebensfeuer - Neue Zürcher Zeitung
Salman Rushdie Luka und das Lebensfeuer - Neue Zürcher Zeitung
Salman Rushdie Luka und das Lebensfeuer - Neue Zürcher Zeitung
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Belletristik<br />
Roman Andrea Levy schildert die fiktive Lebensgeschichte einer Sklavin in der Karibik<br />
Scham mit Heiterkeit überwinden<br />
Andrea Levy: Das lange Lied eines Lebens.<br />
Aus dem Englischen von Hans-Christian<br />
Oeser. DVA, München 2011. 364 Seiten,<br />
Fr. 33.90.<br />
Von Pia Horlacher<br />
Es hätte ein trauriges Lied werden können.<br />
Und ein kurzes. Feldsklavinnen auf<br />
den Zuckerrohrplantagen in Jamaika<br />
sind nicht alt geworden, zu brutal war<br />
die Schinderei, die ihnen die britischen<br />
Kolonialherren abtrotzten. Erst recht<br />
nicht kurz vor Ausbruch der blutigen<br />
Aufstände, die dazu beigetragen haben,<br />
<strong>das</strong>s dort die Sklaverei, nach r<strong>und</strong> dreih<strong>und</strong>ert<br />
Jahren, 1834 mit dem Slavery<br />
Abolition Act offiziell abgeschafft<br />
wurde. Doch July hatte schon vorher<br />
Glück im Unglück – so man unter diesen<br />
Umständen von Glück reden will. Das<br />
hübsche Kind einer Feldsklavin <strong>und</strong><br />
eines weissen Aufsehers erregt zufällig<br />
die Aufmerksamkeit von Caroline Mortimer,<br />
Schwester des Besitzers einer<br />
gutgehenden Plantage mit prächtigem<br />
Herrschaftshaus.<br />
Die Witwe nimmt <strong>das</strong> «süsse Ding»<br />
zu sich, als eine Art Kuscheltier gegen<br />
<strong>das</strong> Heimweh, <strong>das</strong> sie in diesem fremden<br />
Land plagt. July – sie erhält gleich einen<br />
passenderen Namen – wird als ihr persönliches<br />
Hausmädchen trainiert. Die<br />
Trennung von der Mutter ist nicht der<br />
Rede wert – Sklaven wurden wie Vieh<br />
gehalten, <strong>und</strong> July gilt nicht mehr als ein<br />
Kälbchen, <strong>das</strong> der Kuh weggenommen<br />
wird. Eine Weile noch schleicht Kitty,<br />
die Mutter, des Nachts ums grosse Haus,<br />
dann verschwindet sie für lange Jahre<br />
aus dem Leben <strong>und</strong> dem Lied ihrer<br />
Tochter: «The Long Song», wie July ihre<br />
Memoiren nennt, die sie als alte <strong>und</strong><br />
mittlerweile freie Frau am Ende ihres<br />
Lebens schreibt.<br />
Doch «Das Lange Lied eines Lebens»<br />
ist kein Trauergesang geworden, keine<br />
bittere Poesie aus den Abgründen der<br />
Barbarei wie bei Toni Morrison, sondern<br />
die erstaunlich heitere Erzählung<br />
von der tapferen Überlebenskunst einer<br />
Frau in den Ketten der Sklaverei. Dass<br />
solche Ketten, solche Unterdrückung<br />
für Frauen noch immer existieren, wenn<br />
auch unter anderem Namen, ist eine gewiss<br />
nicht zufällige Nebenerkenntnis<br />
des Romans von Andrea Levy, selbst<br />
Nachfahrin jamaikanischer Einwanderer<br />
in England. Das System der Sklaverei<br />
lebt vom ökonomischen Besitzanspruch<br />
des weissen Mannes über den schwarzen<br />
Körper, dessen Gr<strong>und</strong>muster die<br />
sexuelle Unterwerfung des weiblichen<br />
Körpers ist. So beginnt <strong>das</strong> Buch denn<br />
auch mit jener selbstverständlich anmutenden<br />
Vergewaltigung von Kitty, der<br />
schliesslich July entspringt. Eine beiläufige,<br />
alltägliche Tat, doch für die Opfer<br />
eine Schande, die sie nur in der Umdeutung<br />
– als gottgegebene Herrschaftsverhältnisse<br />
– oder der Leugnung überleben<br />
können. Wie Kitty, die sich ein-<br />
8 ❘ NZZ am Sonntag ❘ 3. April 2011<br />
redet, <strong>das</strong>s der Aufseher sie einfach<br />
wieder einmal von hinten angerempelt<br />
hat, ein bisschen grob, wie üblich.<br />
Diese Leugnung der Schande – die<br />
Sozialpsychologie nennt es heute Internalisierung<br />
– <strong>und</strong> die schmerzliche<br />
Überwindung der Scham sind thematisch<br />
zentral für die raffinierte Erzählperspektive,<br />
ja für die Motivation des<br />
Romans. Andrea Levy lässt Miss July<br />
ihre Geschichte erzählen unter der<br />
strengen Aufsicht ihres Sohnes, den sie<br />
einst als Säugling ausgesetzt hat. Der<br />
heute renommierte Buchdrucker Thomas<br />
Kinsman wurde damals von den<br />
Baptisten, welche die Sklaverei bekämpften,<br />
aufgenommen <strong>und</strong> als intelligentes<br />
Vorzeigekind zur Schulung nach<br />
England geschickt.<br />
Der politisch gebildete Mann will der<br />
störrischen Mutter keine schamvolle<br />
Verharmlosung oder Schönfärberei<br />
durchgehen lassen, auch nicht die des<br />
eigenen Rassedenkens oder der Gründe<br />
für seine schmerzliche Aussetzung.<br />
Abfall des Westens Elektronikschrott in Afrika<br />
«Sodom <strong>und</strong> Gomorrah» nennen die Anwohner die<br />
Gegend. Ein alter Computer schaut aus dem Boden,<br />
Plastikteile liegen herum. Die jungen Männer<br />
bewachen Feuer wie Hirten ihre Herde. Mit ihren<br />
langen Stecken können sie die Metallteile aus dem<br />
schmelzenden Kunststoff herauslösen, die sie für ein<br />
wenig Geld verkaufen. Der Müllplatz neben dem Slum<br />
Agbogbloshie in Ghana hat es weltweit zu trauriger<br />
Berühmtheit gebracht, als Greenpeace 2008<br />
Bodenproben nahm <strong>und</strong> Rückstände von Blei,<br />
Quecksilber, Schwermetallen <strong>und</strong> PVC nachwies.<br />
50 Millionen Tonnen Elektronikschrott produzieren<br />
Auch wenn er am Ende gegen die spezifischen<br />
Legendenbildungen der «oral<br />
history», der mündlichen Geschichtsschreibung<br />
der «Sprachlosen», nicht<br />
immer ankommt. Doch Vor- <strong>und</strong> Nachwort<br />
sowie die redaktionellen Streitereien<br />
zwischen Mutter <strong>und</strong> Sohn relativieren<br />
mit Witz <strong>und</strong> Einsicht die schelmenhafte<br />
Erzählung, die halb in der<br />
würzigen englischen Kreolsprache der<br />
West-Indies, halb in der ambitiösen<br />
Nach ahmung eines gehobenen Literatur-Englisch<br />
gehalten ist.<br />
Andrea Levy, 55, ist in England berühmt<br />
geworden mit dem Roman «Small<br />
Island» <strong>und</strong> dessen Verfilmung durch<br />
die BBC, den sie der ersten Einwanderer-Generation<br />
ihrer jamaikanischen Eltern<br />
gewidmet hat. Mit «The Long<br />
Song», letztes Jahr für den gewichtigen<br />
Booker-Preis nominiert, reagierte sie<br />
auf die Frage, wie man es denn schaffen<br />
könne, auf eine solche Sklavenabstammung<br />
stolz zu sein. Die Antwort ist<br />
überzeugend ausgefallen. ●<br />
die westlichen Länder laut UN im Jahr. Nur ein Viertel<br />
entsorgen sie selbst, der Rest landet auf Müllhalden<br />
in Afrika. Pieter Hugo zeigt in seinem Bildessay, wie<br />
Menschen über Berge von Discs, Tastaturen <strong>und</strong><br />
Gehäusen wandern; ein Kalvarienberg unserer<br />
schönen schnellen Cyberwelt. Er fotografiert sie bei<br />
der Arbeit, in Pausen oder beim Schlafen. Und er<br />
lässt ihnen stets eine Würde, die archaisch wirkt <strong>und</strong><br />
die man bei denen vermisst, die ihre Abfälle bei ihnen<br />
abladen <strong>und</strong> sie vergiften. Gerhard Mack<br />
Pieter Hugo: Permanent Error. Prestel, München<br />
2011. 112 Seiten, 41 Farbbilder, Fr. 58.90.