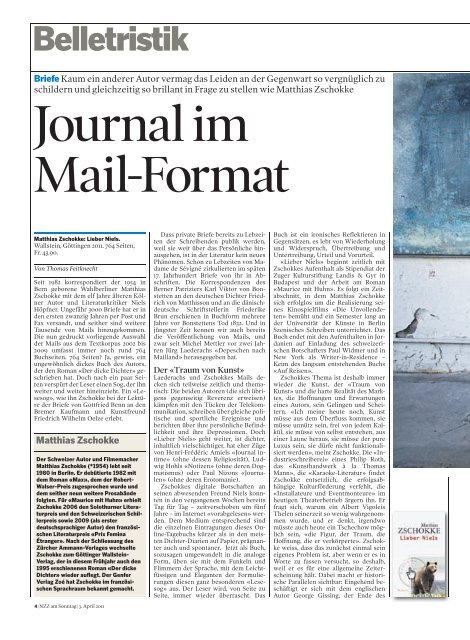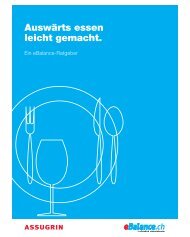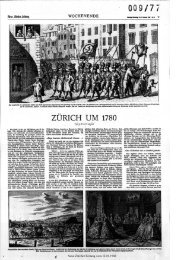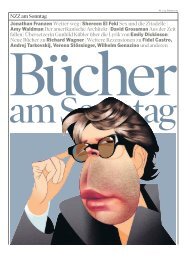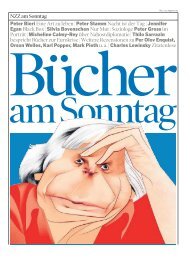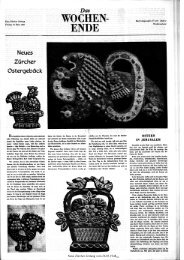Salman Rushdie Luka und das Lebensfeuer - Neue Zürcher Zeitung
Salman Rushdie Luka und das Lebensfeuer - Neue Zürcher Zeitung
Salman Rushdie Luka und das Lebensfeuer - Neue Zürcher Zeitung
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Belletristik<br />
Briefe Kaum ein anderer Autor vermag <strong>das</strong> Leiden an der Gegenwart so vergnüglich zu<br />
schildern <strong>und</strong> gleichzeitig so brillant in Frage zu stellen wie Matthias Zschokke<br />
Journal im<br />
Mail-Format<br />
Matthias Zschokke: Lieber Niels.<br />
Wallstein, Göttingen 2011. 764 Seiten,<br />
Fr. 43.90.<br />
Von Thomas Feitknecht<br />
Seit 1982 korrespondiert der 1954 in<br />
Bern geborene Wahlberliner Matthias<br />
Zschokke mit dem elf Jahre älteren Kölner<br />
Autor <strong>und</strong> Literaturkritiker Niels<br />
Höpfner. Ungefähr 3000 Briefe hat er in<br />
den ersten zwanzig Jahren per Post <strong>und</strong><br />
Fax versandt, <strong>und</strong> seither sind weitere<br />
Tausende von Mails hinzugekommen.<br />
Die nun gedruckt vorliegende Auswahl<br />
der Mails aus dem Textkorpus 2002 bis<br />
2009 umfasst immer noch r<strong>und</strong> 764<br />
Buchseiten. 764 Seiten? Ja, gewiss, ein<br />
ungewöhnlich dickes Buch des Autors,<br />
der den Roman «Der dicke Dichter» geschrieben<br />
hat. Doch nach ein paar Seiten<br />
verspürt der Leser einen Sog, der ihn<br />
weiter <strong>und</strong> weiter hineinzieht. Ein «Lesesog»,<br />
wie ihn Zschokke bei der Lektüre<br />
der Briefe von Gottfried Benn an den<br />
Bremer Kaufmann <strong>und</strong> Kunstfre<strong>und</strong><br />
Friedrich Wilhelm Oelze erlebt.<br />
Matthias Zschokke<br />
Der Schweizer Autor <strong>und</strong> Filmemacher<br />
Matthias Zschokke (*1954) lebt seit<br />
1980 in Berlin. Er debütierte 1982 mit<br />
dem Roman «Max», dem der Robert-<br />
Walser-Preis zugesprochen wurde <strong>und</strong><br />
dem seither neun weitere Prosabände<br />
folgten. Für «Maurice mit Huhn» erhielt<br />
Zschokke 2006 den Solothurner Literaturpreis<br />
<strong>und</strong> den Schweizerischen Schillerpreis<br />
sowie 2009 (als erster<br />
deutschsprachiger Autor) den französischen<br />
Literaturpreis «Prix Femina<br />
Étranger». Nach der Schliessung des<br />
<strong>Zürcher</strong> Ammann-Verlages wechselte<br />
Zschokke zum Göttinger Wallstein-<br />
Verlag, der in diesem Frühjahr auch den<br />
1995 erschienenen Roman «Der dicke<br />
Dichter» wieder auflegt. Der Genfer<br />
Verlag Zoé hat Zschokke im französischen<br />
Sprachraum bekannt gemacht.<br />
4 ❘ NZZ am Sonntag ❘ 3. April 2011<br />
Dass private Briefe bereits zu Lebzeiten<br />
der Schreibenden publik werden,<br />
weil sie weit über <strong>das</strong> Persönliche hinausgehen,<br />
ist in der Literatur kein neues<br />
Phänomen. Schon zu Lebzeiten von Madame<br />
de Sévigné zirkulierten im späten<br />
17. Jahrh<strong>und</strong>ert Briefe von ihr in Abschriften.<br />
Die Korrespondenzen des<br />
Berner Patriziers Karl Viktor von Bonstetten<br />
an den deutschen Dichter Friedrich<br />
von Matthisson <strong>und</strong> an die dänischdeutsche<br />
Schriftstellerin Friederike<br />
Brun erschienen in Buchform mehrere<br />
Jahre vor Bonstettens Tod 1832. Und in<br />
jüngster Zeit kennen wir auch bereits<br />
die Veröffentlichung von Mails, <strong>und</strong><br />
zwar seit Michel Mettler vor zwei Jahren<br />
Jürg Laederachs «Depeschen nach<br />
Mailland» herausgegeben hat.<br />
Der «Traum von Kunst»<br />
Laederachs <strong>und</strong> Zschokkes Mails decken<br />
sich teilweise zeitlich <strong>und</strong> thematisch:<br />
Die beiden Autoren (die sich übrigens<br />
gegenseitig Reverenz erweisen)<br />
kämpfen mit den Tücken der Telekommunikation,<br />
schreiben über gleiche politische<br />
<strong>und</strong> sportliche Ereignisse <strong>und</strong><br />
berichten über ihre persönliche Befindlichkeit<br />
<strong>und</strong> ihre Depressionen. Doch<br />
«Lieber Niels» geht weiter, ist dichter,<br />
inhaltlich vielschichtiger, hat eher Züge<br />
von Henri-Frédéric Amiels «Journal intime»<br />
(ohne dessen Religiosität), Ludwig<br />
Hohls «Notizen» (ohne deren Dogmatismus)<br />
oder Paul Nizons «Journalen»<br />
(ohne deren Erotomanie).<br />
Zschokkes digitale Botschaften an<br />
seinen abwesenden Fre<strong>und</strong> Niels konnten<br />
in den vergangenen Wochen bereits<br />
Tag für Tag – zeitverschoben um fünf<br />
Jahre – im Internet «vorabgelesen» werden.<br />
Dem Medium entsprechend sind<br />
die einzelnen Eintragungen dieses Online-Tagebuchs<br />
kürzer als in den meisten<br />
Dichter-Diarien auf Papier, prägnanter<br />
auch <strong>und</strong> spontaner. Jetzt als Buch,<br />
sozusagen umgewandelt in die analoge<br />
Form, üben sie mit dem Funkeln <strong>und</strong><br />
Flimmern der Sprache, mit dem Leichtfüssigen<br />
<strong>und</strong> Eleganten der Formulierungen<br />
diesen ganz besonderen «Lesesog»<br />
aus. Der Leser wird, von Seite zu<br />
Seite, immer wieder überrascht. Das<br />
Buch ist ein ironisches Reflektieren in<br />
Gegensätzen, es lebt von Wiederholung<br />
<strong>und</strong> Widerspruch, Übertreibung <strong>und</strong><br />
Untertreibung, Urteil <strong>und</strong> Vorurteil.<br />
«Lieber Niels» beginnt zeitlich mit<br />
Zschokkes Aufenthalt als Stipendiat der<br />
Zuger Kulturstiftung Landis & Gyr in<br />
Budapest <strong>und</strong> der Arbeit am Roman<br />
«Maurice mit Huhn». Es folgt ein Zeitabschnitt,<br />
in dem Matthias Zschokke<br />
sich erfolglos um die Realisierung seines<br />
Kinospielfilms «Die Unvollendeten»<br />
bemüht <strong>und</strong> ein Semester lang an<br />
der Universität der Künste in Berlin<br />
Szenisches Schreiben unterrichtet. Das<br />
Buch endet mit den Aufenthalten in Jordanien<br />
auf Einladung des schweizerischen<br />
Botschafters Paul Widmer <strong>und</strong> in<br />
New York als Writer-in-Residence –<br />
Keim des langsam entstehenden Buchs<br />
«Auf Reisen».<br />
Zschokkes Thema ist deshalb immer<br />
wieder die Kunst, der «Traum von<br />
Kunst» <strong>und</strong> die harte Realität des Marktes,<br />
die Hoffnungen <strong>und</strong> Erwartungen<br />
eines Autors, sein Gelingen <strong>und</strong> Scheitern.<br />
«Ich meine heute noch, Kunst<br />
müsse aus dem Überfluss kommen, sie<br />
müsse unnütz sein, frei von jedem Kalkül,<br />
sie müsse von selbst entstehen, aus<br />
einer Laune heraus, sie müsse der pure<br />
Luxus sein, sie dürfe nicht funktionalisiert<br />
werden», meint Zschokke. Die «Industrieschreiberei»<br />
eines Philip Roth,<br />
<strong>das</strong> «Kunsthandwerk à la Thomas<br />
Mann», die «Karaoke-Literatur» findet<br />
Zschokke entsetzlich, die erfolgsabhängige<br />
Kulturförderung verfehlt, die<br />
«Installateure <strong>und</strong> Eventmonteure» im<br />
heutigen Theaterbetrieb ärgern ihn. Er<br />
fragt sich, warum ein Albert Vigoleis<br />
Thelen seinerzeit so wenig wahrgenommen<br />
wurde, <strong>und</strong> er denkt, irgendwo<br />
müsste auch heute ein Tschechow möglich<br />
sein, «die Figur, der Traum, die<br />
Hoffnung, die er verkörperte». Zschokke<br />
weiss, <strong>das</strong>s <strong>das</strong> zunächst einmal sein<br />
eigenes Problem ist, aber wenn er es in<br />
Worte zu fassen versucht, so deshalb,<br />
weil er es für eine allgemeine Zeiterscheinung<br />
hält. Dabei macht er historische<br />
Parallelen sichtbar: Eingehend beschäftigt<br />
er sich mit dem englischen<br />
Autor George Gissing, der Ende des