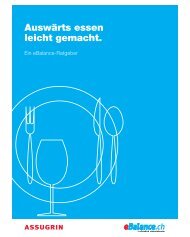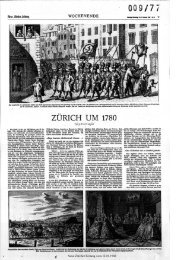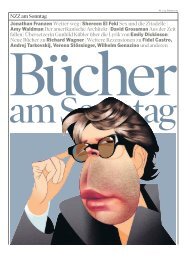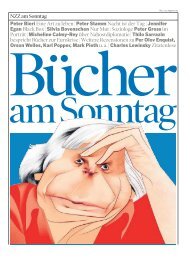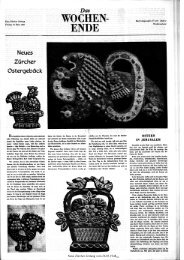Salman Rushdie Luka und das Lebensfeuer - Neue Zürcher Zeitung
Salman Rushdie Luka und das Lebensfeuer - Neue Zürcher Zeitung
Salman Rushdie Luka und das Lebensfeuer - Neue Zürcher Zeitung
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Sachbuch<br />
Suchtmittel Pflanzen als Rauschgift <strong>und</strong> Medizin gehören zum kulturellen Brauchtum <strong>und</strong> lassen<br />
sich kaum eindämmen oder abschaffen<br />
Keine Gesellschaft kommt<br />
ohne Drogen aus<br />
Mike Jay: High Society. Eine<br />
Kulturgeschichte der Drogen. Primus,<br />
Darmstadt 2011. 192 Seiten, Fr. 43.50.<br />
Von Peter Durtschi<br />
Wenn die ersten Sonnenstrahlen China<br />
erreichen, werden dort bereits Teeblätter<br />
zubereitet. In zahllosen Varianten<br />
rinnt der koffeinhaltige Aufguss durch<br />
die Kehlen. Von Indonesien bis nach Indien<br />
hingegen werden über h<strong>und</strong>ert<br />
Millionen Menschen ein Blatt des Betel-<br />
Pfeffers mit Kalk bestreichen, ein Stück<br />
der Aretanuss darin einrollen <strong>und</strong> den<br />
Bissen mit den Zähnen zerdrücken. Die<br />
Erde rollt schon dem Nachmittag entgegen,<br />
<strong>und</strong> im Jemen kaut man die Blätter<br />
des Khatstrauches. Wenn im Westen der<br />
Tag anbricht, stärken sich Millionen mit<br />
Espresso. Lastwagen liefern Alkohol<br />
<strong>und</strong> Tabak an, Kokain- <strong>und</strong> Ecstasy-Portionen<br />
wechseln den Besitzer, Cannabisrauch<br />
steigt in Afrika auf. In Mexiko ernten<br />
Ureinwohner den Peyote-Kaktus.<br />
Und wenn die letzten Sonnenstrahlen<br />
die Inseln im Südpazifik erreichen,<br />
macht dort ein Trank aus der Wurzel<br />
des Rauschpfeffers die R<strong>und</strong>e.<br />
Keine Gesellschaft, stellt der britische<br />
Kulturhistoriker Mike Jay zu Beginn<br />
seines Streifzugs durch die «high<br />
societies» fest, kommt ohne Drogen aus.<br />
Zwar konsumieren auch Tiere Substanzen,<br />
die auf <strong>das</strong> Bewusstsein oder den<br />
Körper eine biochemische Wirkung<br />
ausüben. Anders als bei den Tieren sei<br />
der menschliche Drogenkonsum aber<br />
«Bestandteil einer sprachlichen <strong>und</strong><br />
24 ❘ NZZ am Sonntag ❘ 3. April 2011<br />
symbolischen Kultur, in deren Rahmen<br />
er Bedeutung erhält». So wirkt beispielsweise<br />
Kawa, der südpazifische<br />
Trunk aus dem Rauschpfeffer, sozial stabilisierend.<br />
Das Gebräu beschert ein<br />
paar St<strong>und</strong>en leichter Trance <strong>und</strong> fördert<br />
damit positive Verhaltensweisen<br />
wie Grosszügigkeit <strong>und</strong> Sensibilität.<br />
Beim gemeinsamen Kawatrinken werden<br />
fre<strong>und</strong>schaftliche Beziehungen hergestellt<br />
<strong>und</strong> Verträge besiegelt.<br />
Drogen in der Subkultur<br />
Nun hat sich aber nicht jede Substanz in<br />
jeder Gemeinschaft durchgesetzt – geschichtlich<br />
gesehen war es in den meisten<br />
Kulturen üblich, nur eine kleine Anzahl<br />
von Drogen für den allgemeinen<br />
Gebrauch zu bestimmen. Kam es zu Verboten,<br />
waren diese auch Zeichen eines<br />
tiefgreifenden sozialen Wandels. Das ist<br />
beispielsweise beim Alkoholverbot im<br />
Islam der Fall: Die muslimischen Händler<br />
pflegten asketisch-einfache Lebensgewohnheiten;<br />
in den bis dahin dominierenden<br />
Kaufleuten der mediterranen<br />
Küstenstädte sahen sie eine dekadente<br />
Elite, die ihren Reichtum am Wein verschwendete.<br />
Erst als sich <strong>das</strong> Alkoholverbot<br />
durchgesetzt hatte, war auch die<br />
kulturelle Hegemonie etabliert. Konzentrationsfördernde<br />
Drogen wie Tee <strong>und</strong><br />
Kaffee, teilweise auch die Kolanuss <strong>und</strong><br />
Khat, wurden nun zu Elementen des sozialen<br />
Austausches <strong>und</strong> der Musse.<br />
Auch Subkulturen waren in vormoderner<br />
Zeit zu beobachten. Im London<br />
des 18. Jahrh<strong>und</strong>erts beispielsweise galt<br />
<strong>das</strong> Leben in den Kaffeehäusern Beteiligten<br />
wie Aussenstehenden als Drogen-<br />
Dealer verkauft<br />
Kokainkapseln in<br />
Berlin, 1920er-Jahre.<br />
BUNDESARCHIV BERLIN<br />
Subkultur – die Vorliebe für ein exotisches<br />
Stimulans bot einer kleinen, aber<br />
einflussreichen Gruppe <strong>das</strong> Motiv, einen<br />
Raum zu schaffen, wo man mit Gleichgesinnten<br />
verkehren konnte. Was man<br />
dort chemisch gesehen zu sich nahm,<br />
war aber weitgehend unbekannt. Mehr<br />
als 1500 Jahre für die Pharmazie massgebend<br />
war die «Materia medica». In diesem<br />
Buch behandelt der spätantike<br />
Autor Pedanios Dioskurides auch Pflanzen<br />
mit bewusstseinsverändernden<br />
Wir kungen. Er nahm allerdings an, <strong>das</strong>s<br />
die Wirkung einer Droge nicht in der<br />
Substanz selbst liege, sondern in der<br />
eingenommenen Dosis.<br />
Erst durch weltweite Entdeckungsreisen<br />
gelangte die reiche Flora stimulierender<br />
<strong>und</strong> bewusstseinserweiternder<br />
Pflanzen der <strong>Neue</strong>n Welt in den Westen.<br />
Und mit dem wachsenden Wissen über<br />
chemische Zusammenhänge begriffen<br />
die Praktiker allmählich, <strong>das</strong>s Drogen<br />
unabhängig von der Pflanze wirken, die<br />
sie enthält. Auch dank Selbstversuchen<br />
der Forscher nahm die Pharmazie einen<br />
stürmischen Fortschritt. Der deutsche<br />
Apothekergehilfe Friedrich Sertürner<br />
beispielsweise isolierte ab 1803 aus Opiumkonzentrat<br />
nicht bloss eine pflanzliche<br />
Essenz, sondern eine eigenständige<br />
Substanz, die er Morphin nannte.<br />
Medizinische Wirkung<br />
Um 1890 boten Apotheken Kokain in<br />
Form von Pillen oder energiesteigernden<br />
Getränken an. Cannabis war Bestandteil<br />
zahlreicher Tinkturen, Bayer<br />
verkaufte ein opiathaltiges Hustenmittel<br />
unter dem Markennamen «Heroin».<br />
Auch kleine Stahlschachteln mit Morphin<br />
<strong>und</strong> mehreren Nadeln waren frei<br />
erhältlich; sie revolutionierten zwar die<br />
Schmerzbehandlung, verführten aber<br />
auch zum Missbrauch. Die Substanzen<br />
wurden nun zum Ziel medizinischer<br />
<strong>und</strong> medialer Kampagnen. Zunehmend<br />
überlagerte die Alltagssprache den ursprünglichen<br />
Drogenbegriff. Wurden im<br />
Englischen ab 1400 «getrocknete<br />
Waren» als drugs bezeichnet, galt nun<br />
eine «Droge» als bewusstseinsverändernde<br />
Substanz, die illegal ist.<br />
In seinem flüssig geschriebenen <strong>und</strong><br />
prachtvoll illustrierten Buch geht Mike<br />
Jay auf den Opium- <strong>und</strong> Teehandel im<br />
19. Jahrh<strong>und</strong>ert ebenso ein wie auf die<br />
Entwicklung von Designerdrogen oder<br />
<strong>das</strong> 1961 von der Uno beschlossene Einheitsabkommen<br />
über Betäubungsmittel.<br />
Ironischerweise trat just in dieser Zeit<br />
eine neugierige Jugend auf den Plan.<br />
«Drogengenuss als Brauchtum ist ein<br />
kulturelles Konstrukt: Offizielle Verfügungen<br />
können es eindämmen, aber<br />
kaum abschaffen», sagt der Autor. ●